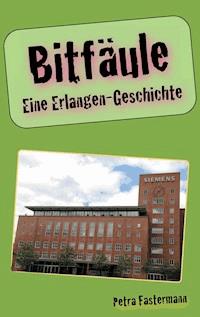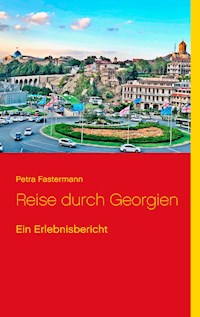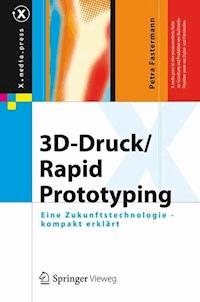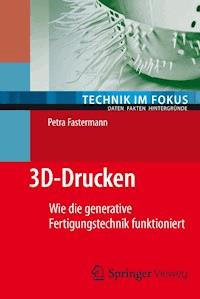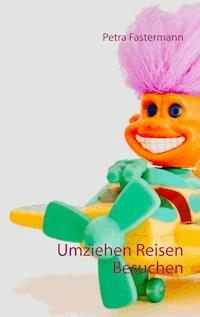
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Haus beziehen, verreisen, Besuche machen, in Rente gehen, sterben. All das sind sehr gewöhnliche, teilweise angenehme, teilweise leider unvermeidliche Ereignisse in den Leben der Menschen. Davon handeln fünf der sechs Geschichten. Eine fällt aus dem Rahmen: Die kleine Geschichte über den Meckerer zeigt ein Beispiel dafür, wie es manche anstellen, nichts weiter zu tun als sich zu ärgern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto des Buchumschlags: Petra Fastermann Umschlaggestaltung: Petra Fastermann
Inhaltsverzeichnis
DER MECKERER
M
ECKERN UND NÖRGELN
, R
ECHT HABEN
,
AUF JEDEN
F
ALL
:
NICHTS MACHEN UND TROTZDEM BESSER SEIN ALS ANDERE
A
NDEREN NICHTS GÖNNEN
–
AUßER
S
CHADEN
S
ICH IMMER WIEDER SCHLAU MACHEN
G
ENIEßEN UND FEIERN
REISEBEKANNTSCHAFT
EIN HAUS VON 1909
U
ERDINGEN UND DAS
H
AUS IN DER
A
UGUSTASTRAßE
D
AS
H
AUS MUSS WIEDER BEWOHNBAR GEMACHT WERDEN
D
AS
H
AUS LEIDET AN ALTEN
B
AUSÜNDEN
W
ENN AUCH KEIN
S
CHATZ
,
SO DOCH GANZ INTERESSANTE
F
UNDE
E
IN
G
ARTEN GEHÖRT DAZU
U
NERFREULICHE
Ü
BERRASCHUNGEN
D
ER
G
ENERAL
-A
NZEIGER FÜR
K
REFELD UND DEN
N
IEDERRHEIN AUS DEM
J
AHR
1909
D
ER
B
ESEN
P
EGGY
P
ERFECT UND DIE
S
CHÜLERIN
J
ESSICA
S
CHMITZ
M
IETER FÜR DIESES
H
AUS
?
E
INE KAPUTTE
T
ÜR UND EIN
W
ASSERSCHADEN
E
IN GESTOHLENES
J
UGENDSTILFENSTER
?
W
IR ZIEHEN EIN
Q
UELLEN
DREI REISEN, EINE DAVON DAS ENDE
MISCHA UND GALINA: ARM SEIN UND DABEI ALT WERDEN
M
ISCHA
: R
ENTNER SEIN UND SICH SCHLECHT FÜHLEN
M
ISCHA
,
DER
B
ÄR
D
IE
V
ORGESCHICHTE DES
R
ENTNERLEBENS
L
ANGSAM UND FAUL SEIN
–
UND EIGENTLICH NICHT SO SEIN WOLLEN
L
ANGSAM AN SICH VERZWEIFELN
S
ICH ZU VIEL MIT DER
V
ERGANGENHEIT BESCHÄFTIGEN
S
ICH FRAGEN
,
WAS AUS ANDEREN GEWORDEN IST
G
EWOHNHEITEN PFLEGEN UND SICH SOGAR FÜR MANCHES INTERESSIEREN
G
ALINA
:
IN
R
ENTE GEHEN UND DABEI ZUSAMMEN MIT
M
ISCHA ZU EINEM GUTEN
E
NDE KOMMEN
ZOO-BESUCHE
ZUR AUTORIN
Der Meckerer
Meckern und nörgeln, Recht haben, auf jeden Fall: nichts machen und trotzdem besser sein als andere
Das Nörgeln und Kritisieren fällt ihm sehr leicht. Auffällig ist dabei, dass er selbst nicht viel leistet, aber zu allem eine Meinung hat, die er niemals für sich behält. Stets ist er der Überzeugung, etwas „klipp und klar“ sagen zu müssen: „Ich sage es Ihnen klipp und klar!“ – Missverständnis ausgeschlossen. Diese Meinung fällt in der Regel so aus, dass er etwas zu bemängeln hat. Es lässt sich immer etwas finden. Statt selbst durch große Taten zu beeindrucken, beschäftigt der Meckerer sich damit, die Leistungen anderer sorgfältig zu untersuchen – und überlegt dabei angestrengt, was er daran kritisieren kann. Bei bereits Geschaffenem Fehler zu finden ist keine große Kunst, da selten beim ersten Versuch alles hundertprozentig gelingt. Selbst etwas zu schaffen aber ist dem Meckerer unmöglich. Zum einen ist er nicht kreativ, zum anderen wäre jedes Tun ein Wagnis, weil die Möglichkeit des Scheiterns niemals ausgeschlossen werden kann. Es besteht das Risiko, dass etwas schief gehen könnte. Wäre der Meckerer überhaupt in der Lage etwas zu leisten, hätte er einmal eine Idee, so würde er nicht wollen. Auf gar keinen Fall möchte der Meckerer eigenverantwortlich etwas tun, weil er weiß, dass er auf diese Art eine Angriffsfläche bieten könnte. Andere jedoch, die etwas leisten oder erschaffen, können mit dem Meckerer rechnen. Sie dürfen fest auf ihn zählen, denn ganz sicher ist: Der Meckerer hätte es besser gemacht. Sein Leben ist durch den Konjunktiv bestimmt. Alles, was sein könnte oder hätte geschehen können, prägt sein Leben.
Wenn ihm etwas nicht gefällt – und es liegt in seiner Natur, dass das immer so ist – dann ist der Meckerer der Ansicht, dass ein unbekannter „Jemand“ etwas gegen den Missstand unternehmen sollte: „Da müsste doch mal jemand …“, denkt er einen Gedanken an. Und nicht zu Ende. „Da sollte doch mal einer …“, schlägt er eilig und engagiert vor. Aber weiter spricht er nicht. Nur auf die Idee, dass er, der Meckerer, derjenige sein könnte, der handelt, kommt er nie. Warum sollte er sich um etwas kümmern, wenn es doch genügend andere Leute gibt, die eine unerfreuliche Sache in die Hand nehmen, ein dummes Problem lösen könnten? „Damit kann ich jedenfalls nicht dienen,“ meint der Meckerer. Das Dienen ist sowieso nicht seine Sache. Heiliger Strohsack, denkt er sich, wo käme er da hin, wenn er allen nur Gefallen täte? Er kann doch nicht das ganze Leid der Welt stemmen und sich mit jedem Unglück beschäftigen! Ist es etwa seine Schuld, dass die Steuern zu hoch sind und die Vereine verzweifelt nach Ehrenamtlichen suchen? Wo sollte man da anfangen? Eines aber weiß der Meckerer ganz genau: „Ich sag euch mal ganz ehrlich: Das Ende vom Lied ist, dass ich es wieder für alle anderen ausbaden muss!“ Es müsste aber wirklich mal etwas geschehen, meint der Meckerer.
Trotzdem er selbst keine Belege für eigene Leistungen erbringen, keine Zeugen für seine großen Taten benennen könnte, hat der Meckerer eine hohe Meinung von sich. In diesem Punkt lässt er sich nicht beirren! Der Meckerer, das muss an dieser Stelle erklärt werden, ist geschlechtsneutral. Er kann sowohl männlich als auch weiblich sein. Wir haben ihn lediglich der Einfachheit halber „der Meckerer“ genannt, weil es unserem Gefühl entsprechend phonetisch schöner klingt als „die Meckerin“.
Prahlerisch – ganz so, als habe dies jemals durchaus im Rahmen des Denkbaren gelegen und er habe nur aus Bescheidenheit nicht nach all dem gegriffen, was ihm so geboten wurde und worauf er durchaus Anspruch gehabt hätte – heißt es: „Ich hätte ja auch Bankdirektor werden können.“ Ganz klar und über jeden Zweifel erhaben kann jeder, der gerade Lust darauf hat oder dem zufälligerweise der Sinn danach steht, zum Bankdirektor ernannt werden. Wenn er nur sein Interesse daran bekundet. Wie es der männliche Meckerer offenbar nicht getan hat, aber getan haben könnte. So einfach ist das.
„Ich hätte ja auch einen Arzt oder Anwalt heiraten können“, erzählt dem neidisch staunenden Publikum der weibliche Meckerer. Gab es wirklich zahlreiche Bewerber zur Auswahl, die gern ihr Geld und Ansehen verheiraten wollten, wahllos und ganz zufällig – ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten, ganz ohne Anspruch an jenen weiblichen Meckerer, der sich aus Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit offenbar für die zweite Wahl entschieden und einen minderwertigen Versicherungsvertreter geheiratet hat? Für diesen jedenfalls gibt es tagaus, tagein von den verpassten Chancen seiner Meckerer-Ehefrau zu hören, die niemals müde wird zu erzählen, wie viel besser sie es beim Heiraten hätte treffen können.
Für den Fall, dass irgendwer glauben sollte, diese Angaben grundsätzlich als bloße Behauptungen in Frage stellen zu müssen, steigert sich beim Meckerer sehr leicht die Gereiztheit.
Der Meckerer arbeitet in ordentlicher, aber untergeordneter Position in einem Büro. Weder ist er Bankdirektor geworden, noch hat er einen Anwalt geheiratet. Er ist Bürokaufmann, und er ist sehr froh darüber, dass es in der gleichen Position mehrere Kollegen und Kolleginnen gibt, denn auf diese Art wird nicht nur die Arbeit geteilt. Das besonders Angenehme für den Meckerer ist daran, dass er in der Menge von Kollegen untergehen und damit die Verantwortung teilen kann. Teilen möchte er diese nicht wirklich, sondern lieber anderen komplett zuweisen. Zwangsneurotisch lässt der Meckerer durch die dauernde Lautstärke dessen, was er meint sagen zu müssen, die gesamte Umwelt an der eigenen, niemals als solche wahrgenommenen Bedeutungslosigkeit teilhaben. Das laute Sprechen soll die Wichtigkeit des Gesagten erhöhen. Dem Ende eines jeden Satzes schickt er ein Lachen nach, ohne dass überhaupt etwas des zuvor Gesprochenen andeutungsweise lustig gewesen sein muss. Es ist ein nervöses, falsches Lachen. Mit dem meckrigen, seine eigenen Aussagen bestätigenden Lachen will der Meckerer gefallen und sich gern gesehen machen. Natürlich sind die eigenen Witze die besten, und wenn der Meckerer einen Witz erzählt, lacht er selbst am lautesten darüber, bevor überhaupt ein Zuhörer Gelegenheit gehabt hat, die Pointe zu begreifen. Beim Lachen ist der Meckerer nicht sparsam.
Beflissen, in rechthaberischem, teilweise gar aggressivem Ton geriert sich der Meckerer am Telefon und zeigt allein durch die Tonlage, dass er Ahnung hat: „Ja, ganz richtig. Okay. Genau. Ganz genau.“ Weil er nichts zu sagen hat, verspricht er, sich mal schlau zu machen. Das ist am sichersten, weil er auf diese Weise nicht in Vorkasse treten muss. Mit großer Gewissheit kann der Meckerer annehmen, dass eine Angelegenheit sich oft von selbst erledigt, wenn er dem anderen in Aussicht stellt, sich erst einmal schlau zu machen. Schlau macht er sich dauernd, obwohl er grundsätzlich bereits unvorstellbar schlau ist. Schlau wie ein Fuchs! Gelegentlich gibt er dem Gegenüber ein gutes Gefühl, und zwar mit einem das Gespräch abschließenden: „Super! Alles klar!“ Das signalisiert positive Ermunterung und gegenseitiges Einverständnis. „Stimmt's oder hab ich Recht?,“ fragt meckrig lachend der Meckerer und weiß dabei genau, dass alle anderen im Unrecht sind. Wichtig ist aber, dass er sich selbst so weit wie möglich zurücknimmt, um am Ende mit getroffenen Entscheidungen nichts zu tun zu haben. Das gelingt ihm sehr geschickt. Bis der Meckerer sich schlau gemacht hat, haben längst andere die Entscheidungen getroffen und die damit verknüpfte Verantwortung übernommen – Dinge, die dem Meckerer ein Gräuel sind! Aber kaum dass etwas entschieden wurde, kann der Meckerer wieder kritisieren und erklären, wie er alles besser angefangen hätte, wenn die anderen ihn nur gelassen hätten. Während er sich schlau machte, war die Sache längst von anderen entschieden. „Nicht zum Besten wurde entschieden! Das muss ich noch mal laut und in aller Deutlichkeit und Öffentlichkeit sagen!“, klagt nachträglich der Meckerer. Frech wagt er es zu lügen, indem er hinzufügt: „Aber unsereins wurde ja nicht gefragt.“ Aus Erfahrung weiß der Meckerer, dass niemand dies richtig stellen wird, nachdem das Kind sowieso schon in den Brunnen gefallen ist.
Der Meckerer ist sehr vorsichtig. Sollte es durch ein Versehen von ihm dazu kommen, dass er einen Entschluss fassen und sich zu diesem bekennen muss, beugt er schnell etwaigen Missverständnissen, insbesondere, was potenzielle Schuldzuweisungen betrifft, schon im Vorfeld vor: „Das ist wirklich eine Unverschämtheit! Ehrlich, das Allerletzte! In keinem Fall kann ich die Verantwortung dafür übernehmen! Das geht nicht auf meine Kappe“, stößt er zwischen zusammengepressten Lippen hervor. In empörtem Ton, sein von Panik verzerrtes Gesicht verbergend. Noch ist nichts passiert, aber sicher ist sicher! Sollte einmal etwas nicht zu Gunsten des Meckerers ausgehen, dürfen im Voraus alle bereits zur Kenntnis nehmen, dass doch beim Meckerer – bitte schön! – mit der Schuldsuche gar nicht erst begonnen werden darf.
In der Regel befindet der Meckerer sich in einem Zustand maximaler Unzufriedenheit. Er ist aber nicht bloß unwillig, sondern ebenso wenig im Stande, genau zu erklären, was ihn stört und warum. Es ist eben einfach so. So zieht er es vor, das Gleiche mindestens dreimal konsequent laut zu sagen: „Ich sag einfach mal, das ist so nicht zu machen. ... Ich hab doch gesagt, dass das so nicht zu machen ist. ... Muss ich immer dreimal sagen, dass es einfach nicht zu machen ist?“ Durch konsequente Wiederholung soll dem Gegenüber klar werden, dass es im Unrecht ist und der Meckerer im Recht. Oft hat der Meckerer mit dieser simplen Methode Erfolg.
Die Weltlage, sich für den Meckerer darstellend in dem Mikrokosmos seines kleinen Büros und dem, was darin passiert, ist verständlicherweise kaum auszuhalten. Der Meckerer spricht gern in Superlativen, um das ganze Unglück zu beschreiben. Manchmal ist er so erregt, dass er Superlative erfindet, die es grammatisch gar nicht gibt, zum Beispiel sagt er oft, dass seiner Einschätzung nach stets das „Schlimmstmöglichste“ eintrete. Auch nicht schlimm, wenn er derjenige ist, der etwas zum ersten Mal so beschreibt. Denn so schrecklich wie jetzt ist es gewiss nie gewesen, da müssen neue Superlative her. Es ist am fürchterlichsten, am unerträglichsten, am unglaublichsten, am grauenhaftesten, einfach von quälender Hässlichkeit und Schäbigkeit, überhaupt das Letzte – steigerbar nur noch durch das Allerletzte. So werden beim Austausch ödester Banalitäten vermeintlich schwer wiegende Ereignisse geschaffen. Soll mal bloß keiner denken, das Leben sei leicht!
Anderen nichts gönnen – außer Schaden
Es gibt eine Geschichte über einen Bauern. Da fragt Gott den Bauern, was der sich wünsche. Der Bauer freut sich. Denn Gott verspricht, dass, ganz gleich, was der Wunsch sei: Er soll dem Bauern erfüllt werden. Der Bauer freut sich noch mehr, bis er die eine Bedingung erfährt, die mit der Wunscherfüllung verbunden ist. Egal, was der Bauer sich wünscht: Der Nachbar wird das Doppelte davon bekommen. Also verlangt der Bauer, dass ihm ein Auge ausgestochen werde. Dieser Bauer ist wie der Meckerer. Anderen mag er nichts Gutes gönnen.
Von Zeit zu Zeit aber geschieht es sogar, dass der Meckerer sich ein wenig freuen kann. Das ist in der Regel so, wenn andere einen Schaden erleiden. Schadenfreude ist für ihn die schönste und die einzige echte Freude, die er ausleben kann. Geht etwas für andere schlechter als erwartet aus, genießt es der Meckerer und äußert dies mit der Feststellung, das Ganze „echt zum Piepen“ zu finden. Das können Kleinigkeiten im Büro sein. Zum Beispiel so etwas: Irgendwann gewinnt der Meckerer den Eindruck, dass die Schreibtischlampen im Nebenbüro neuer sind als die in seinem. Das erzeugt beim Meckerer schlechte Laune. Außerdem hat er im angrenzenden Büro auf einem Schreibtisch eine Vase entdeckt und ist nicht sicher, ob diese der Kollegin privat gehört oder ob die Firma die Vase beschafft hat. Er ärgert sich und fragt erst einmal laut seinen Bürokollegen: „Warum haben diese Damen nebenan eine Vase auf dem Tisch? Die sind wirklich immer mit allem Pipapo ausgestattet. Unsereins hingegen hat nicht einmal eine ordentliche Schreibtischlampe!“ Der Meckerer ist neidisch. Obwohl er gar keine Vase im Büro haben möchte und Blumen darin seiner Meinung nach erstens nach zwei Tagen stinken, ihn zweitens stören und drittens von der Arbeit ablenken würden, ärgert es ihn, dass andere mehr haben als er. Wie groß aber ist die Schadenfreude, wenn endlich die Vase herunterfällt. Da liegt sie auf dem Boden. Kaputt. In tausend Scherben. Und diese Damen haben nun keine Vase mehr und dürfen dazu noch den Dreck aufkehren. Solche Momente ausgelebter Missgunst erfüllen den Meckerer. Seine Schadenfreude geht so weit, dass er sich selbst über den Schaden und das Leid von Menschen freuen kann, die er gar nicht kennt. Wenn er in der Zeitung liest, dass ein wegen Steuerhinterziehung gefasster Manager eine Haftstrafe dafür verbüßen muss, freut er sich darüber. „Die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen. So läuft es doch normalerweise“, meint der Meckerer. Umso größer ist deshalb seine Genugtuung, wenn ein „hohes Tier“ gefangen und verurteilt wird. Trotzdem fällt dem Meckerer, kaum dass er sich an der Vorstellung des Schadens des verurteilten Managers gelabt hat, gleich wieder meckernd pessimistisch ein: „Der wird doch sicher nicht mal einen Bruchteil seiner Strafe absitzen müssen.“ Erfährt der Meckerer aus dem Lokalteil der Zeitung, dass am Wochenende in seiner Stadt ein Bürger nachts im Park beraubt und verprügelt worden ist, erfüllt ihn sogar das mit Zufriedenheit. Selbst schuld, wer nachts allein im Park herumläuft, denkt sich der Meckerer. Besoffen war der Typ sicher auch noch. Der Meckerer kennt kein Mitleid außer Selbstmitleid. Auf seine Schadenfreude angesprochen, kann er daran nichts Falsches finden. Er versteht seine Gefühle so, dass er eben über ein ausgeprägteres Gerechtigkeitsempfinden als andere Leute verfügt. Weil er eben besser ist.
Um dazuzugehören und sich nicht auszugrenzen, achtet der Meckerer darauf, wie die meisten sprechen und passt dem, was aktuell sprachlich Mode ist, seine eigene Sprache an. Es kann geschehen, dass er dabei übertreibt, aber das gehört dazu, denn schließlich muss es bei ihm immer mehr sein als bei anderen. Weil die schlechter sind als er. Wenn bei einem Gegenüber, dem der Meckerer gefallen oder das er auf seine Seite ziehen will, in jedem zweiten Satz der Höhepunkt einer Aktion mit „und das Geilste ist ...“ angekündigt wird, dann muss der Meckerer in jedem Satz davon sprechen. Weil er doppelt so gut ist. So erzählt er von einem Nachbarn, dem das Auto gestohlen worden sei, „und das Geilste ist: Er hatte es nicht einmal abgeschlossen. Und jetzt stell dir vor: Das Geilste ist, dass der auch noch geglaubt hat, die Versicherung kommt für den Schaden auf. Das ist wirklich das Allergeilste“, ruft er hämisch und befriedigt. Das Geilste ist, wenn so etwas anderen passiert und der missgünstige Meckerer sich daran erfreuen kann.
Sich immer wieder schlau machen
Am Arbeitsplatz des Meckerers läuft alles nach dem täglich gleichen Prinzip. Er ist froh, wenn es eine Routine gibt, an der er sich orientieren kann. Es ist angenehm, sich an etwas ganz genau zu halten und außerdem leicht, Abweichler festzustellen, die das nicht tun. Und diese natürlich entweder zu kritisieren oder gern beim nächsthöheren Vorgesetzten zu denunzieren. Denn dadurch, dass er merkt, was andere falsch machen, zeigt der Meckerer, dass er etwas richtig macht. Je genauer der Ablauf festgelegt ist, desto besser. Den Ball auffangen, den Ball wieder zurückspielen. Das soll bedeuten: Einer führt die Arbeit fort, erledigt sie nicht komplett, sondern führt sie eben nur fort und lässt den nächsten weitermachen. Mit dem Ballauffangen handhabt der Meckerer es ähnlich wie mit dem Sichschlaumachen. Ungern fängt er den Ball auf, aber manchmal muss es eben sein, weil kein Weg daran vorbeiführt und es unangenehm auffiele, wenn er den Ball einfach fallen ließe. Sehr schnell spielt er den Ball zurück, auf dass dieser – zusammen mit der endgültigen Verantwortung – schnellstmöglich wieder im Feld des anderen liege. Gelegentlich gibt er sich gern überlegen, indem er sich zum einen bereit erklärt, eine Aufgabe zu übernehmen, und zum anderen darauf folgend in aller Bescheidenheit vorgibt, das sei keine große Sache für ihn gewesen. Das heißt dann: „Keine Panik! Sag ich mal!“ Oder ganz lakonisch und überlegen, als sei ein Meckerer ein Freund der großen Taten, aber der großen Worte nicht: „Kein Thema!“ Aber das nur, wenn ganz sicher von vornherein anzunehmen ist, dass alles gut ausgeht. Sonst heißt es sofort, variabel ängstlich-aggressiv bis weinerlich-aggressiv: „Das soll der auf seine Kappe nehmen! Ich meine, das ist nicht mein Bier. Das ist dessen Bier!“ Mein Bier, dein Bier, sein Bier – die Hauptsache bleibt, es ist nicht des Meckerers Angelegenheit.