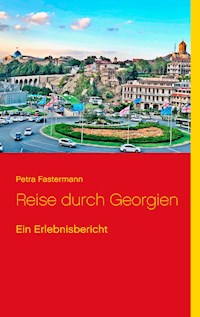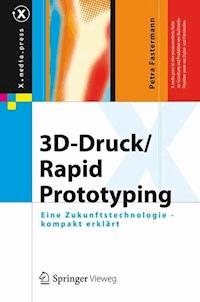Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch macht Angst. Wem? Allen, die heute in der modernen Welt leben und aktiv am Geschehen teilnehmen. Das heißt: Jedem, der nur ein einziges soziales Netzwerk nutzt. Um es genau zu sagen: Man muss nicht einmal an irgendetwas aktiv teilnehmen, denn selbst wer im Koma auf der Intensivstation liegt, wird elektronisch verwaltet und nimmt auf diese Art am Geschehen teil. Angefangen hatte alles damit, dass man auf den sorgsam aufbewahrten, mühevoll aufgenommenen Musik-Kassetten plötzlich nach 20 Jahren beim „Abspielen“ kaum noch etwas hören konnte, obwohl der Kassettenrecorder einwandfrei in Ordnung war. Es geschah in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass alle sich darüber wunderten, wie es sein konnte, dass die schönen Hits aus den Siebzigern wie durch Zauberhand von ihren Kassetten verschwunden waren. Aber was jetzt kommt, hat eine neue Dimension. Nicht bloß für den Einzelnen, sondern für die ganze Welt. Der schleichende Datenverlust geht um. Es droht der große, alles vernichtende Datenverlust. Sein Name: Bitfäule. Ein Horror-Szenario. Aber Martin Saum, ein Bürger mittleren Alters aus Erlangen, der bisher immer unterschätzt wurde, wird dafür sorgen, dass die Welt deshalb nicht untergeht. Nebenbei wird der bis dahin immer als Verlierer geltende Mann auch noch die Frau seines Lebens kennen lernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Worum geht es?
Prolog
Das Leben zieht so dahin und ereignislos vorbei
Silvia Schiller
Hans Gunz
Ankündigung einer Dienstreise
Frankfurt
Erleichterung
Vorfreude auf Rio
Flugzeugabstürze sind selten
Ein Unglück
Rehabilitation
Das Leben der anderen
Zweifel an den Gründen des Absturzes
Das Leben wird für Silvia unerträglich
Nur eine Benefiz-Veranstaltung
Ein Wiedersehen mit dem „guten Gesicht“
Superheld Saum
Martins Verdacht: Die Bitfäule hat den Flugzeugabsturz verursacht
Embedded Systems überall
Martins Entscheidung
Silvia lebt auf
Silvia verzweifelt
Martins restlicher Aufenthalt in Frankfurt
Silvia ist selig
Mutter freut sich – und Martin weiß nicht, ob er sich freuen soll oder nicht
Martin recherchiert zu Flugzeugen
Kurzzeitig erwägt Martin, nach Unterstützung von außen zu suchen
Wie sicher sind Embedded Systems?
Oder doch bei einer Behörde nachfragen?
Silvias erster Besuch in Erlangen
Martin präsentiert seine beeindruckende Fehlersammlung
Martin erstarkt
Ein kleiner Exkurs in die Kulturlosigkeit
Absturz einer Ariane-Rakete
Ein halber Jahresurlaub, sinnvoll verbracht?
Der Bordcomputer
Noch ein Treffen in Erlangen oder doch in Frankfurt?
Ein Frankfurter Kranz für Silvia
Erlangen von seiner schönsten Seite: Martin als begeisterter Stadtführer
Der Plan: Martin baut einen Erkennungsbaustein, der den Fehler finden soll
Wie kommt der Erkennungsbaustein ins Flugzeug?
Gunz versucht sich als Romeo
Gunz blitzt ab
Hans Gunz will Martin und Silvia vernichten
Hausdurchsuchung bei Martin und seiner Mutter in Erlangen
Schafft Silvia es, den Erkennungsbaustein in das Flugzeug einzuschmuggeln?
Flugangst
Angst vor dem Absturz und Rückblick auf das eigene Leben
Gedanken über Martin
Martin hat sich verändert
Ein Erkennungsbaustein geht in die Luft
Martin macht alles möglich
Ende – aber nur für die Beweisaufnahme
Ein neuer Anfang für Martin und Silvia
Silvia zieht nach Erlangen
Martin arbeitet nicht mehr als Programmierer, wird aber beweglicher
Neue Perspektiven
Gunz ist tot
Epilog
Quellen
Zur Autorin
Worum geht es?
Dieses Buch macht Angst. Wem? Allen, die heute in der modernen Welt leben und aktiv am Geschehen teilnehmen. Das heißt: Jedem, der nur ein einziges soziales Netzwerk nutzt. Um es genau zu sagen: Man muss nicht einmal an irgendetwas aktiv teilnehmen, denn selbst wer im Koma auf der Intensivstation liegt, wird elektronisch verwaltet und nimmt auf diese Art am Geschehen teil.
Angefangen hatte alles damit, dass man auf den sorgsam aufbewahrten, mühevoll aufgenommenen Musik-Kassetten plötzlich nach 20 Jahren beim „Abspielen“ kaum noch etwas hören konnte, obwohl der Kassettenrecorder einwandfrei in Ordnung war. Es geschah in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass alle sich darüber wunderten, wie es sein konnte, dass die schönen Hits aus den Siebzigern wie durch Zauberhand von ihren Kassetten verschwunden waren.
Aber was jetzt kommt, hat eine neue Dimension. Nicht bloß für den Einzelnen, sondern für die ganze Welt. Der schleichende Datenverlust geht um. Es droht der große, alles vernichtende Datenverlust. Sein Name: Bitfäule. Ein Horror-Szenario. Aber Martin Saum, ein Bürger mittleren Alters aus Erlangen, der bisher immer unterschätzt wurde, wird dafür sorgen, dass die Welt deshalb nicht untergeht. Nebenbei wird der bis dahin immer als Verlierer geltende Mann auch noch die Frau seines Lebens kennen lernen.
Prolog
Erlangen
Endlich Feierabend, endlich zu Hause, endlich wieder entspannen. Martin hat sich die letzte gelbe Limo aus dem Kühlschrank genommen und sich ein freies Plätzchen am Tisch in der Küche gesucht. Wie gut, dass seine Mutter ab und zu das Leergut wegbringt, wenn auch schimpfend oder latent vorwurfsvoll aussehend, weil Martin „schließlich auch mal was machen kann“, wie sie in unregelmäßigen Abständen findet. Wie üblich, klappt Martin sein Netbook auf und schaut nach den neuesten Nachrichten bei Twitter. Dazu hat er bei der Arbeit meist keine Zeit, außer während der Ferien, wenn nicht ständig das Telefon klingelt. Er liest die Überschrift: „Rätselhafter Börsencrash an der Wall Street“. Das klingt entweder fragwürdig oder ist schlecht recherchiert. Was macht wohl einen Börsencrash „rätselhaft“? Warum sollte es dafür keine Erklärung geben? In der Regel lassen sich ganz schnell die Gründe für einen Börsencrash festmachen. Meist ist irgendeine globale Krise die Ursache dafür, und über die wird vorher ausreichend in den Medien berichtet. Oder eine Heerschar von Analysten hat eine Blase vorausgesehen. An die mindestens gleich große Anzahl von Analysten, die der Meinung war, dass die Entwicklungen nicht auf eine Blase hindeuten, erinnert sich üblicherweise keiner mehr.
New York
Am Donnerstag, dem 6. Mai 2010, beginnt an der Wall Street ein normaler Handelstag. Nichts deutet auf einen turbulenten Tag hin, es werden keine Quartalszahlen von Großunternehmen veröffentlicht. Die gesamtwirtschaftliche Lage ist halbwegs ruhig, die Zahlen der Börsenplätze in Japan und Europa, die schon seit Stunden geöffnet sind, zeigen einen leichten Aufwärtstrend. Es geschieht nichts Außergewöhnliches und niemand hat Grund, große Überraschungen zu erwarten – bis es plötzlich am Abend einen radikalen Kurssturz von 1.000 Punkten gibt. Die erste und unmittelbare Reaktion der Händler ist nichts weiter als ungläubiges Staunen über die Verluste. Den Händlern bleibt vor Schreck der Mund offen stehen, aus dem eigentlich ein alles reinigender, alles richtender Fluch gespuckt werden sollte. Der kurzzeitige Kurssturz ist, in Punkten gemessen, der stärkste in der Geschichte der Wall Street. Jetzt sitzen dort alle nur noch wie gelähmt und schockgefroren herum. Bis endlich Miles Moore, der Cheftrader, sich wieder genügend gefasst hat, um eine Entscheidung zu treffen: Der Handel wird vorerst ausgesetzt. Jetzt müssen die Experten von der Börsenaufsicht ran, um zu sehen, was geschehen ist. Die sollen ermitteln, wie das passieren konnte. Bei der darauffolgenden Untersuchung zeigt sich, dass ein automatisiertes Handelssystem angefangen hat zu verkaufen. Daran gekoppelte Systeme haben wie eine Lawine den Verkaufstrend verstärkt. Sicherheitsmechanismen hat es offenbar nicht gegeben. Der Untersuchungsbericht der Börsenaufsicht spricht später von einem Computerfehler. Die Ursache für den Fehler wird nicht gefunden. Die so genannte „Fat-Finger-Theorie“, dass ein einzelner Trader sich vertippt und damit den vorübergehenden Crash ausgelöst haben könnte, wird ausgeschlossen. Liegt der Grund in der Sorge der Amerikaner wegen der Griechenlandkrise? Kann es sein, dass die Angst von dem drohenden Staatsbankrott Griechenlands den extremen Kursabsturz provoziert hat?
Kurze Zeit geht das Gerücht um, dass ein Händler versehentlich Aktien eines großen Konzerns im Wert von 16 Milliarden statt 16 Millionen Dollar verkauft und damit den zwischenzeitlichen Kurssturz ausgelöst habe.
Innerhalb von Minuten schnellt der Kurs wieder nach oben. Mit der Kursberuhigung schwindet die Angst und bald schon kann sich niemand mehr an die erste Panik erinnern. Aber der Fehler wird nicht gefunden.
Wiederum Erlangen
Martin Saum lebt mit vierzig Jahren immer noch bei seiner lange verwitweten Mutter und ist übergewichtig – oder mit 1 Meter 70 nur zu klein für sein Gewicht, wie er in guten Momenten sagen würde. „Formvollendet aus der Form geraten“, erklärt er dann sogar manchmal selbstironisch. Aber wann gibt es mal einen wirklich guten Moment? Einen Augenblick, in dem er Lust hat, über sich selbst zu lachen? Martin will nicht klagen. Es ist nicht seine Art ist zu jammern. Das Leben ist weder gut noch schlecht, es plätschert bloß ereignislos dahin. Martin hat mehr als genug zu essen und zu trinken und außerdem ein dichtes Dach über dem Kopf. Was er sonst noch will oder braucht, kann er gar nicht genau sagen. Aber um froh zu sein, reicht das allein nicht allein aus, wenn man nicht hungern muss. Martin hat seit zehn Jahren keine Freundin mehr gehabt, was teilweise an ihm selbst, teilweise an der starken Fürsorge seiner Mutter liegt, die ihm nie einen vernünftigen Grund dazu gegeben hat, sich eine eigene Wohnung zu suchen und auszuziehen. In Erlangen ist er geboren und aufgewachsen. Hier kennt er jede Ecke, und er fühlt sich wohl, weil die Stadt überschaubar ist und trotzdem einiges zu bieten hat. Er lebt deshalb keineswegs in der Provinz. Die Stadt hat eine Universität, und Martin hat gelesen, dass über Erlangen wegen seiner Mischung aus akademischem Leben und Internationalität sowie regelmäßigen Veranstaltungen sogar als vom „fränkischen Berkeley“ gesprochen wird. „Fränkisches Berkeley“ – das hört Martin als gebürtiger Erlanger am liebsten. Er greift das immer wieder auf, und wenn er ausnahmsweise mal anderswo ist und danach gefragt wird, wo er wohne, antwortet er nur zu gern: „Ich bin im fränkischen Berkeley geboren, aufgewachsen und dort geblieben“, und lässt die Verblüfften raten, welche Stadt das wohl sein könnte. „Fränkisch“ muss als Tipp ausreichen. An einem anderen Ort als in Erlangen zu wohnen könnte Martin sich nicht vorstellen. Er verreist höchst ungern, weil er eben am liebsten in Erlangen ist. In Erlangen hat er fünf Jahre lang studiert. Wenn er gefragt wird, was für einen Abschluss er hat, antwortet er: „In Erlangen konnte ich keinen akademischen Abschluss erlangen.“ Das ist ein Wortspiel, das Martin Saum selbst witzig findet und so gern weitergibt. Er hofft außerdem, dass er damit seine Erfolglosigkeit ein wenig hinter Humor verstecken kann. Denn im Nachhinein bedauert Martin es ein bisschen, dass er das Studium nicht bis zum Ende durchgehalten hat und ganz sicher einige seiner damaligen Kommilitonen mit weniger Talent als er selbst seit vielen Jahren die unterschiedlichsten Karrieren auf ihren Diplomen aufbauen. Jedenfalls gab es nicht einmal wegen des Studiums einen Grund, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Wenn er doch in Erlangen wohnte, konnte er auch in Erlangen studieren. Weil Martin das Studium nicht abschloss, verschaffte ihm das Amt am Ende eine Weiterbildung zum „Staatlich geprüften Mathematisch-Technischen Assistenten“. Er nennt sich lieber Programmierer, das „staatlich geprüft“ klingt für Martin unvorstellbar öde und wie eine Garantie für bloß mittelmäßige Qualität. Oder auch wie ein Gütesiegel für Lebensmittel, die für den Verbraucher zum unbesorgten Verzehr zugelassen sind. Spannend und attraktiv zumindest nicht, findet Martin. Außerdem findet Martin, dass alles, was mit IT und „staatlich“ zu tun hat, im Keim schon zum Scheitern verurteilt ist.
Geld verdienen auf herkömmliche Art
Tagsüber ist Martin auf Basis des „staatlich geprüft“ mit seinem einigermaßen akzeptablen Vollzeitjob in einem Großunternehmen beschäftigt: Er arbeitet als Programmierer acht oder mehr Stunden – zu einem als überdurchschnittlich geltenden Gehalt. Martin kümmert sich um die Geschäftssoftware von SAP im Unternehmen. Zu jedem neuen Bürokratieprozess, jeder Umstrukturierungswelle, der Übernahme von anderen Firmen oder dem Verkauf von anderen Teilen des Unternehmens muss auch die Software den Gegebenheiten angepasst werden. Wirklich neu sind die Änderungen nicht, denn in ihrer Stetigkeit kommen die alten Strukturen und Prozesse nach einigen Jahren unter neuen Namen zurück. So hat Martin einige Routine entwickelt und muss sich nicht übermäßig bemühen. Einen Betriebsrat gibt es in der Firma auch, so dass Überstunden nicht willkürlich sein dürfen, sondern genehmigt werden müssen. Und außerdem bezahlt werden. Wo Martin arbeitet, wird niemand ausgepresst wie eine Zitrone, bei der früher oder später die Kerne quietschen. Trotzdem geben sich viele Kollegen als Überflieger und finden kein Ende damit zu prahlen, wie sie ständig „unter Wasser“ sind. „Von euch arbeitet sich hier wohl keiner tot“, erklärt Martin gern mal den Angebern, wenn sie ihm mit ihrer hektischen Wichtigtuerei zu sehr auf die Nerven gehen. Martin sieht nicht ein, sich von denen anstecken und künstlich aus der Ruhe bringen zu lassen. Denn „stressig“ findet er bei seinem Job weniger sein „Workload“ als die Kollegen, die sich mit ihrem vermeintlichen Dauerstress profilieren möchten. Über seine Arbeit will Martin nicht klagen. Sie macht ihm keinen Spaß, stört ihn aber nicht weiter. Irgendwas machen muss jeder, der darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen. Es gibt aber dennoch Tage, an denen Martin fürchtet, dass er sich bei der Arbeit vollkommen zu Tode langweilen wird. Da hilft es ihm manchmal nur, einen Schokoladenriegel auszupacken und schnell zu essen, um sich damit kurzzeitig die Laune zu heben. Es gibt Arbeitstage, an denen Martin angestrengt darauf achtet, dass er am Schreibtisch nicht im Sitzen einschläft. Besonders in den Schulferien besteht die Gefahr, denn das ist eine Zeit, zu der viel seltener als sonst das Telefon klingelt. Obwohl es in dieser Zeit viele Softwareanpassungen geben müsste, da im Konzern zum Ende des Geschäftsjahrs eine Vielzahl der üblichen Veränderungen anstehen. Allerdings brauchen die unzähligen „Entscheider“ mit ihren Entscheidungen immer so lange, dass mit den Anpassungen meist erst im November begonnen werden kann. Sobald er nach Hause kommt, muss er sich sofort an seinen Computer setzen und ein kompliziertes Problem lösen, um sich selbst zu versichern, dass sein Gehirn noch nicht eingetrocknet ist. Martin hat eine ganze Reihe von schwierigen Problemen für solche Fälle vorbereitet, damit er sich ohne Zeitverzögerung damit beschäftigen kann, nachdem er im Büro wieder einen besonders öden Tag verbracht hat. Gern tüftelt er an komplizierten kryptografischen Problemen, die er sich in der Universitätsbibliothek aus mathematischen Periodika kopiert. Nicht, dass er tatsächlich Bedarf daran hätte, Informationen unentschlüsselbar zu versenden – an wen auch? – aber insgeheim hofft er doch, durch das Aufdecken einer Schwachstelle in der Verschlüsselung einen gewissen Ruhm zu erlangen.
Sich beim Geldverdienen von penetranten Kollegen nerven lassen
Darauf, dass andere ihm sagen, was er machen soll – und vor allem, wann und wie – hat Martin gar keine Lust. Um selbst etwas zu machen, womit er Geld verdient, damit er nicht mehr Angestellter sein muss, ist er zu phlegmatisch.
So ist Martin bei seiner Arbeit unterfordert und intellektuell unausgelastet. Aber das lässt er sich nicht anmerken, damit die anderen ihn in Ruhe lassen. Er hat keine Ambitionen, seine Lage zu ändern. Er kann viel mehr und könnte weit mehr leisten, als die Kollegen ihm zutrauen. Natürlich traut ihm bei der Arbeit keiner etwas zu, weil alle in ihm nichts weiter als einen mittelalten, recht gemütlichen Mann sehen, der mit vierzig Jahren noch bei seiner Mutter lebt. Gelegentlich meint einer der Kollegen, darüber einen Witz machen zu müssen oder eine Kollegin fragt vorgetäuscht mitfühlend: „Sag’ mal, Martin, willst du dich nicht endlich mal nach einer eigenen Wohnung umsehen? Stört dich das nicht, dich von seiner Mutter immer noch versorgen und bevormunden zu lassen?“ Untereinander überbieten sich die Kollegen hinter Martins Rücken mit Spekulationen darüber, wie dessen Zusammenleben mit seiner Mutter „in der Praxis“ wohl funktioniert. Sie sind davon überzeugt, dass es strenge Regeln und Rituale gibt und dass Martin unter der Fuchtel seiner Mutter steht. Wenn Martin nach der Arbeit darauf verzichtet, mit den Kollegen ein „After-Work-Bier“ zu trinken, wird regelmäßig die gleiche lustige Frage gestellt: „Musst du zu Hause sein, bevor es dunkel wird?“ Daran hat Martin sich längst gewöhnt, so dass er die dumme Anmache so lange ignoriert, bis den meisten der Spaß daran vergeht, weil er keine Lust hat, ihr Opfer zu sein. Der Kollege Uwe Steinert, den mit Martin neben dem Übergewicht ein nicht abgeschlossenes Studium verbindet, versucht es trotzdem immer wieder, um damit von seinen eigenen Mängeln abzulenken. Er hält sich für Martin stark überlegen, weil er selbst nicht mit seiner Mutter, sondern seiner Freundin zusammen wohnt. „Der Martin Saum lässt sich bestimmt von seiner Mutter abends im Schlafanzug ins Bett bringen. Vielleicht liest die dem sogar noch Gute-Nacht-Geschichten vor? Mensch, der lässt sich sicher von seiner Mutter morgens vor der Arbeit noch die Schuhe zubinden.“ Letzteres hat Martin einmal mitgehört und sich schwer darüber geärgert. Mit Blick auf den fetten Uwe hat Martin schlagfertig geantwortet: „Ah, ich denke, du sprichst aus Erfahrung, weil du selbst kaum über den eigenen Bauch hinaus sehen kannst und deine Freundin dir die Schuhe zubinden muss? Versuch’ es mal mit Klettverschluss-Schuhen, wie ich sie trage. Dann ist man beim Anziehen nicht auf fremde Hilfe angewiesen.“ Eins zu null für Martin an dem Tag. Damit hatte er die Lacher auf seiner Seite, der Uwe hatte dem guten Rat außer einem roten Kopf nichts entgegenzusetzen – und das Beste war, dass Martin zufällig tatsächlich Schuhe mit Klettverschluss trug. Und die folgenden Tage danach auch noch, weil er davon ausgehen musste, dass ihm, solange der Witz nicht vergessen war, im Büro ständig auf die Schuhe geschaut würde. Klar ist, dass Uwe Steinert seine Niederlage nicht vergessen hat und rachsüchtig auf seine nächste Gelegenheit wartet, Martin vor den anderen lächerlich zu machen.
Sich mit der Nerverei abzufinden versuchen
Martin versucht sich einzureden, dass es ihm egal ist, was seine Kollegen über ihn denken. Oft täuscht er große Lustigkeit vor, damit ihm keiner zu nahe zu treten wagt. Er lässt es nicht zu, dass ihn jemand vorführt. Wer Martin gut kennt, weiß, dass er in der Regel das letzte Wort hat, wenn er will. Die meisten aber interessieren sich nicht für ihn und halten Martin deshalb für einen lahmen, wortkargen Dicken, der im Kopf so träge sein muss, wie es sein viel zu schwerer schwerfälliger Körper vermuten lässt. So wird er von seinen Mitmenschen – mit Ausnahme seiner Mutter – meist stark unterschätzt. Von seiner Mutter fühlt er sich nicht bevormundet. Und was hätte er davon, wenn die Kollegen ihn achten und schätzen würden? Dass er von einem der jüngeren dazu eingeladen wird, nach der Arbeit zum Schwitzen in die Muskelbude, von einem der älteren zum Trinken und Grölen auf den Fußballplatz zu gehen? Wozu das? Das ist ihm zu langweilig. Es reicht ihm schon völlig aus, wenn er zufällig Ohrenzeuge der Unterhaltungen darüber wird, wer wieder wie viele Stunden seiner Lebenszeit damit verbracht hat, „Bauch“, „Beine“ oder „Bizeps“ im Fitnesscenter zu trainieren. Noch weniger unterhaltsam scheint Martin die sich daran anschließende Fachsimpelei dazu, welche Reihenfolge bei der Stär kung von Bauch Beine Bizeps die geeignetste sei, um den Gesamtmuskelaufbau am effizientesten zu fördern. Martin hat sich fest vorgenommen, dass er nicht so schnell restlos verblöden möchte. Er ist sich auch sicher, dass „Spinning“ sich auf den Geisteszustand der „Workouter“ beziehen muss, insbesondere, wenn diese in der zweiten Hälfte der Arbeitswoche ihre vermeintlichen Leistungen durch leere Worthülsen in ständigen Telefonkonferenzen ins Hysterische steigern und zum Feierabend „dringend mal eine Runde ‚spinnen’ müssen“. Wenn er das zu regelmäßig hört, erzeugt es bei Martin oft nichts weiter als ein Gefühl gereizter Beklemmung.
Sich auch noch auf Wochenend-Veranstaltungen der Firma einlassen
Auf Einladungen zum Wochenend-Grillen beim Abteilungsleiter, die eine Art Teambuilding-Atmosphäre schaffen sollen, hat Martin so gar keine Lust. Die meisten Kollegen denken, der Grund dafür sei, dass er keine Freundin hat, die er mitbringen könnte. Oder weil seine Mutter vielleicht besser kocht. Aber tatsächlich ist es ihm nur zu öde, in seiner Freizeit mit den Kollegen, die Karriere machen wollen, über die Arbeit zu sprechen oder über die 1.000 ganz legalen Steuertricks eines Herrn Konz zu diskutieren. Und was Martin als noch nervender kaum ertragen kann: sich von deren Ehefrauen die langweiligen Geschichten vom Pflegepony der Tochter anzuhören, die er genauso wenig kennen lernen möchte wie das Pflegepony. Jede Kommunikation mit „Siri“ auf seinem iPhone ist für Martin spannender und hat einen höheren Unterhaltungswert als solche Gespräche. Einmal hat Martin sich auf einer dieser Grill-Veranstaltungen durch das Gerede der Kollegen so genervt gefühlt, dass er – für alle offensichtlich – laut mit seinem iPhone gesprochen hat. Zum Zeitvertreib hat er „Siri“ nach dem Wetter gefragt oder nach interessanten Orten in der Umgebung zu seinem Standort – dem Garten des Chefs. Als daraufhin die Stimmung kippte und einige beleidigt waren, allen voran der Gastgeber, hat Martin nur, sich selbst aufs Äußerste verleugnend, zusammen mit „Siri“ durch einen Scherz die Stimmung retten können. Zum Glück hatte Martin den Scherz noch aus einem früheren Test parat. Er sprach in sein iPhone: „Bin ich zu dick?“, worauf „Siris“ Computerstimme freundlich die von ihm erwartete Antwort „Kein Kommentar“ gab. Alles grölte. So einfach ist es, die Leute zu belustigen. Von denen wäre wohl nie einer auf die unermesslich kreative Idee gekommen, seinem iPhone eine solche Frage zu stellen. Aber wenn doch? Martin weiß genau, dass zumindest seine „Siri“ auch für Lackaffen mit gegelten Haaren oder roten Hosen auf Problemstellungen wie „Sehe ich gut aus?“ oder „Bin ich toll?“ nicht entgegenkommender reagieren würde. Selbst die bekämen auf ihre eitlen Fragen von Siri ein: „Das kann ich wirklich nicht sagen“ oder „Das würde ich lieber nicht beantworten“.
Na ja, da ging es noch einmal gut. Aber Martin hat keinen Spaß an diesen Events im Abteilungsleiter-Garten in Bubenreuth, ebenso wenig wie an den gemeinsamen Freizeitaktivitäten der Kollegen im Kletterwald in Pottenstein oder auf der Kartbahn Nürnberg. Er hat bereits fest beschlossen, sich für nichts davon zu interessieren. Am liebsten tut Martin dann das, was ihm schon von seinen Lehrern in der Grundschule vorgeworfen worden ist: seine Ohren „auf Durchzug stellen“. Dämlich genug, die Redensart, aber Martin gefällt das trotzdem, weil er sich vorstellt, dass er seine Ohren darauf selbst programmiert hat. Aus reinem Selbstschutz auf Durchzug programmiert. Nichts kann vernünftiger sein als das.
Von seinen Kolleginnen spricht ihn bei diesen Gettogethers keine an, um nicht in der darauf folgenden Woche von den anderen wegen eines vermeintlichen Flirts mit ihm verspottet zu werden. So schließt sich Martin freiwillig und gern von allem aus. Selbst am Wochenende. Außerdem kocht seine Mutter Besseres als das verkohlte Zeug, das der Abteilungsleiter nach endloser Wartezeit von seinem Grill zieht. Wenn der Verzehr mitgebrachter Speisen bei den Chef-Festen nicht zu unhöflich wäre, würde Martin sich lieber von Mutter etwas zum Essen dafür einpacken lassen. Der Abteilungsleiter kann nicht richtig grillen, obwohl seinem Bruder eine ganze Wurstfabrik gehört. Auch das ist Martin verdächtig, und er führt die regelmäßig stattfindenden Grillveranstaltungen darauf zurück, dass dauernd im Überfluss vom Chef-Bruder geschenktes abgelaufenes Fleisch unter die Leute gebracht werden muss. Zum Wegwerfen zu schade, aber für die Mitarbeiter zum Verzehr noch lange gut genug. Natürlich wird von den opportunistischen Kollegen, allen voran Uwe Steinert, der sich eine Wurst nach der anderen reinstopft, die Qualität des Grillguts jedes Mal überschwänglich gelobt: „So’n Bruder mit Wurstfabrik hätte ich auch gerne, kannst du mir den nicht mal ausleihen?“ ist eine der üblichen Formulierungen. „Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul“, hat irgendeiner sogar noch dümmlich gesagt, als Martin ihn diskret auf eine Packung Fleisch mit längst abgelaufenem Haltbarkeitsdatum aufmerksam machte. Martin hofft dagegen nur, dass das Grillgut zwischenzeitlich tiefgefroren war. Als eine sich hochkultiviert gebende Schleimerin den Abteilungsleiter-Garten als „einen kleinen Garten Eden“ beziehungsweise mit fettem englischen Akzent als „eine kleine Garden Ihden“ pries, erstickte Martin fast vor unterdrücktem Lachen an der Wurst, die er aus Höflichkeit verspeiste. Martin führte die absurde Bemerkung darauf zurück, dass diese Übersetzerin Tracy Miller in der Firma nur einen befristeten Vertrag haben musste und auf eine Verlängerung hoffte. Was die Leute sich alles einfallen lassen, um irgendwie anzukommen. Da hat es ihm endgültig gereicht.
Das Leben zieht so dahin und ereignislos vorbei
Erst nach Feierabend wird es angenehm
Nach der Arbeit geht Martin nach Hause und schaltet den Computer ein. Der steht auf dem Schreibtisch in seinem alten Kinderzimmer, in dem er nicht viel verändert hat. Was er an Möbeln besitzt, reicht ihm aus und kann seinetwegen so bleiben. Es genügt ihm, alle paar Jahre die Matratze für sein Bett auszuwechseln – genau dann, wenn sie durchgelegen ist. Seine Mutter kümmert sich um die neue Bettwäsche. Meist gibt es neue, wenn Lidl, Aldi oder Penny ein Sonderangebot mit abstrakten Mustern haben. Martin stört das nicht, denn beim Schlafen hat man ja die Augen zu.
Martin sammelt Datenspeichergeräte. Das hat sich zu einer kleinen Leidenschaft von ihm entwickelt. Seien dies Kassettenrekorder, die Datasette von seinem ersten C64-Heimcomputer oder Diskettenlaufwerke in unterschiedlichen Größen – von 8 Zoll bis 3 Zoll, einer von Amstrad verwendeten Größe. Besonders stolz ist er auf seinen Sinclair Spektrum mit Microdrive, einer kleinen Kassette mit einem Endlosband, das die aufgezeichneten Daten nur sehr widerwillig preisgibt. Gleichzeitig ist die Ausrüstung für seinen aktuellen Computer immer umfangreicher geworden. Sein Computer-Equipment ist auf dem neuesten Stand: Große Solid-State-Disk statt einer Magnet-Festplatte, Surround-Kopfhörer, eine wassergekühlte Grafikkarte, kalibrierbarer Monitor. Das gehört zu den wenigen Dingen, die ihm wichtig sind und für die er gern Geld ausgibt. Meist sitzt Martin bis spät in die Nacht vor seinem Computer. Mutter bringt ihm einen zweiten Abend-Snack und ein Gute-Nacht-Bier, bevor sie schlafen geht. „Martin, hier ist noch was für dich. Mach’ aber nicht mehr so lang, du musst doch morgen wieder zur Arbeit. Nacht.“ Sie redet nicht viel. Das macht sie so angenehm, denn Martin kann Leute, die dauernd etwas erzählen wollen, nicht ausstehen. Mutter ist Ende sechzig und noch gut in Schuss. Aber sie erlebt nicht mehr viel. Dennoch könnte sie dauernd aus den guten alten Zeiten erzählen, aber damit verschont sie den Sohn. So gut waren die alten Zeiten gar nicht, aber da hängen die guten Erlebnisse dran. Andere Menschen interessierten sich für sie, die Sorgen und Enttäuschungen des Lebens hatten sich noch nicht tief in die Seele gegraben.
Überhaupt kümmert Mutter sich wie ein schweigender Schatten um alles. Das hat sie schon immer getan. Monika Saum ist eine ruhige Frau. Sie hängt an ihrem Sohn, aber klebt nicht penetrant. Sie macht ihm andere Frauen nicht mies. An ihr liegt es also nicht, dass Martin Saum keine Freundin hat und nicht auszieht. Wenn es nach ihr geht, kann der Sohn bleiben oder gehen. Sie kommt allein zurecht, kümmert sich aber gern um alles. Sie hat immer schon Martins Leben organisiert, obwohl sie außerdem gearbeitet hat. Seit sie Rentnerin ist, hat sie Zeit, es ihm noch angenehmer als zuvor zu machen. Rund um die Uhr. Mutter Saum ist bescheiden und bedürfnislos. Noch mehr als ihr Sohn, der ebenfalls keine hohen Ansprüche hat. Mutter Saum ist für Martin immer eine Art Kumpel gewesen, der sich ein bisschen ausnutzen lässt. Der stets mehr gibt, als er zurückbekommt. Solche soll es geben. Zusammen kommen die zwei deshalb sehr gut zurecht.
Fast das Einzige, womit Mutter Saum ihrem Sohn auf die Nerven gehen kann, ist ihr Spaß an Gesellschaftsspielen. Für Martin ist es in Ordnung, wenn Mutter eine Freundin oder zwei einlädt und die Frauen im Wohnzimmer zusammen Schafskopf spielen. Aber es ergreift ihn eine geradezu unendliche Unlust, wenn Doppelkopf gespielt wird und er mitmachen muss, weil eine vierte Person für das Spiel benötigt wird. Natürlich hat Martin nicht das Herz, seiner Mutter den Spaß zu verderben. Für den vierten Mann, der bei dem Spiel gebraucht wird, muss es als Belohnung für den Einsatz an einem solchen Abend aber mindestens vier Flaschen Bier geben. Allzu oft geschieht das allerdings nicht, dass Martin beim Spieleabend dabei sein muss. Diese Abende, so meint Martin, seien „keineswegs vergnügungssteuerpflichtig“. Spätestens wenn es etwas zu essen gibt und eine von Mutters langjährigen Freundinnen unweigerlich wieder einmal die Geschichte vom kleinen Martin erzählt, der beim gemeinsamen Omelette-Essen als Fünfjähriger die Sorge hatte, dass in der Eierspeise giftige „fliegende Pilze“ enthalten sein könnten, sinkt Martins Laune endgültig unter den Gefrierpunkt.
Sich zu Hause mit der Hausautomatisierung interessant beschäftigen
Wenn Martin von seiner Arbeit nach Hause kommt, kann er sich jedoch in der Regel ausschließlich seinen privaten Forschungen widmen. Das ist es, wodurch ihm das Leben gelegentlich sinnvoll erscheint. Viel Zeit verbringt er damit, die Hausautomatisierung, die er zu seinem eigenen Vergnügen und – anfänglich – zum großen Unverständnis seiner Mutter eingerichtet hat, zu optimieren. Immerhin ist es ihm inzwischen gelungen, Mutter vom grundsätzlichen Nutzen einer Hausautomatisierung zu überzeugen. Dass einiges einfacher und vieles sicherer wird, hat als Argument ausgereicht, um sie doch ein bisschen dafür zu begeistern. So lässt sich jetzt zentral von allen Räumen aus das Licht ein- und ausschalten sowie die Temperatur steuern. Beim Verlassen der Wohnung kann Mutter am Display sehen, ob irgendwo versehentlich noch ein Fenster offen ist. Martin freut sich, wenn seine Mutter Teile der Haussteuerung gelegentlichem Besuch halb souverän vorstellen kann. Dann ist er manchmal geradezu stolz auf sie.
Trotzdem fragt sich Mutter Saum oft verständnislos, warum ihr Sohn Gefallen daran findet, endlose Stunden damit zu verbringen, Lichtschalter zu hacken. Gelingt ihm das, verschafft ihm ein gehackter Lichtschalter ein regelrechtes Glücksgefühl, wenn auch nur vorübergehend. Besonders praktisch und erfreulich findet Martin an seiner Hausautomatisierung, dass er damit seiner Mutter von seinem Kinderzimmer aus das Licht im Wohnzimmer ein- und ausschalten kann. Das ist ein verabredetes Zeichen dafür, um ihr mitzuteilen, dass er gerade an sie denkt und nichts dagegen hätte, wenn sie ihm ein Bier oder ein Wurstbrot brächte.
Open-Source-Software programmieren
Außerdem beschäftigt Martin sich mit der Programmierung von Open-Source-Software, weil er eigentlich gern teilt und außerdem unterbewusst an eine bessere Welt glaubt. Das will er sich selbst jedoch nicht eingestehen. Denn Gutmenschen nerven ihn nur, und er will auf keinen Fall einer von denen sein. Ebenso würde sich Martin streng dagegen wehren, als „Nerd“ bezeichnet zu werden. Noch mehr ärgert ihn die seiner Einschätzung nach gesteigert dumme Bezeichnung „Computerfreak“, aber so etwas würde wohl nur seine Tante über ihn sagen. Mögen manche vielleicht „Nerd“ und „Computerfreak“ auch für Ehrentitel halten. Martin sieht sich als Angestellter im festen Beschäftigungsverhältnis, der bei seiner Mutter wohnt. Das Alltägliche ist für ihn das Normale. Alltag ist, dass Martin bei seiner Mutter wohnt. So ist es für ihn normal. Da ist es ihm gleichgültig, wenn die Leute über ihn als „Muttersöhnchen“ reden. Völlig gleichgültig. Man kann es eben nicht immer allen recht machen. Wozu auch, und was hätte er denn davon?
Wenn Kollegen aus Neugier oder um ihn nach eigener Einschätzung „aus der Reserve zu locken“ Martin fragen, was er denn so in seiner Freizeit ohne Freundin „treibe“, erklärt Martin: „Ich gehe Flaschen sammeln, um damit mein Gehalt aufzubessern.“ Mit dieser Auskunft erstickt er meist jede weitere Nachfrage im Keim. Gut so!
Tierfilme im Fernsehen anschauen
Was ihn wirklich interessiert und womit er sich beschäftigt, würde er denen sowieso nicht sagen wollen. Martin ist auch sicher, dass sie es gar nicht wissen möchten.
Martin sieht zum Beispiel gern fern. Zu seiner Entspannung schaut er am liebsten Tierfilme. Bei denen gibt es meist keine aufgeregte Handlung zu verfolgen, wenn nicht gerade gezeigt wird, wie ein Löwe ein Gnu reißt. Bei so etwas schaltet Martin um, weil er das nicht leiden kann. Die Filmmusik gefällt ihm bei den Tierfilmen meist besonders gut, denn sie unterstützt die Empathie mit den gezeigten Geschöpfen viel besser als in einem Spielfilm, findet Martin. Zum Zeitvertreib und aus Spaß zeichnet Martin manchmal mit seinem Computer Tierfilme auf. Nachträglich trennt er aufwendig mit einer von ihm verbesserten Software Musik und Kommentar des Films voneinander, um sich später den Film nur mit der Musik noch einmal separat anzusehen. Der Spaß und das Spiel daran sind, dass er versucht, sich den entsprechenden Kommentar zur Szene wieder in Erinnerung zu rufen: Eine Gnu-Herde sucht nach frischem Futter, ein Pferdepaar pflanzt sich fort.
Regelmäßig „Aktenzeichen XY“ schauen, um vielleicht helfen zu können
Außerdem sieht Martin regelmäßig „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ wegen der seiner Ansicht nach gut gemachten Kurzfilme. Den „Tatort“ oder ähnliche Kriminalserien mag er weniger, weil ihm die Szenen zu erfunden scheinen und er den ganzen Kult, der darum gemacht wird, deshalb nicht verstehen kann. Trotzdem schaut er recht oft den „Tatort“ und passt bei jeder Sendung genau darauf auf, ob Fehler gemacht werden, welche ein richtiger Polizeikommissar oder ein richtiger Staatsanwalt nicht machen würden. Wenn bei der Arbeit am Montag in der Kantine die Kollegen begeistert den „Tatort“ des Vorabends besprechen, dämpft Martin regelmäßig