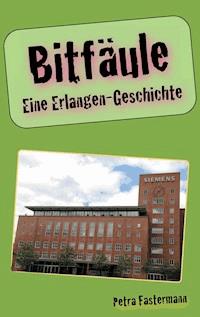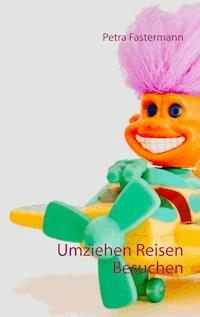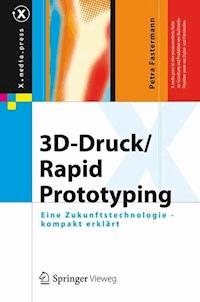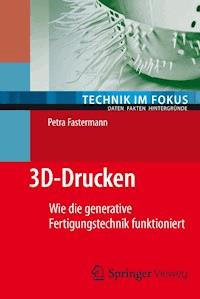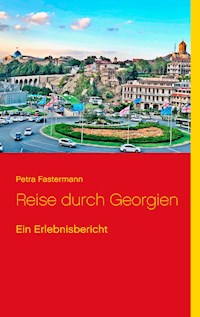
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Dies ist ein Buch über eine Rundreise durch Georgien im Sommer 2019. Es werden Besuche der größeren Städte des Landes, wie zum Beispiel Tbilissi, Batumi und Kutaissi, beschrieben. Auf der Rundreise gibt es aber auch über kleinere Orte viel zu erfahren. Das Buch erscheint 2020 während der Corona-Krise - während gerade kaum jemand vom Reisen nur zu träumen wagt. Der kleine Bericht wird in der Zuversicht herausgegeben, dass das Reisen bald wieder möglich sein wird. Georgien ist ein attraktives Reiseland mit freundlichen Menschen und schönen Landschaften. Wer die Möglichkeit hat, sollte es besuchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Dieses Buch ist ein Erlebnisbericht und kein Reiseführer. Es gibt verschiedene Reiseführer zu Georgien, die regelmäßig aktualisiert werden, denn das kleine Land ist als touristisches Reiseziel in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Deutsche Besucher machen derzeit neben Russen, Türken und Arabern einen großen Teil der Touristen aus. Im Jahr 2019 benötigten deutsche Staatsangehörige zur Einreise nach Georgien und für den Aufenthalt von bis zu 360 Tagen kein Visum. Das Auswärtige Amt weist aber auf seiner Internetseite mit Informationen zu Georgien darauf hin, dass sich die Einreisebestimmungen kurzfristig ändern können. Für unseren Urlaub hat der gültige deutsche Reisepass gereicht, als wir im August/September 2019 rund 2.200 Kilometer mit dem Auto durch das Land reisen wollten. Gefahren hat uns beide ein Georgier, der gleichzeitig unser Guide und Übersetzer war.
Auch mit dem Zug sind wir eine lange und eine kurze Strecke gereist, einmal in der 1. und einmal in der 2. Klasse, einmal mit einem Fernzug und einmal mit einer Regionalbahn. So haben wir in zwei Wochen viel gesehen. Ich habe hier nur aufgeschrieben, was ich interessant fand.
Allem vorangeschickt: Ich würde eine Reise nach Georgien als sicheres Land mit freundlichen Bewohnern, schöner Landschaft und dazu noch günstigen Preisen sehr empfehlen.
Zur Schreibung der Städtenamen habe ich eine Anmerkung: Die Orte werden in Georgien auf Georgisch und in der georgischen Schrift geschrieben, welche eine eigene Schrift ist und mit der lateinischen nichts gemein hat. So müssen aus dieser Schrift die Ortsnamen in die lateinische Schrift transkribiert werden. In der Regel findet man in Georgien neben den georgischen Schildern die Transkription der Namen ins Englische. Selbst in deutschen Texten und Reiseführern findet sich manchmal die englische, machmal die deutsche Transkription. Ich versuche, durchgehend die deutsche Schreibweise der georgischen Namen zu benutzen - das heißt also die, welche ich in der deutschen Wikipedia gefunden habe und welche ich deshalb für die richtige Transkription ins Deutsche hielt.
Inhaltsverzeichnis
Etwas Lesen vor der Reise nach Georgien
Sehr wenig Vorwissen zu Georgien
Die Reise
29.08., Donnerstag
30.08., Freitag
31.08., Samstag
01.09., Sonntag
02.09., Montag
03.09., Dienstag
04.09., Mittwoch
05.09., Donnerstag
06.09., Freitag
07.09., Samstag
08.09., Sonntag
09.09., Montag
10.09., Dienstag
11.09., Mittwoch
Fazit
Etwas Lesen vor der Reise nach Georgien
Im März 1946 war Winston Churchill als britischer Premierminister bereits abgewählt, so dass er seine Rede „The Sinews of Peace“ (deutsch etwa: „Die Kräfte des Friedens“) als Oppositionsführer hielt. In dieser Rede in den USA erklärte er, dass sich auf Ost- und Mitteleuropa ein „Eiserner Vorhang“ herabgesenkt habe. Dieser Eiserne Vorhang war der Auftakt zum Kalten Krieg, und es sollte mehrere Jahrzehnte dauern, bis der Vorhang wieder gehoben wurde. Im Jahr 1947 bereisten der Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger John Steinbeck und der Fotograf Robert Capa die abgeschottete Sowjetunion. Ihr Ziel war es, eine Reportage über den Alltag der Sowjets, das normale Leben der Bevölkerung in der gerade vom Krieg zerstörten Sowjetunion zu verfassen. Ein Jahr später veröffentlichten Steinbeck und Capa die literarische Reisereportage „A Russian Journal“, welche in deutscher Übersetzung unter dem Titel „Russische Reise“ erstaunlicherweise erstmals 2011 verlegt wurde. Der Schriftsteller Steinbeck bemühte sich darum, einen möglichst authentischen Eindruck des Lebens der Menschen zu vermitteln. Der Fotograf Capa versuchte, auf Bildern den Alltag der Bevölkerung festzuhalten. Diese Fotos sollten unspektakulär und ungeschönt sein. Trotz Beginn des Kalten Kriegs gelang es Capa, ohne erkennbare propagandistische Absicht die durchschnittlichen Menschen beim Arbeiten, Feiern oder Ausruhen zu zeigen.
Schon 1947 erlebte der Schriftsteller Steinbeck, dass überall in der Sowjetunion von Georgien mit großer Sehnsucht und Bewunderung gesprochen wurde - auch von Bürgern, die nie dort gewesen waren und vielleicht auch niemals nach Georgien kommen würden: „They spoke of Georgians as supermen, as great drinkers, great dancers, great musicians, great workers and lovers. And they spoke of the country in the Caucasus and around the Black Sea as a kind of second heaven. Indeed, we began to believe that most Russians hope that if they live very good and virtuous lives, they will go not to heaven, but to Georgia, when they die.“ (aus: Steinbeck/Capa, A Russian Journal, Seite 144)
Bis Georgien waren die Deutschen nach ihrem Überfall 1941 auf die Sowjetunion nicht gekommen. So war die georgische Sowjetrepublik im Zweiten Weltkrieg unzerstört geblieben, und die georgische Bevölkerung war nicht Kampfhandlungen ausgesetzt gewesen wie die Bevölkerung in anderen Teilen der Sowjetunion. Obwohl es in Georgien im Zweiten Weltkrieg keine Kampfhandlungen gab, war auch Georgien in hohem Maß daran beteiligt, zum Sieg der Sowjetunion beizutragen: 700.000 Georgier wurden als Soldaten in den Krieg geschickt und viele davon verwundet oder getötet. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Gesamtbevölkerung Georgiens zu der Zeit gerade einmal 3,5 Millionen betrug (Quelle dieser Angabe: Reiseführer Georgien. Unterwegs zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer). Verwundete Soldaten kamen in Lazarette, die auch in Georgien entstanden waren. Die georgische Wirtschaft - wie der gesamte Rest der Sowjetunion - produzierte für den Krieg, so dass die Bevölkerung unter dem sich daraus ergebenden Mangel leiden musste. Der spätere Nobelpreisträger John Steinbeck berichtet trotz allem schon in seiner Reportage von 1947 von der überschwänglichen Gastfreundschaft der Georgier. Von der Gastlichkeit und den reichlich gedeckten Festtafeln ist bis heute in fast allen Reiseführern über Georgien zu lesen. Der Gast werde als ein Geschenk Gottes betrachtet, und wenn der Gast einkehre, sei das der Beweis, dass Gott den Gastgeber nicht vergessen habe.
Weil ich mich allgemein für Literatur interessiere und gern Bücher lese, habe ich mir vor Reisebeginn ein paar Bücher georgischer Autoren gesucht, um die Vorfreude auf den Urlaub zu steigern. Es interessieren mich beim entspannten Lesen jedoch viel weniger Sachbücher als Belletristik. So habe ich drei Romane gelesen, und mehr als ein wenig zu lesen für die Reise nicht vorbereitet.
Erst im Jahr 2018 war Georgien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Während der Zeit, in der Georgien zur Sowjetunion gehörte, wurde nur sehr wenig georgische Literatur ins Deutsche übersetzt. Obwohl ich mich viel mit Belletristik befasse, konnte ich mich nicht daran erinnern, einmal bewusst ein Buch eines georgischen Autors gelesen zu haben - oder auch nur eine Geschichte, die in Georgien spielte. Als wir relativ kurzfristig beschlossen, nach Georgien zu reisen, wollte ich das schnell nachholen. Wenigstens drei Bücher wollte ich lesen, um mir zumindest einen oberflächlichen und subjektiven Eindruck von georgischer Literatur zu verschaffen. Beim Suchen nach Büchern - ganz ohne bestimmte Kriterien - kam ich auf den Roman „Das Birnenfeld“. Die Autorin, Nana Ekvtimishvili, wurde 1978 in Tbilissi geboren. „Das Birnenfeld“ erschien 2015 in georgischer Sprache und wurde 2017 ins Deutsche übersetzt. In dem Roman geht es um Kinder, die in den 1990er Jahren in einem so genannten georgischen „Debilen-Heim“ verwahrt werden. Schnell stellt sich heraus, dass nicht nur geistig eingeschränkte, sondern auch völlig gesunde Kinder in diesem Kinderheim abgegeben werden, weil sie zu Hause keiner gebrauchen kann. Es lässt sich hoffen, dass das Werk überwiegend Fiktion und nicht zu nah an der Wahrheit dessen ist, wie die Zustände in georgischen Kinderheimen Anfang der 1990er Jahre waren. Die Autorin hat in einem Interview jedoch erzählt, dass es ein Kinderheim in einem Randbezirk von Tbilissi gegeben habe und sie neben diesem Heim aufgewachsen sei. Die schrecklichen Zustände von Schmutz und Gewalt im Kinderheim sind wohl nicht komplett erfunden.
Als Klassiker georgischer Literatur gilt „Ali und Nino“, ein Buch, das 1937 unter dem Pseudonym Kurban Said auf Deutsch in Wien erschien. Die Autorschaft von Kurban Said, eben die Frage, wer hinter dem Pseudonym steckte, konnte nie endgültig geklärt werden. Es heißt, ein Autorenduo mit westlichem Hintergrund verberge sich hinter dem Namen Kurban Said. Weil ich gelesen hatte, dass „Ali und Nino“ das aserbaidschanische Gegenstück zu „Romeo und Julia“ sei, interessierte mich dieses Buch. Es schien als tragische Liebesgeschichte in Georgien sehr bekannt zu sein, und deshalb wollte ich das Werk als Reiseeinstimmung lesen.
Handlungsort von „Ali und Nino“ ist die kaukasische Stadt Baku. Mir war deshalb anfangs nicht ganz klar, warum das Buch in Georgien so geschätzt wird, aber beim Lesen fand ich es nach und nach heraus: Nino, die weibliche der beiden Hauptfiguren, ist Georgierin. Der Name Nino ist sicher kein Zufall, denn die heilige Nino wird die „Erleuchterin Georgiens“ genannt, weil sie für die Bekehrung der Georgier zum Christentum verantwortlich ist. Die Nino aus dem Roman „Ali und Nino“ lässt ihren künftigen Ehemann Ali in Tiflis (= Tbilissi) ihrer Familie vorstellen - die Handlung spielt nicht ausschließlich in Baku. Am Ende des Romans flieht Nino nach Georgien, und so wird der Bezug zu Georgien wiederum deutlich. Erzählt wird die Liebesgeschichte von Ali als Ich-Erzähler. Auch Ali lobt die georgische Gastfreundschaft, so dass ich ihn hier zitieren möchte, bevor ich die eigentliche Handlung zusammenfasse. Weil Ali sich bei der gastfreundlichen georgischen Familie von Nino am kachetischen Wein berauscht hat, geht es ihm am nächsten Tag schlecht. Ali bedauert, zu viel Wein getrunken zu haben, als ihn die Vettern Ninos zu weiteren Festlichkeiten einladen: „Ich kroch aus dem Bett, ächzend wie ein Greis. Die Vettern hatten Ninos Augen und ihren schlanken, biegsamen Wuchs. Der Georgier ist wie ein edles Reh, das sich unter der Urwaldgesellschaft der asiatischen Völker verirrt hat. Keine andre Rasse des Ostens hat diese Grazie, diese Anmut der Bewegungen, diese trunkene Lust am Leben und die gesunde Freude am Nichtstun.“ (Said, Ali und Nino, Seite 159)
Aber zur eigentlichen Geschichte: Am Vorabend der Russischen Revolution im frühen 20. Jahrhundert verlieben sich der junge muslimische Adlige Ali aus Aserbaidschan und die siebzehnjährige Georgierin Nino, welche einen Prinzessinnentitel trägt und zugleich die Tochter eines christlichen Kaufmanns aus Baku ist. In den Kurzzusammenfassungen zu dem Buch heißt es oft, es handele sich um einen Liebesroman zwischen Orient und Okzident, und das gibt das Thema wohl am besten wieder.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten - um Nino zurückzubekommen, muss Ali sogar einen armenischen Bekannten ermorden, der sie entführt hat - heiraten die beiden Verliebten schließlich trotz aller gesellschaftlichen Widerstände und religiöser und kultureller Unterschiede. Sie heiraten in den Bergen, wohin zuerst Ali geflüchtet ist, weil er die Blutrache der Verwandten des von ihm getöteten Armeniers fürchten muss. Nino ist Ali einige Zeit später in die Berge gefolgt. In den Bergen in einem Dorf in Daghestan leben sie eine Weile zufrieden und bescheiden miteinander, bis sie die Nachricht vom Sturz des Zaren erreicht. Mit diesem sind auch die armenischen Feinde verschwunden, und für Ali und Nino wird der Weg zurück nach Baku frei. Dort aber erwartet sie der Kampf gegen die Russen, und so müssen Ali und Nino wiederum flüchten, dieses Mal zu reichen Verwandten von Ali nach Persien. Hier wollen sie bleiben, bis die Türken Baku erobert haben. Während Nino in Daghestan mit einem entbehrungsreichen Leben zufrieden war, verzweifelt sie trotz allen Luxus in Persien, wo sie als Frau isoliert von der Gesellschaft und ohne Rechte existieren muss, und wo Ali zu ihrem Entsetzen versucht - zumindest für die Öffentlichkeit - nach den strengen dortigen Regeln und Gesetzen zu leben. Als die türkische Armee Baku besetzt, können Nino und Ali endlich zurück nach Baku. Das Haus der Familie ist verwüstet, aber Nino nutzt die Zerstörung, um alles im Haus neu, europäisch und modern einzurichten. Sie wird plötzlich als Hausfrau froh. Auch Ali genießt zunächst die Veränderung im Staat, in welchem unter der Herrschaft der Türken die Russen nun nichts mehr zu sagen haben. Nur kurze Zeit später ist der Zweite Weltkrieg beendet, und wieder wendet sich das Blatt: Baku wird von den Engländern besetzt. Ein neuer Staat Aserbaidschan soll gegründet werden. Da Nino und Ali ein europäisch wirkendes Haus führen und beide Englisch sprechen, erhält Ali eine Stelle im Staatsdienst. In ihrem Haus müssen Ali und Nino jetzt das moderne, nicht mehr orientalische Aserbaidschan repräsentieren. Es wird zu ihrer Aufgabe, englische Beamte und Offiziere zu empfangen und zu unterhalten. Dies missfällt Ali zunehmend, denn er möchte lieber Asiate als Europäer sein. Als Ali für den Staat Aserbaidschan eine Stelle als Attaché im Außenministerium angeboten bekommt und nach Paris gehen soll, lehnt er zur Enttäuschung Ninos ab. Inzwischen haben Nino und Ali ein Kind, die Engländer ziehen ab, und der Staat Aserbaidschan wird souverän. Kaum sind die Engländer aus Aserbaidschan abgezogen, erreicht Ali und Nino auf dem Gut der Familie bei Gandscha die Nachricht, dass die Russen in Baku einmarschiert sind und das Parlament kapituliert hat. Obwohl es aussichtslos ist, entschließt Ali sich zu bleiben statt zu fliehen. Er will gegen die Rote Armee kämpfen. Nino flieht mit dem Kind nach Tifllis, und Ali verspricht, in wenigen Tagen nachzukommen. Ali und Nino sehen sich nicht wieder, denn Ali fällt im Kampf gegen die Bolschewiken an der Brücke von Gandscha. Das Ende der Geschichte ist, dass ein Freund beim toten Ali ein Heft findet, das er Nino überbringen will. In diesem Heft befindet sich die Liebesgeschichte von Nino und Ali, erzählt von Ali selbst.
Das habe ich jetzt zufällig gelernt: Von 1918 bis 1920 gab es nach dem Zerfall des russischen Reiches kurzzeitig die Demokratische Republik Aserbaidschan, die im Mai 1918 von der Aserbaidschanischen Nationalversammlung in Tbilissi gegründet worden war. Aber diese sowohl säkulare als auch demokratische Republik wurde nach dem Sieg der Roten Armee 1920 der Sowjetunion eingegliedert und blieb bis 1991 eine der zahlreichen Sowjet-Republiken. Dasselbe Schicksal traf Georgien nur ein Jahr später - 1921.
Es wundert mich nicht, dass die traurige Geschichte von Ali und Nino mit der von Romeo und Julia verglichen wird. Von den drei Büchern, die ich gelesen habe, hat „Ali und Nino“ meine Vorfreude auf Georgien am meisten erhöht, obwohl das Buch mit der Gegenwart Georgiens so wenig zu tun hat wie ein Roman über die goldenen zwanziger Jahre in Berlin mit dem heutigen Berlin gemein hätte. Aber der Grund dafür, weshalb ich die Geschichte so ausführlich nacherzähle, ist der, dass sie mir wirklich sehr gut gefallen und meine ohnehin schon große Freude auf die Reise in den Kaukasus weiter gesteigert hat. In Batumi, der Stadt am Meer, die wir gegen Ende unserer Reise besuchen wollen, soll die erste Sehenswürdigkeit, welche man vom Hafen aus betrachten kann, ein Denkmal für Ali und Nino sein. Im Jahr 2010 schuf die Bildhauerin Tamara Kwesitadse die Skulptur „Ali und Nino“, die ich natürlich unbedingt sehen möchte.
Die in Deutschland derzeit wohl bekannteste georgische Autorin ist Nino Haratischwili. Sie wurde 1983 in Tbilissi geboren, lebt aber in Hamburg und schreibt ihre Bücher in deutscher Sprache. Den Namen Nino Haratischwili hatte ich während der Buchmesse 2018 oft gehört. Ihr Buch „Das achte Leben (