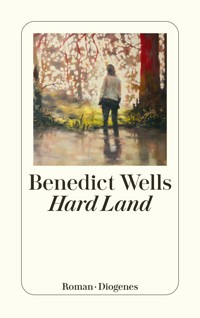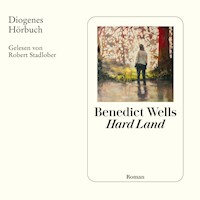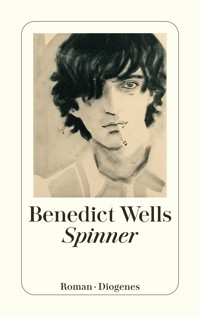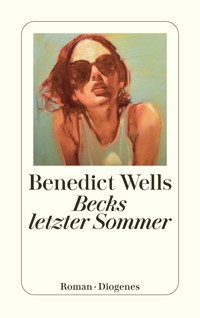Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Unbehauste
- Sprache: Deutsch
Die Fragen nach Herkunft, Identität, Zugehörigkeit ziehen sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte und finden in der heutigen Zeit eine Relevanz, welche unsere Welt vor neue Aufgaben stellt. 23 Autorinnen und Autoren schreiben über das Gefühl des Unbehaustseins. Über Grenzen und Grenzerfahrungen. Über Heimat, Flucht, Reise und Suche. Über jene, die man liebt, und Orte, an denen man sich behaust fühlt. Mit Friedrich Ani, Kat Kaufmann, Benedict Wells, David Wagner, Selim Özdogan, David Safier, Marcus Braun, Anik Feit, Christoph Silber, Florian Wacker, Matthias Sachau, Jule Müller, Robin Baller, Jürgen Hobrecht, Judith Poznan, Manfred Theisen, Tina Ger, Michel Birbæk, Linda Rachel Sabiers, Norbert Kron, Ramona Raabe, Moritz Rinke und Alexander Broicher. »Ein wirklich lesenswertes, vielschichtiges Buch.« Benedict Wells »Wer bin ich? Woher komme ich? Essentielle Fragen, die jeden ein Leben lang begleiten. Eine Anthologie, die das Fremdsein in Ansporn verwandelt, Grenzen zwischen uns und Anderen niederzureißen und in der Fremde einen Gewinn, eine Bereicherung für das eigene Leben zu finden.« DIE WELT Der NDR hat die Anthologie zum Buch des Monats erkoren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Pérdida de tiempo!
Moritz Rinke
Die Hörigen des Rattenfängers
Jürgen Hobrecht
Die letzten Tage der Grünen Autonomen Republik Berlin (West)
David Wagner
Fitnessflüchtlinge
Selim Özdoğan
Transit
Florian Wacker
Das Grundschulheim
Benedict Wells
Am Rand
Matthias Sachau
Nächte wie Schwarz und Weiß
Alexander Broicher
YEMMA
Christoph Silber
Das Antiquariat der verloren gegangenen Süßigkeiten
Ramona Raabe
Die Nachtfahrt
Tina Ger
Fremd gehen. Eine Seitensprungnovelle
Norbert Kron
Die Vergangenheit ist ein amerikanischer Schrottplatz
Manfred Theisen
LAGeSo
Jule Müller
Petrópolis
Robin Baller
Frau im Spiegel
Linda Rachel Sabiers
HIAWATHA
Marcus Braun
Die Schatten der Vergangenheit
Judith Poznan
LEICHTGEWICHT
Anik Feit
Tausendhundertzweiundachtzig Jahre Exil oder Hätt ich das gewusst, wär ich liegen geblieben
Kat Kaufmann
Mieses Karma. Das verschollene Kapitel
David Safier
FREMD.
Michel Birbæk
Die Geburt des Menschen
Friedrich Ani
Der Syrer
Friedrich Ani
Vorwort
Die Debatten sind kaum mehr überschaubar. Europa, von manchen mehr als Festung denn als offener Hafen gewünscht, sieht sich mit einer konstanten Flüchtlingswelle konfrontiert. Diese erfordert nicht allein die Aufnahme und Versorgung von Menschen in Not, sondern auch eine Diskussion über die Werte Europas. Und ob diese Werte – im übertragenen Sinne – Grenzen haben, oder ob auch sie an unseren geografischen Grenzen enden. Nennen wir sie nicht Menschenrechte? Sind Freiheit und Sicherheit eine Geldfrage? Oder gar Wohlstandsallüren?
Genau genommen könnten wir für jeden »fremden« Einfluss im Sinne einer Bereicherung des eigenen Wissens- und Erfahrungsspielraums dankbar sein, erfahren wir doch eine zunehmende Homogenisierung der Welt. Die Ängste vor dem Fremden sind in diesem Land eine bekannte Größe, die manche Demagogen geschickt zu instrumentalisieren wissen. Dieses Buch will im eigentlichen Sinne nicht rein politisch sein, sondern will über die Debatten hinausgehen und diese durch andere Perspektiven ergänzen. Es ist ein Lesebuch, das in fremde Welten entführt, die manchmal auch nur im eigenen Kopf stattfinden.
Denn was bedeutet es eigentlich, kein Zuhause zu haben? Und was alles kann ein Zuhause bedeuten?
Für diese Anthologie haben 23 Autorinnen und Autoren Geschichten geschrieben, die der aktuellen Diskussion Betrachtungen aus einer bewegten Welt hinzufügen wollen.
Es sind persönliche Geschichten über das Unbehaustsein – Gefühle der Fremde, Unzugehörigkeit, Ängste und Sehnsüchte. Geschichten der Flucht, der Reise, der Suche. Sie führen uns unter anderem über Wasser, in die Arktis, in ein Grundschulheim, auf ein Landesamt, einen Schrottplatz, durch Nächte, in einen Supermarkt, ein Antiquariat oder ein Hotelzimmer. Und in die Zukunft.
Teile der Erlöse dieses Buches kommen der Integrationsförderung zugute. Hiermit möchte ich mich bei den Autorinnen und Autoren des Buches ganz herzlich bedanken, nicht nur für ihr Engagement, sondern auch dafür, diese inspirierenden Geschichten mit uns zu teilen.
Bei Friedrich Ani, David Wagner, Kat Kaufmann, Benedict Wells, David Safier, Selim Özdogan, Marcus Braun, Anik Feit, Christoph Silber, Florian Wacker, Matthias Sachau, Jule Müller, Robin Baller, Jürgen Hobrecht, Judith Poznan, Manfred Theisen, Tina Ger, Michel Birbæk, Linda Rachel Sabiers, Norbert Kron, Ramona Raabe und Moritz Rinke.
Des Weiteren danke ich Daniel Fiedler und meiner Mutter für die Unterstützung.
Trotz Gefühlen der Unbehaustheit oder auch Angst vor Fremde, sollten wir uns vor Augen halten, dass Räume soziologisch betrachtet das Resultat menschlicher Handlungen sind. Ein Land kann also immer nur so gut sein wie die Gesamtheit der Handlungen seiner Bewohner. Es geht nicht darum, Geschichte gegen sich selbst zu schreiben. Es geht um nichts weniger als die Wiedergewinnung der Zukunft.
Alexander Broicher
Berlin im November 2015
Moritz Rinke
Pérdida de tiempo!
In den letzten Wochen reise ich zwischen der Türkei und Spanien und lese viel über Sachsen in der Zeitung. Ein Spanier auf Lanzarote hat mich gefragt: »Que pasa Pegida aleman? Pegida? Pegida!?«
Er wiederholte das Wort mehrere Male und sagte, er habe zuerst gedacht, es handele sich in Deutschland um eine »Pérdida«, eine »Pérdida de la memoria«, einen Gedächtnisschwund. Oder um eine »Pérdida de conocimiento«, eine Bewusstlosigkeit.
Ich antwortete, dass ich seine spanischen Bezeichnungen für die deutsche Pegida im Grunde genommen sehr passend finde, weil man ja eigentlich schon bewusstlos sein muss, um Sachsen oder Deutschland für islamisiert zu halten.
»Sachsen hat 0,2 Prozent Muslime, hält sich aber für orientalisch«, fügte ich hinzu. »Vielleicht stimmt da wirklich irgendwas nicht mit dem Kopf? (Pérdida de la memoria).
Der Spanier lachte. »0,2 Prozent!«, wiederholte er und zeigte auf die kanarische Promenade. »Da sind überall Deutsche, in unserem Ort leben 50 Prozent Deutsche!« »Ist das schlimm?«, fragte ich. »So eine Germanisierung?«
»No, no«, antworte er und klopfte mir auf die Schulter, »du bist ja auch einer, ihr seid alle Flüchtlinge des Wetters!«
Mir fiel eine Szene ein, genau auf dieser Promenade, es ist schon etwas her. Eine Frau aus Deutschland, die in einem Restaurant am Nebentisch beim Kellner selbstverständlich auf Deutsch ihr Gericht bestellte, hatte vom Unglück ertrunkener Flüchtlinge auf Lanzarote gehört und sagte zu ihren Tischpartnern: »Selbst schuld. Wenn man nicht schwimmen kann, steigt man nicht in ein schlechtes Boot.«
Am Cocoteros-Strand, in der Nähe des Ortes Teguise, hatten einen Tag zuvor Rettungskräfte 21 Leichen aus dem Meer gezogen. Das Boot der Flüchtlinge war 20 Meter vor dem Ziel gekentert.
Das Gesicht der Frau im Restaurant auf der Promenade, die das Schicksal der Flüchtlinge so kommentiert hatte und ohne jede Kenntnis, warum diese Menschen in ein schlechtes Boot gestiegen waren, obwohl sie nicht schwimmen konnten – dieses Gesicht der Frau stelle ich mir nun immer vor, wenn ich über Pegida in Deutschland lese.
Ich sehe dieses Pegidagesicht immer noch vor mir, wie es auf den eigenen Teller starrt und ohne einen blassen Schimmer seine Ansichten kundtut. Vielleicht war es sogar Tage zuvor mit dem TUI-Flieger genau über diese Flüchtlinge in ihrem schlechten Boot hinweggeflogen.
Warum flüchten Menschen?, hätte ich das Pegidagesicht heute fragen wollen. Warum verlässt jemand seine Familie und läuft Tausende Kilometer durch die Wüste? Warum erträgt jemand die Sahara, die Schlepper, die Bürgerkriege in den Ländern, die er hinter sich lassen muss, um am Ende auf ein brüchiges Boot zu steigen?
FLÜCHTLINGSKUNDE – man müsste die Menschen in Dresden oder Leipzig an die Hand nehmen oder ihnen zwangsweise einen »Flüchtlingsunterricht« auferlegen, eine »Flüchtlingskunde«: Syrien, Afghanistan, Irak, Myanmar, Somalia, Sudan, Kongo, Eritrea ... Und viele aus Politik und aus Medien müssten auch zur Flüchtlingskunde. Vielleicht würde es helfen, zu verstehen, warum wir nun genug über die deutsche Pegida berichtet haben.
Und vielleicht würde es auch helfen, den Blick so langsam über den Tellerrand und über unsere deutsche Promenade zu heben? Es gibt nämlich auch, wie mir der Spanier erklärte, eine »Pérdida de tiempo«, eine Zeitverschwendung.
(aus: Moritz Rinke, »Erinnerungen an die Gegenwart«, Kiepenheuer & Witsch 2014)
Moritz Rinke, geboren 1967 in Worpswede, studierte »Drama, Theater, Medien« in Gießen. Seine Reportagen, Geschichten und Essays wurden mehrfach ausgezeichnet. Sein Stück »Republik Vineta« wurde 2001 zum besten deutschsprachigen Theaterstück gewählt und 2008 für das Kino verfilmt. 2010 erschien sein Debütroman »Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel«, der zum Bestseller wurde. Sein Theaterstück »Wir lieben und wissen nichts« ist eines der erfolgreichsten Dramen der letzten Jahre und wird an über 50 Bühnen gespielt. Moritz Rinke lebt und arbeitet in Berlin.
Jürgen Hobrecht
Die Hörigen des Rattenfängers
Sonntäglicher Anruf der Mutter. – Wie stets: Alltags-und Allerweltsgeschichten aus einer 600-Quadratmeter-Villa in einer Kleinstadt im Weserbergland. Geordnete Verhältnisse. Der Rasen wie mit der Nagelschere geschnitten. Das Haus so geräumig, dass man sich nicht sehen muss. Unausgesprochenes wird ungesagt bleiben. Bis zum Ende. Sie, die Mutter im 84. Lebensjahr, er, der Vater, im 90. Zwei aus der Generation der Kriegskinder auf der Zielgeraden zur letzten Ruhestätte.
Aber nun ist es unversehens aufregend geworden. Angst ist aufgekommen in den Mittelschichthäusern an den Hängen des Weserufers. »Jetzt kommen die Flüchtlinge auch hierher«, sagt die Mutter aufgeregt. Es klingt wie die Angst der gebürtigen Hamburgerin vor der großen Flut.
»Die Kaserne ist schon voll!«, ruft sie. Bis auf 300 Meter hat sich die Flüchtlingswelle meinem Elternhaus genähert. Die Wehrmachtskaserne aus dem letzten Krieg war bis vor wenigen Jahren von der britischen Rheinarmee belegt. Nach dem Abzug stand der wilhelminische Wuchtbau leer. In den letzten Wochen sind dort 700 Flüchtlinge einquartiert worden. Zumeist sind es Frauen, die mit ihren Kindern allein auf der Flucht waren, oder, schlimmer noch, allein und unbegleitet geflüchtete Kinder und Jugendliche. Die meisten sind der syrischen Bürgerkriegshölle mit knapper Not entkommen.
»Frauen mit Kopftüchern!«, ruft meine Mutter aus. »Mehr sieht man nicht.« – »Kopftuch«, das Wort klingt aus ihrem Mund wie etwas Schmutziges, Verwerfliches.
Anfang der sechziger Jahre. Wochenmarkt auf dem Platz vor der Kirche. Die meisten Marktfrauen, vom Lande kommend, haben ein Kopftuch getragen, ebenso meine geliebte Großmutter bei der Gartenarbeit. Heute symbolisiert das Kopftuch das Fremde, das Ungewollte.
»Sie werden uns noch zwangsweise Flüchtlinge einquartieren«, und sie sagt es buchstäblich mit einem Atemzug, »genau, wie wir damals bei einer Familie einquartiert worden sind, nach dem Bombenangriff.«
»Siehste«, sage ich hoffend. »Dann weißte doch, wie das ist, wenn man alles verloren hat.«
Sie reagiert, als sei sie abgeschnitten von ihrer Erinnerung, erfüllt von namenloser Angst, die Fremden würden ihr nahe kommen. – Und jede Nähe ist wohl zu nahe, wenn man Angst hat.
»Was können wir für Syrien?«, kommt es trotzig. »Es war schwer genug nach dem Krieg – und jetzt kommen die und gefährden alles.« »Was heißt alles?«, frage ich gereizt.
»Na, alles! Arbeitsplätze, die Wohnungen, alles, was wir aufgebaut haben, geht über den Deister.« »Du hast doch nur Angst, dass man Euch etwas wegnimmt«, sage ich einen Ton zu schnippisch. Das Gespräch ist beendet.
Insgeheim hoffe ich, dass man in dieses riesige Haus Flüchtlinge einquartiert. Das brächte zweifelsohne Leben in die Bude.
Ich denke an meinen Mitschüler Kurt. Wir gingen Anfang der sechziger Jahre gemeinsam in die Volksschule. Kurt war ein kleiner schmächtiger Junge, zurückgeblieben und zu kurz gekommen. Schüchtern, oder vielleicht eingeschüchtert, äußerte er sich nur, wenn er gefragt wurde, sprach mit dünner Stimme. Kurt wohnte mit seiner Familie an der »Pumpstation«. Ein Viertel am Rande der Stadt, größtenteils Wellblechhütten, in denen noch bis Mitte der sechziger Jahre Flüchtlingsfamilien wohnten. Kurts Eltern kamen aus dem Osten. Jeder in der bürgerlichen Kleinstadt kannte die »Pumpstation«, wusste, wer dort wohnte. Jeder mied die Gegend und seine Bewohner, so gut er konnte. Meine Eltern haben mich gewarnt, vor Kurt und seinen beiden Brüdern. »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder«, sang Franz-Josef Degenhardt – und er meinte Flüchtlingskinder wie meinen Schulkameraden Kurt, der bald in die Hilfsschule wechselte. So hieß das damals. Abgestempelt für ein Leben im Abseits – 20 Jahre nach der Flucht der Eltern.
Meine Mutter hat den »Feuersturm« vom Sommer 1943 in Hamburg überlebt. Ende Juli bis Anfang August 1943 saß sie mit ihrer Mutter und ihrem scharlachkranken Bruder Nacht für Nacht im Hochbunker. Wenn sie erzählt, von den herannahenden Bomberströmen, den Einschlägen, die die meterdicken Bunkerwände erzittern und das Licht flackern ließen, hat sie meist zwei Gläser Wein getrunken. Es muss grauenhaft gewesen sein, das Schreien der Menschen. Ob sie auch geschrien hat? Ich traue mich nicht zu fragen. Sie ist mir nahe, wenn sie von den Bombennächten erzählt. Ihre Stimme völlig anders als die der hart und abweisend urteilenden Gesellschaftsdame, die über das heutige Leid der dem Krieg Entronnenen hinweggeht.
Eines Morgens, im Spätsommer 1943, treten die drei, meine Großmutter und ihre beiden Kinder, ins Freie. In Hamburg-Wilhelmsburg steht kein Stein mehr auf dem anderen. Ausgebombt, obdachlos. Meine Mutter ist damals zehn Jahre alt. Tage später wird das Mädchen als privilegierte Tochter eines Kripo-Beamten in einen Zug gesetzt. Es heißt, es ginge auf einen Ausflug aufs Land. Als der Zug den Bahnhof verlassen hat, erfahren die ganz unvorbereiteten Kinder, dass die Fahrt nach Österreich geht. Getrennt von der Familie sollen die Kinder im bombensicheren Alpenland leben. Auf den Verlust der Wohnung folgt die gewaltsame Trennung von Heimat und Familie. Sie dauert bis zum Ende des Krieges.
Die Erinnerungen der Mutter, sie kommen zurück, beim Erzählen mit dem Glas Wein. Eine wahrhaftige Erzählung, die mit einer Selbsttäuschung endet. Das alles vorbei sei, zum Glück, und lange her. Heute gehe es ihr gut. Beim Vater, dem einzigen seines Schuljahrgangs, der den Krieg überlebt hat, sind es die heftigen Schmerzattacken ungeklärter Ursache, bei der Mutter die Alpträume und Blutdruckkrisen, die sie für Tage handlungsunfähig machen. Das sei alles psychisch, sagt der Arzt, bleibt unverbindlich und deckt damit die greifbaren Ursachen zu. Wie dick ist die Mauer zwischen dem eigenen Leid und dem ganz ähnlichen Schicksal anderer Menschen? Warum ist jedes Mitgefühl unmöglich, die Fremdheit unüberwindbar?
Mein Vater äußerte Anfang der neunziger Jahre verhohlen Verständnis für die Brandanschläge von Mölln und Solingen. Deutschland sei durch Überfremdung bedroht. Dagegen müsse man sich wehren. Ich habe damals den Mittagstisch wütend und angewidert verlassen. Seither kein Gespräch mehr.
Im Bücherschrank des Elternhauses vor Kurzem noch Neuanschaffungen von Biografien des Nazi-Führungspersonals entdeckt: Goebbels, Himmler und Komplizen. Was will er mit fast 90 Jahren nachholen, seine gestohlene Jugend? Was will er verstehen, wenn er diese Bücher liest?
Mein chronisch schmerzkranker Vater hat seine Heimatstadt zeit seines langen Lebens nur verlassen, um in den Urlaub zu fahren, seine Kinder zu besuchen oder – überzeugt, wie er sagt – in den Krieg zu ziehen. Er kennt die Welt nicht. Auf seine letzten Tage sucht sie ihn heim, fast bis an die Grundstücksgrenze.
Ende der neunziger Jahre hatte ich einen Handwerker beauftragt, die Wände meines Wohnzimmers mit Schallschutz zu isolieren, um zu Hause Tonaufnahmen machen zu können. Der bereits im Ruhestand befindliche Mann, etwa im Alter meines Vaters, arbeitet emsig und akkurat. Als die Wände gedämmt sind, will ich die Akustik testen. Ich bitte den Mann in die Mitte des Raumes zu gehen und einen x-beliebigen Satz zu rufen, egal was, nur möglichst laut und druckvoll. Der Mann ist erst irritiert und etwas hilflos. Schließlich streckt er den Brustkorb, holt tief Luft, neigt den Kopf zur Decke und ruft mit voller Stimme in den toten Raum: »Wir haben den Krieg verloren!«
Jürgen Hobrecht, geboren 1957 in Hameln. Studium der Sozialpädagogik in Münster/Westfalen. Anfang der 1980er Jahre wurde Hobrecht durch seinen autobiografischen Roman »Du kannst mir nicht in die Augen sehen« einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seit 1982 zahlreiche Features und Reportagen für alle ARD-Hörfunksender. Ab 1992 Produzent und Realisator von Dokumentarfilmen und Reportagen für ARD, 3sat, Arte u.a. Seit 2009 Geschäftsführer der Phoenix Medienakademie e. V. in Berlin.
David Wagner
Die letzten Tage der Grünen Autonomen Republik Berlin (West)
Es sind wahrscheinlich die letzten Tage der Grünen Autonomen Republik Berlin (West). Die Söldner der DDR werden, wir rechnen damit, bald einmarschieren. »Humanitäre Mission« werden sie es nennen – und nicht einmal ganz Unrecht haben, es gibt ja kaum noch etwas zu essen in dieser Stadt, die keine funktionierende Stadt mehr ist.
Hinter der Ruine der Staatsbibliothek, wo einmal, lange her, vor dem Zweiten Weltkrieg, der Potsdamer Platz lag, erstreckt sich ein Birken- und Robinienhain bis zum Neuen Brandenburger Tor. Von der anderen Seite der Mauer, von drüben, glitzern hell erleuchtete Glastürme herüber. In ihrem Schein kann ich lesen, nachts gibt es nur hier noch Licht.
Dass die Mauer, in deren Nähe ich sitze, früher einmal, lange vor den Analogunruhen, dazu da war, um niemanden aus dem Osten herauszulassen, das mutet heute an wie ein Witz. Kinder, denen ich davon erzähle, wollen es nicht glauben. Sie lachen, wenn sie hören, dass die Mauer um unser Berlin früher einmal dazu da war.
Wie fing das an? Wie hat die DDR den Westen überholt? Die radikalen Reformen haben sie damals wohl am Westen vorbeikatapultiert. Im Rückblick sieht es so einfach aus, ja, die DDR hat den Westen durch Digitalisierung überholt – und sich schon im Jahr 2000 in Deutsche Digitale Republik umbenannt. Die Abkürzung blieb praktischerweise die gleiche.
Zur Sicherung ihrer Grenze hatte die DDR schon in den frühen achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts ein elektronisches Überwachungsnetz mit Kommunikationsmöglichkeiten und mobile Drohnen entwickelt. Staatsbetriebe begannen diese Überwachungstechnologie zu exportieren, Israel bekam die beste, fast unsichtbare Mauer der Welt, die USA kauften einen neuen, sehr langen Grenzzaun der neuesten Generation für ihre Grenze mit Mexiko. Überall, wo Armutsmigration aufgehalten werden musste, waren Qualitäts-Grenzsicherungen Made in GDR gefragt. Mauerschützen wurden gleich mitgeliefert, die Schwarzwasser-Söldner der DDR waren und sind als Spezialkräfte in der ganzen Welt unterwegs. Morgen oder übermorgen kommen sie wahrscheinlich zu uns. Die Digitale Republik will endlich aufräumen vor ihrer Haustür. Das Neue Brandenburger Tor soll endlich irgendwo hinführen.
Die prosperierenden Rüstungs- und Überwachungstechnologie-Exporte ermöglichten den Import von Konsumgütern, darüber hinaus wurden eigene, sehr erfolgreiche zivile Anwendungen der Überwachungstechnik entwickelt, mobile Telefone beispielsweise. Die Regierung schenkte jedem Staatsbürger ein Handtelefon, DDR-Bürger konnten nun jederzeit und überall miteinander telefonieren. Was sie nicht wussten oder nicht wahrhaben wollten: Dass sie so sehr leicht zu überwachen waren. Jeder trug eine Wanze, ein Abhörgerät mit sich herum, freiwillig. Kaum jemand musste mehr beschattet werden. Die Partei der Reformer in der Staatssicherheit hatte geahnt, dass es viel effektiver sein kann, die Bevölkerung sich selbst überwachen zu lassen.
Die Anti-Elektronik-Fraktion in Berlin (West) warnte vor diesen tragbaren Telefonen, ebenso die immer stärker werdende Vereinigung der Antimetaller. In der Grünen Autonomen Republik Berlin (West), die sich von der westdeutschen Altenpflegerdiktatur (der von Helmut Kohls Witwe regierten ehemaligen Bundesrepublik) losgesagt hatte, wurden Tragetelefone verboten. Die Regierung der Berliner Schwäbischen Alternative verbot dann nach und nach alle Elektronik und führte uns zurück zur Weidewirtschaft, nirgendwo durfte neu gebaut werden, Dächer wurden abgedeckt, um mehr Nistplätze für Vögel zu schaffen, es kam zu Zwangsumsiedlungen in Wagenburgen.
Heute fährt keine U-Bahn mehr, die Antimetaller haben die U-Bahntunnel geflutet und alle Autos stillgelegt (es gäbe allerdings auch weder Strom noch Benzin, um sie zu bewegen), während drüben im Osten selbststeuernde Automobile und Magnetschwebebahnen fahren. Nach Leipzig-Mitte ist die Schwebebahn angeblich nur siebenundzwanzig Minuten unterwegs. Wir hingegen gehen zu Fuß und heizen mit Abfällen. Holzfahrräder und Einbäume sind erlaubt, vegane Kleidung ist Pflicht.
West-Berliner, die noch eine andere Staatsbürgerschaft hatten, sind schon lange fortgezogen. Rückkehrprämien lockten türkischstämmige Berliner ins Boomland Erdogistan, es gibt keine Döner und keine vietnamesischen Restaurants mehr in Berlin, es gibt nur, was hier wächst: Gemüse. Immer wieder nur Gemüse. Überall Gemüse. Es wächst auf den Hängenden Gärten (die einmal Stadtautobahnen waren) und in Hochbeeten auf allen Plätzen und den Tempelhofer Feldern, überall wird biologisch und nachhaltig gegärtnert. Kaninchen finden viel zu fressen, werden aber nur heimlich gejagt, die Vegetaristen haben das totale Fleisch- und Tiertötungsverbot durchgesetzt. Nur die Grunewaldpartisanen scheren sich darum nicht, sie grillen auch Hunde. Es gibt ja genug, es gibt ungefähr hunderttausend wilde Hunde in der Stadt, Wald- und Straßenköter, die von den Haus- und Schoßhunden abstammen, die während der Analogunruhen von fliehenden Besitzern zurückgelassen wurden. Als die Analogunruhen vorbei waren, hatten die Bildschirmstürmer alle Fernseher und Computermonitore der Stadt zerschlagen. Die DDR sicherte sich in dieser Zeit die wertvollsten Bestände der Staatsbibliothek und die Schätze des Kunsthandwerkmuseums, kurz darauf brannte das Kulturforum ab, in dessen Ruinen ich hause. Der Wald ist dabei, sich das Gelände zurückzuerobern, Brombeeren und Pilze wachsen überall, Bienen summen herum. Seit es verboten ist, Bäume zu fällen, weil auch für Bäume Bürgerrechte gelten, wuchert alles zu.
In der DDR nahm die Selbstüberwachung der Bürger mit den aufkommenden Computer-Steckbriefalben dann ganz neue Züge an. Bald hatte jeder eine Seite im Netz und machte alles öffentlich, niemand wollte mehr Geheimnisse haben – dem Staat war das, so geht die Erzählung, sehr recht. Terminals standen überall, bald gab es transportable Geräte, und dann wollte jeder, auch Menschen im Westen, einen Robotron Boskop besitzen, Robotron Boskop, das Taschengerät für alle, das immer alles weiß. Und immer dabei sein kann. Robotron ist wohl Weltmarktführer – aber was weiß ich, ich lese ja nur altes Papier. Fetzen, die beim Brand der Staatsbibliothek übrig blieben.
»Überholen ohne einzuholen« – unsere Großeltern hatten über diesen Satz gelacht, und nun ist es ihnen doch gelungen. Der digitale Sozialismus hat gewonnen. Nicht nur Robotron, auch der Staatsbetrieb, der ursprünglich Raufasertapete für den Westen herstellte, wurde zum
Weltkonzern, weil ein sächsischer Ingenieur die Google erfand. Die Google war anfangs bloß eine Suchmaschine, die vieles im Netz finden und verbergen konnte. Heute weiß die Google einfach alles, weil jeder Nutzer ihr etwas verrät. Sie kann sich alles merken. Ursprünglich sollte die Google Kristallkugel beziehungsweise Kugel heißen – ihr Erfinder, der sächsische Ingenieur Erich Schmidt, sprach jedoch so undeutlich, daß alle immer Google statt Kugel verstanden.
Ich sitze jetzt auf einem umgestürzten Baumstamm nicht weit von der Mauer, die im Grunde unsichtbar ist, nur ein Leuchtband und ein mit Pestiziden kahl gehaltener Bodenstreifen markieren die Grenze. Ich könnte einfach hinübergehen, mir würde gar nichts passieren – wenn ich nur einen DDR-Chip implantiert hätte. Mittlerweile trägt jeder Bürger der Deutschen Digitalen Republik einen winzigen implantierten Near-Field-Communication-Chip mit individueller Kennung, der überall registriert wird, immer, überall, Neugeborene bekommen ihn in den ersten Lebensminuten eingesetzt. Trüge ich einen in mir, die unsichtbare Mauer würde mich erkennen und durchlassen. Ein NFC-Chip öffnet viele Türen, startet Selbstfahrerautos und Videospiele, ermöglicht Bezahlung und Grenzübertritte und identifiziert eindeutig. In der Deutschen Digitalen Republik ist jeder immer erkennbar.
Nicht wenige von denen, die noch hier in der Grünen Hungerrepublik ausharren, sind schon Bürger der Digitalen Republik. Ja, es war ein Geniestreich der DDR, dass sie Staatsbürgertum und Territorium entkoppelte. Fast jeder, egal wo er auf der Welt wohnt, kann Bürger der Deutschen Digitalen Republik werden. Er muss nur einer Chip-Implantierung zustimmen. So sind die besten Softwareingenieure Indiens, Indonesiens, Chinas Bürger der DDR geworden. Neubürger dürfen sich hocharbeiten, Bonuspunkte und Gratifikation können erworben werden. Vielleicht war das auch eine gute Idee der DDR: Ihren Bürgern das Leben als großes Videospiel zu verkaufen.
Hätte es nicht auch anders kommen können? Hätten die Digitalisten der Staatssicherheit damals im Frühjahr 1988 nicht geputscht – würde Erich Honecker noch immer regieren? Ohne die digitalen Reformen hätte die alte DDR ihren 40. Geburtstag wahrscheinlich nicht mehr gefeiert. Der Westen hätte den Kalten Krieg gewonnen. Wer weiß. Es gäbe vielleicht Strom, und ich müsste nicht nachts bis zur Mauer kriechen, um ein wenig Licht zu finden.
Die Sache mit dem Strom ist schwierig. Es gibt illegale Leitungen, es gibt versteckte Windkraftanlagen und Solarmodule – oft aber ziehen Anti-Strom-Fanatiker durch die Stadt und zerstören diese Anlagen, weil sie Stromstrahlen fürchten. Um den natürlichen Biorhythmus nicht zu stören und die Pflanzen und Tiere nicht zu irritieren, gilt sowieso ein allgemeines Nachtlichtverbot. Deshalb sitze ich hier an der Mauer, hier kann ich lesen, hier kommt Licht von drüben.
Rüber möchte ich trotzdem nicht. Ich bin gerne eine tote Seele. So nennen sie uns, tote Seelen, weil wir nicht registriert sind, weil es uns digital nicht gibt. Sie haben ja keine Ahnung.
David Wagner, geboren 1971, veröffentlichte im Jahr 2000 den Roman »Meine nachtblaue Hose«, in den folgenden Jahren erschienen u.a. »Spricht das Kind«, »Vier Äpfel« und »Welche Farbe hat Berlin«. Sein Roman »Leben« wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2013 und dem Best Foreign Novel of the Year Award 2014 der Volksrepublik China ausgezeichnet. David Wagner lebt in Berlin.
Selim Özdoğan
Fitnessflüchtlinge
Sie sind doch alt genug, Sie müssen sich doch erinnern, diese Flüchtlingswelle damals, 2015. Das war so, als wäre ein Leck im Boot, aber keiner wollte es abdichten. Im Gegenteil, es wurden noch mehr Löcher gebohrt. Die Hinweise, dass das Schiff dann sinken werde, wurden als Panikmache abgetan. Den Warnenden wurde entgegengehalten, dass Wasser erwiesenermaßen notwendig zum Leben sei. Sie wurden als Wasserhasser diffamiert. Anstatt das Schiff abzuschotten, wurden mit jedem weiteren Loch Parolen ausgegeben. Wir schaffen das, sagte die Kapitänin. Willkommenskultur, sagte das Volk.
Damit das Wasser sich nicht so allein fühlte, wurde immer mehr Wasser eingelassen, einige jubelten und spendeten Becher. Das war, bevor alle nasse Füße bekamen.
Wir wären fast untergegangen, was da kam, sprengte unsere Kapazität. Es war zuviel für Deutschland, das weiß heute jedes Kind, wir sind getaumelt unter der Last, aber wir sind nicht zusammengebrochen. Und jetzt sollen wir das alles wiederholen?
Die anderen waren fremd und kriminell, und die neuen Asylanten sind unserer Kultur näher und deswegen keine Gefahr? Glauben Sie, was Sie da erzählen? Haben Sie mal nur einen kurzen Moment nachgedacht?