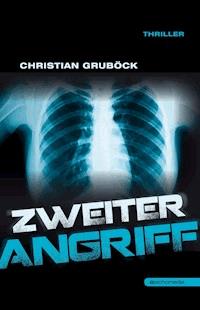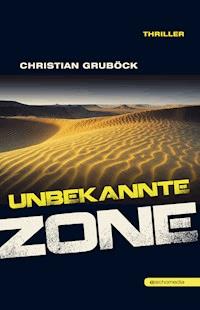
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: echomedia buchverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Bernd und Silvia Raabe überleben als Einzige einen Flugzeugabsturz in der ostafrikanischen Steppe. Ihre Freude über die Begegnung mit zwei Verirrten währt jedoch nur kurz, denn sie müssen feststellen, dass sie alle auf mysteriöse Weise gefangen sind. Ein Rettungsteam wird entsandt, in einem waghalsigen Befreiungsversuch will der Versicherungsdetektiv Christoph Grünberg sich selbst opfern. Doch die Ereignisse überstürzen sich, und es wird klar: Es geht nicht mehr nur um die vier Eingeschlossenen – es geht um die ganze Welt! Eine rätselhafte überdimensionale Macht versetzt die Menschheit in Panik. Regierungen in aller Welt suchen fieberhaft nach einem Ausweg. Dennoch will die kleine Truppe in Afrika selbst die Lösung des Problems in die Hand nehmen. Der Parawissenschaftler Michael Konter entschließt sich, einem absurden Gedanken nachzugehen – allein …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
DREI MONATE SPÄTER
FÜNF JAHRE DANACH
Unbekannte Zone
Christian Gruböck
Impressum
eISBN: 978-3-902900-41-8
E-Book-Ausgabe: 2014
2013 echomedia buchverlag ges.m.b.h.
Media Quarter Marx 3.2
A-1030 Wien, Maria-Jacobi-Gasse 1
Alle Rechte vorbehalten
Produktion: Ilse Helmreich
Layout: Brigitte Lang
Covergestaltung: Elisabeth Waidhofer
Coverfoto: Thinkstock
Lektorat: Thomas Hazdra
Herstellungsort: Wien
E-Book-Produktion: Drusala, s.r.o., Frýdek-Místek
Besuchen Sie uns im Internet:
www.echomedia-buch.at
1. KAPITEL
Wenn man gemütlich zu Hause sitzt,
sinnt man auf Abenteuer. Hat man ein
Abenteuer zu bestehen, wünscht man
sich, man säße gemütlich zu Hause.
THORNTON WILDER
FLIEGEN
Othmar Weninger war ein reicher Mann und konnte sich vieles leisten, von dem die meisten nur träumen konnten – wie diese Spritztour durch Afrika.
Er liebte spontane Entscheidungen, und so hielt er es auch mit seinen Urlaubsplänen. Einfach starten und los geht’s war seine Devise. Seine Freundin machte ohnehin überall mit, Hauptsache, es kostete sie nichts.
Weninger hatte es vom kleinen Angestellten zum Multimillionär gebracht. Er besaß mehrere Einkaufszentren in Deutschland und eines in der Schweiz. Das Flugzeug verwendete er nur sehr selten für berufliche Zwecke – Abenteuerurlaube wie dieser waren für seinen Jet bestimmt. Es ärgerte ihn daher umso mehr, dass er vor einer Woche noch eine Lieferung Matratzen für seinen Bruder eingeladen hatte und die Ladung bis jetzt nicht liefern konnte. Im Notfall konnte er die Matratzen ja abwerfen, dachte er. Die armen Kerle da unten würden sicher ihre Freude haben – dann könnten sie wenigstens einmal wie richtige Mitteleuropäer schlafen.
Weninger überflog gerade ein kleines Dorf und beobachtete einige Eingeborene, wie sie um ein kleines Feuer standen oder eher tanzten. Die stehen ja nie ruhig, dachte er und schmunzelte.
Mit dem „Abwerfen im Notfall“ war es Weninger durchaus ernst, aber natürlich nur, falls sie so viel einkaufen oder mitnehmen wollten, dass der vorhandene Platz nicht ausreichen sollte – nur dann würde er sich wirklich von seiner Fracht trennen.
Spontane Einkäufe waren nämlich ebenfalls eine seiner Leidenschaften. Das Originellste, was er jemals mitgenommen hatte, war ein lebendes Zebra. Er hatte es eingefangen und einfach behalten, weil es ihm so gut gefiel – wie ein Kind, das ein Spielzeug nicht mehr hergeben will. Den Zoll hatte er ganz einfach bestochen – mit Geld war eben alles möglich. Bei diesem Gedanken musste er sich zusammenreißen, um nicht laut aufzulachen.
Die anderen hatten sich ein wenig aufs Ohr gelegt und es herrschte Stille im Flugzeug. Weninger konnte sich ganz dem Fliegen hingeben. Er brauchte nicht so viel Schlaf. Ihn durchfuhr immer noch der größte Adrenalinstoß, wenn er über den Wolken war. Frei – unerreichbar für die ganze Welt, das war ein Gefühl, das sogar noch die finanzielle Macht übertraf.
Er wurde plötzlich aus seinen Gedanken gerissen. „Sind wir schon da?“ Karin Langer, seine Freundin, stolperte verschlafen nach vorn.
„Nein, so schnell geht das nicht, meine Liebe.“
„Ich will nicht den ganzen Urlaub im Flugzeug verbringen.“
„Das wirst du auch nicht. Ich habe euch doch gesagt, dass unser nächstes Ziel eine Überraschung sein wird. Der schönste Strand, den du je gesehen hast, und vor allem ohne Touristen.“
„Ja, aber der letzte Strand war doch auch sehr schön, und du hast mir versprochen, nicht dauernd zu fliegen, wie sonst auch immer.“
„Ein Abenteuerurlaub ist eben auch anstrengend, mein Schatz. dafür erlebst du im Gegenzug einmalige Dinge und siehst die ganze Welt von oben.“
Karin war enttäuscht. Sie vermisste ihre Badewanne und ihre Handygespräche. Kein Strand konnte ihr das je ersetzen, dachte sie, behielt es aber für sich.
„Ich sehe da unten weit und breit kein Wasser“, nörgelte sie weiter.
„Warte ab. Sind die anderen schon wach?“
„Ich glaube schon, soll ich sie holen?“
„Nicht nötig.“ Bernd Raabe, Weningers bester Freund, betrat soeben das Cockpit. „Deine Liegesitze sind zwar erste Klasse, aber auf deinen Matratzen hinten im Lager schläft man wie ein Baby.“
Raabe war das perfekte Gegenstück zu Othmar Weninger. Mit seiner nüchternen und realistischen Art kompensierte er dessen Mängel perfekt. Außerdem stellte Raabe auch optisch ungefähr das Gegenteil von seinem Freund dar. Mit seinen einssechsundachtzig und seinem durchtrainierten Körper hätte man ihn leicht zehn Jahre jünger geschätzt. Tatsächlich war er achtundvierzig und somit ein Jahr älter als der Pilot. Raabe verdankte das junge Aussehen hauptsächlich seinen vollen schwarzen Haaren, von denen kein einziges gefärbt war.
Bernds Frau, Silvia, war ebenfalls mit nach vorn gekommen. Nun saßen sie alle vier im Cockpit und blickten auf eine endlose Steppe.
„Sieht nicht nach Strand aus“, konstatierte Raabe.
„Fang du jetzt nicht auch noch an“, murrte Weninger.
Tatsächlich war unter ihnen nur unbewohnte Steppe. Die tanzenden Einheimischen hatten sie längst hinter sich gelassen. Wären da nicht vereinzelt diese armseligen kahlen Bäume gewesen, hätte man auch glauben können, dass sie eine Wüste überflogen.
„Fliegst du nicht etwas zu tief?“, wunderte sich Raabe. „Zu sehen gibt’s da unten sowieso nichts.“
Weninger wirkte plötzlich nicht mehr so gut gelaunt wie noch vor einigen Minuten. Er war jetzt richtig angespannt. Er drückte ungewohnt schnell auf dem Schaltpult herum und wurde immer nervöser.
„Stimmt was nicht?“ Raabe, der schon oft mit seinem Freund geflogen war, erlebte dieses seltsame Verhalten zum ersten Mal.
Karin und Silvia bemerkten es jetzt auch. „Wir haben schon genug von deinen Spielchen gesehen, du kannst wieder höher fliegen“, meinte Silvia.
Weninger reagierte nicht und werkte weiterhin wie besessen an seinen Hebeln und Instrumenten herum.
Das Flugzeug sank dennoch weiter ab.
„Was ist los?“, Raabe wurde nun etwas lauter und eindringlicher.
„Es funktioniert nicht, verdammte Scheiße. Das ist los!“, schrie der Pilot seine Begleiter an und gestikulierte dabei wie ein Verrückter. Plötzlich schlug er mit der Faust so heftig auf die Armaturen ein, dass eines der vielen runden Gläser der Anzeigetafel einen Riss bekam. Es änderte sich nichts. Sie sanken weiter rasant ab. Mittlerweile waren die kleinen Bäume schon bedenklich groß geworden.
Bernd Raabe war der Erste, der den Ernst der Lage erkannte. „Stürzen wir ab? Rede mit uns!“, schrie er seinen Freund an.
„Ich begreife das nicht. Das Flugzeug reagiert überhaupt nicht“, antwortete dieser, mehr zu sich selbst als zu den anderen, und wirkte dabei wie in einem Trancezustand. Sein Gesicht war rot angelaufen und seine Bewegungen an den Armaturen und Hebeln wurden immer hektischer und unkoordinierter.
Der Boden unter ihnen kam immer näher. Das Flugzeug machte keinerlei Anstalten, sich wieder Richtung Himmel zu bewegen.
„Kannst du notlanden?“ Raabe sah misstrauisch auf die unebene Steppe vor ihnen.
„Wenn ich keinen Baum erwische – vielleicht.“ Weninger zwang sich zur Ruhe. „Ich weiß nicht, was dieses verdammte Flugzeug hat. Es ist alles hundertmal kontrolliert und überholt worden. Die Instrumente dürften auch in Ordnung sein, aber ich kann es nicht mehr richtig steuern. Wir kommen nicht mehr in die Höhe.“
Weninger schien sich wieder einigermaßen unter Kontrolle zu haben. „Das Fahrgestell ist draußen – wenigstens etwas. Schnallt euch an!“
„Bring das Flugzeug irgendwie da runter. Wir sind hinten!“ Raabe verschwand mit seiner Frau in Richtung Laderaum, ohne auf eine weitere Reaktion zu warten.
„Zwischen den Matratzen haben wir eine Chance zu überleben. Auf jeden Fall sicherer als im Cockpit!“, rief er Silvia zu, während sie nach hinten liefen. Sie folgte ihm wie sie es immer machte.
Karin Langer saß angegurtet neben ihrem Freund und blickte mit offenem Mund nach vorn. Bei den folgenden Bildern konnte man nicht sprechen – nur hoffen. Sie überflogen eine kleine Ansammlung von Bäumen, und der Boden raste immer schneller auf sie zu. Als sie jeden Moment mit dem Aufsetzen rechneten, waren die Bäume plötzlich verschwunden.
„Vielleicht haben wir doch noch Glück. Jetzt können wir nur noch beten“, murmelte Weninger und hielt sich an seinem Sitz fest. Seine Freundin saß in derselben Stellung neben ihm und starrte wortlos nach vorn.
Sie hatten kein Glück. Der Steppenboden, der von oben fast eben ausgesehen hatte, erwies sich als hügelig und hatte kraterartige Löcher. In einem dieser Löcher setzte das Fahrgestell auf und brach augenblicklich wie ein Zahnstocher. Der Rumpf der Maschine schoss ungebremst über den holprigen, steinharten Boden. Teile des Flugzeugs flogen durch die Luft und die Erschütterung war so heftig, dass Weninger und seine Freundin bereits bewusstlos in ihren Sitzen hingen. Sie sahen nicht mehr, dass erneut Bäume auftauchten, auf die sie nun zurasten. Sekunden später kam es zur Kollision.
Der Vorderteil des Rumpfs wurde vom Anprall regelrecht zerfetzt. Die rechte Tragfläche brach ab, rutschte allein weiter, fing Feuer und explodierte Sekunden später. Zu diesem Zeitpunkt war die Entfernung zum abgebrochenen Teil bereits so groß, dass der Rest des Flugzeugs von den brennenden Wrackteilen nicht mehr getroffen wurde.
Der zweite Flügel – nicht zur Gänze abgebrochen – hing noch am Rumpf. Das vordere Drittel der Maschine war nicht mehr – oder nur mehr zum Teil – vorhanden und steckte in der kleinen Gruppe von Bäumen fest, die wie von einem überdimensionalen Rasenmäher abrasiert dastanden.
Nur der hintere Teil der Maschine war großteils noch unbeschädigt – sonst wären Bernd und Silvia ebenso gestorben wie ihre beiden Freunde.
Bernd war zur Ladeklappe gestürzt, die sich zum Glück auch von innen öffnen ließ, hatte sie nach draußen gekippt und hob nun Silvia, die noch sehr benommen war, aus dem Flugzeug. Dann lief er auch schon los. Mit Silvia auf dem Rücken auf dem unebenen Steppenboden zu laufen war ein schwieriges Unterfangen. Aber sein Instinkt schrie: Laufen!
Nach einem guten Kilometer konnte er nicht mehr und legte Silvia so sanft es eben ging auf den Boden. Keuchend lag er neben ihr, als die Reste des Flugzeugs explodierten. Der Vollbrand erzeugte dreißig Meter hohe Flammen. Bald konnte man die Bäume und das Wrack nicht mehr erkennen, alles war ein einziges Flammenmeer, umgeben von starkem Rauch, der bis zu ihnen vordrang.
Er war gerade weit genug gelaufen – sie waren in Sicherheit.
„Alles in Ordnung bei dir?“
„Ich glaube schon“, stammelte Silvia, die noch immer benommen wirkte. „Sind die zwei da drinnen?“ Sie deutete in Richtung Feuer.
Bernd nickte nur und sie blickten beide wortlos auf den Flammenberg.
GESTRANDET
Das Wrack brannte noch gute vier Stunden. Die Flammen ließen nichts übrig. Bernd hatte nicht einmal sein Handy, das er eigentlich immer bei sich hatte, retten können. Es war alles viel zu schnell gegangen, und außerdem nutzte ein ausgeschaltetes Handy im Flugzeug ja nicht viel. Also warum hätte man es bei sich tragen sollen? Jetzt freilich bereute er diesen Fehler.
Silvia hatte ebenfalls nichts außer ihrer Kleidung bei sich.
Sie hatten praktisch nichts mehr, und sie befanden sich mitten in einer unbekannten Steppe – irgendwo in Afrika. Mit dieser aussichtslosen Situation konnten sie sich aber noch nicht richtig beschäftigen, da sie beide nur einen Gedanken hatten: Ihre Freunde waren auf eine schreckliche Weise zu Tode gekommen und vor ihren Augen verbrannt.
„Glaubst du, dass sie es mitbekommen haben?“, beendete Silvia das Schweigen.
„Schau dir die Überreste doch an. Das ist viel zu schnell gegangen. Die haben nicht lange leiden müssen. Vermutlich waren sie schon beim Aufprall tot. Wir haben nur durch die Matratzen überlebt, sonst hätte es uns auch erwischt. Wir müssen Gott danken.“
Silvia wunderte sich über die letzten Worte, denn Bernd glaubte nicht an Gott. Aber in dieser Lage war es wohl normal, sich an etwas zu klammern.
„Das ist gar keine kleine Wand aus Steinen, auf der wir da sitzen!“, rief Bernd plötzlich und sprang auf. Er betrachtete das kleine Bauwerk, auf das sie sich gesetzt hatten und das zum Teil im Sand versteckt war.
„Was soll es sonst sein?“ Sie blieb auf den Steinen sitzen.
„Ein Brunnen! Ein ganz normaler Brunnen – von Menschen angelegt. Hier gibt es Menschen! Verstehst du? Wir sind nicht allein. Dieser Brunnen ist nicht zufällig hier.“ Bernd war außer sich vor Freude.
Silvia konnte seinen Gedankengängen nicht ganz folgen und teilte seine Freude keineswegs. „Der Brunnen kann hundert Jahre alt sein. Woher willst du wissen, dass er intakt ist und benutzt wird?“
„Wenn du dich umdrehen und genau hinschauen würdest, würdest du meine Freude verstehen. Da ist ein Seilzug montiert, zum Runterlassen der Eimer, und der ist ganz und gar nicht verfallen – der funktioniert butterweich.“ Bernd drehte an dem filigranen Stahlgestell und es ließ sich tatsächlich leicht bewegen. „Funktioniert wie geschmiert. Weißt du, was das heißt?“
Silvia blickte ihn verwundert an. Sie konnte seine Freude nicht teilen, sosehr sie sich auch bemühte. „Hier ist doch weit und breit nichts“, sagte sie verständnislos.
„Dann gehen wir mal über diese kleine Anhöhe dort. Wetten, dass dahinter ein Dorf liegt?“
Bernd war kein Optimist, aber wenn er an etwas glaubte, dann war er nicht zu stoppen. Silvia zog sich ihre Schuhe wieder an, die ihre Zehen mittlerweile an mehreren Stellen aufgeschunden hatten. „Geben wir ihnen den Rest“, seufzte sie und meinte damit ihre Füße. Sie gingen über den Hügel.
Vor ihnen lag ein kleines Dorf. Es waren zwar keine Menschen zu sehen, aber es war eindeutig ein Dorf. „Die werden auf der Jagd sein oder so ähnlich. Wir sind gerettet!“, rief Bernd freudig aus.
„Dein Wort in Gottes Ohr.“
DAS DORF
Es waren mindestens dreißig Holzhütten, die da nebeneinander standen. Irgendetwas wirkte auf Bernd befremdend. Etwas stimmte nicht – hier war niemand.
Sie näherten sich vorsichtig und betraten eine der Hütten – leer. Die nächste Hütte ebenfalls – sie waren alle leer. Vereinzelt befanden sich in den Hütten Holztische, Sessel und Bettgestelle, aber keine Bewohner. Außerdem gab es keinerlei Dinge des normalen Lebens wie Geschirr oder Lebensmittel. Auch keine Kleidungsstücke oder Schuhe – einfach nichts. Einzelne größere Möbel waren so platziert, als hätte sie jemand verrückt – sie standen nicht so, wie man sie normalerweise aufstellt. Bernd konnte es nicht anders ausdrücken und teilte seine Meinung Silvia mit, die sich dafür jedoch kaum zu interessieren schien. Als sie in der fünften Unterkunft die gleiche Feststellung machten, wurde ihre Hoffnung langsam wieder schwächer.
„Als wären alle geflüchtet. Keine persönlichen Dinge. Das ist mir unheimlich hier – wie in einer Geisterstadt.“
„Wenn man flüchtet, nimmt man doch keine Fensterflügel mit, oder?“ Bernd deutete auf die Fenster der Hütte, die offensichtlich keine Fensterläden mehr hatten. „In der vorigen Hütte waren noch zwei Läden vorhanden. Also hatten diese Hütten ursprünglich alle Fensterläden. Wer nimmt Fensterläden mit, wenn er ein Haus verlässt? Und überhaupt passen diese Holzbauten gar nicht hierher – viel zu modern.“
„Sind das jetzt deine Sorgen? Hier ist niemand. Wir sind nach wie vor im Arsch und ich habe Durst und hungrig bin ich auch.“ Silvia gingen die Nerven durch und sie schrie Bernd verzweifelt an: „Wir werden hier verhungern und verdursten!“
„Verdursten sicher nicht. Hast du nicht bemerkt, dass hier fast so viele Brunnen wie Hütten sind?“
„Deine tollen Brunnen sind mir egal. Ich habe sie gesehen, aber sie werden genauso leer sein wie dieses ganze Dorf. Ich kann nicht mehr.“ Sie setzte sich auf den Boden der leeren Hütte Nummer drei, mit deren Untersuchung sie gerade fertig geworden waren.
„Reiß dich zusammen. Komm, wir schauen weiter. Zuerst holen wir einmal Wasser aus einem der Brunnen.“
„Ich warte hier. Hol dein Wasser bitte allein. Ich brauche eine Pause.“ Silvia zog sich die Schuhe aus und zeigte Bernd ihre blutigen Füße als Beweis.
„Okay, ich komme wieder.“ Bernd war bereits draußen.
Die Brunnen sahen alle so aus wie der, auf dem sie gesessen waren. Fast vor jeder Hütte stand einer. Bernd hatte noch nie ein Dorf gesehen, in dem so viele Brunnen angelegt worden waren. Darüber nachdenken wollte er später. Sie hatten jetzt andere Sorgen. Sie brauchten Wasser.
Warum gibt’s hier keine Kübel? Oder irgendwelche anderen Gefäße? Bernd durchsuchte weitere drei Hütten, konnte aber nur das Gleiche feststellen, was er in den anderen zuvor schon bemerkt hatte. Es gab überhaupt keine kleineren Gegenstände – so absurd es auch schien. Also auch keine Becher oder etwas Ähnliches, womit er hätte Wasser holen können.
Gut, dann machen wir es eben anders, dachte er und konzentrierte sich auf die Brunnen.
Er entschied sich für jenen vor der Hütte, in der Silvia saß. Der Brunnen war keine zehn Meter vor der Hütte gebaut worden – oder war die Hütte vor den Brunnen gebaut worden? Egal. Er konnte sein gründliches Denken schwer abschalten, aber hier sollte er vorerst einmal praktisch tätig werden. Er zog sein Hemd aus, machte ein Knäuel daraus und band es an das Seil, das auf der Winde über dem Brunnen hing. Wenigstens das Seil war da. Dann ließ er das Hemd in den Schacht hinab. Es war zwar kein Schwamm, aber ein Baumwollhemd um hundert Euro sollte doch ein wenig Wasser aufnehmen können.
Bernd kurbelte und wartete auf das vertraute Geräusch, das entsteht, wenn man etwas ins Wasser wirft. Als das Seil schon ziemlich am Ende war, vernahm er endlich ein leises Platschen.
Er drehte sofort in die andere Richtung und holte das durchnässte Hemd wieder nach oben. Wasser! Es war wirklich Wasser und es hatte sein weißes Hemd in keiner Weise verfärbt. Also reines Wasser, hoffte er und drückte sich ein paar Tropfen auf die Zunge. Eine andere Möglichkeit, es festzustellen, hatte er schließlich nicht. Es schmeckte nach echtem Wasser, und Bernd gewann sogleich wieder seinen zuversichtlichen Gesichtsausdruck zurück. Verdursten würden sie also wenigstens nicht.
Nachdem Silvia zwei Hemden voll von dem herrlichen Nass getrunken hatte, gönnte er sich selbst auch eines. Ein brauchbares Behältnis war leider nicht aufzutreiben gewesen. Es funktionierte aber auch so. Sie würden sich schon ein passendes Gefäß finden. Silvia war wieder ein wenig fröhlicher geworden.
„Suchen wir weiter. Es geht mir wieder besser und ich kann barfuß gehen. Lieber einen Skorpionstich, als diese Schuhe wieder anziehen zu müssen.“
Sie lachten beide und begannen mit der Durchsuchung der verbliebenen Hütten.
Bis sie von einer unerwarteten Entdeckung überrascht wurden.
BEGEGNUNG
Bernd sah ihn zuerst und blieb stehen. Einige Sekunden später konnte auch Silvia ihn ausmachen.
„Ist das eine Fata Morgana?“, zweifelte sie.
„Nein, ich sehe ihn auch, dort steht ein Jeep. Ein ziemlich neuer Wagen noch dazu“, bestätigte Bernd ihre Sichtung.
Der Wagen stand ziemlich am Ende der in einer Reihe angelegten Hütten. Keine fünfzig Meter von ihnen entfernt.
Sie waren also doch nicht allein, dachte Bernd und lief auf den Wagen zu.
Mit jedem Schritt, den er näher kam, war er sich sicherer. Da saßen zwei Menschen drinnen – echte Menschen aus Fleisch und Blut, und das waren keine Eingeborenen. Er begann zu rufen und zu winken wie ein Ertrinkender, der seinen letzten Versuch macht, bevor er für immer untergeht.
„Hallo, hier sind wir, fahren Sie nicht weg!“ Die Wortwahl kam ihm schon während des Rufens reichlich dumm vor, aber was sollte man in einer solchen Situation sonst rufen? Vielleicht: Ich freu mich, dass ihr da seid?
Egal, die beiden mussten ihn gehört haben, denn sie drehten sich zu ihm um. Nach kurzem Zögern, offensichtlich waren sie von seinem Erscheinen ebenso überrascht, winkten sie zurück.
Sie dürften uns wenigstens nicht feindlich gesinnt sein, dachte Bernd und musste innerlich lachen. In den angespanntesten Augenblicken denkt man doch oft die verrücktesten Dinge.
Bernd lief so schnell er konnte auf die zwei Unbekannten zu und brachte, als er angekommen war, nur unartikuliertes Keuchen hervor. Er war zwar durchtrainiert, aber selten betrieb er Sport bei plus vierzig Grad. Noch bevor er seine Stimme wiedergewonnen hatte, traf auch Silvia bei den beiden Unbekannten ein, ihr Keuchen war noch heftiger. Während sie nach Luft ringend dastanden, öffnete sich die Fahrzeugtür auf der Fahrerseite.
Ein etwa vierzigjähriger Mann stieg aus und seine ungefähr gleichaltrige Begleiterin folgte ihm auf der anderen Seite des Wagens. Die zwei Fremden lächelten freundlich, als sie auf Bernd und Silvia zukamen.
„Wir sind also doch nicht allein hier“, begrüßte sie der Mann in deutscher Sprache und reichte Bernd die Hand, der den Gruß mit seiner verschwitzten Rechten erwiderte.
„Bernd Raabe, und das ist meine Frau.“ Er zeigte kurz auf die schnaufende Gestalt neben sich. „Wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt. Unsere Freunde sind tot und wir besitzen nichts mehr – außer unserer Kleidung. Wir dachten schon …“
„Langsam, es hat alle Zeit der Welt, Ihre Geschichte zu erzählen. Hier läuft uns nichts davon. Ich bin Andreas Halser und das ist meine Frau Anita.“
Die hübsche Schwarzhaarige neben ihm kam näher und reichte ihnen ebenfalls die Hand. „Willkommen in der Hölle“, sagte Anita monoton und murmelte dann noch etwas leiser, aber für Bernd noch hörbar, zu ihrem Begleiter: „Wenigstens sind wir nicht mehr allein.“
Bernd war diese Begrüßung irgendwie unheimlich. Die zwei hatten doch ein Auto und trotzdem sprachen sie so, als würden sie hier festsitzen. Das verstand er nicht, das musste er klären.
„Wie meinen Sie das? Sie haben doch einen fahrbaren Untersatz und sind, soweit ich sehe, nicht verletzt. Sie sitzen doch nicht hier fest wie wir und ich hoffe, Sie nehmen uns zur nächsten Siedlung mit. Sie haben doch kein Problem damit, oder?“ Bernd wollte gleich wissen, woran er mit den beiden war. Seine direkte Art hatte er also nicht verloren.
„Meine Frau hat nicht übertrieben, als sie von der Hölle sprach, aber ich glaube, wir sollten das in Ruhe besprechen. Wir haben drei Monate gebraucht, um uns damit abzufinden, also lassen Sie sich ein wenig Zeit damit. Glauben Sie mir, das ist besser so. Übrigens, das ,Sie‘ können wir uns hier sparen, glaube ich. Andreas und Anita genügt vollauf.“ Der Mann lächelte und ging zum Wagen zurück, um eine Flasche Wasser zu holen.
„Bernd und Silvia“, stammelte Bernd hervor, während sein Gehirn auf vollen Touren lief, um zu begreifen, was Andreas gemeint haben könnte. Hatten sie kein Benzin oder wussten sie den Weg hier heraus nicht mehr? Er wollte jetzt keine blöden Fragen stellen und gab sich dem Genuss des Wassers hin, nachdem Silvia schon getrunken hatte.
„Es wird bald dunkel und wir sind in unserer Höhle sicherer. Sie ist groß genug für uns alle vier. Wollt ihr mitfahren?“
Man wusste nicht recht, ob es eine ernst gemeinte Frage war. Bernd beantwortete sie als solche, konnte sich aber einen gewissen Sarkasmus nicht verkneifen.
„Gerne – wir haben sowieso nichts vor. Oder möchtest du noch ein wenig shoppen gehen?“ Dabei sah er Silvia an.
Sie lachte nicht. Ihre Miene blieb todernst. „Sei nicht so blöd, Bernd. Steigen wir ein, und meine Schuhe würde ich noch gerne holen, wenn das geht“, sagte Silvia zu Andreas, der bereits hinter dem Lenkrad saß.
„Wo sind sie denn?“ fragte Andreas nach hinten, nachdem die neuen Freunde Platz genommen hatten.
„In einer der ersten Hütten – ich glaube in der dritten.“
Andreas brachte sie dorthin zurück.
Es war die dritte und Silvia kam freudig winkend heraus. „Falls wir einmal ausgehen wollen“, deutete sie beim Einsteigen auf die Stöckelschuhe in ihrer Hand.
„Euch zwei verbindet wohl der Humor“, bemerkte Anita, die bis jetzt nichts gesprochen hatte.
„Nicht nur Humor. Im Bett ist er auch nicht schlecht“, entgegnete Silvia, die sich wie jede Frau in der Gegenwart einer anderen hübschen Frau angegriffen fühlte.
„Ist es weit zu eurer Höhle?“, wollte Bernd wissen und beruhigte dadurch zugleich die Gemüter.
„Zehn Minuten mit dem Jeep. Wir haben nur Wasser geholt, sonst fahren wir nicht mehr mit dem Wagen. Ihr habt Glück gehabt. Wir wollen das Benzin sparen, für den Fall, dass wir doch noch einen Weg finden, hier rauszukommen. Wäre schließlich blöd, wenn wir dann keines mehr hätten“, erklärte Andreas, der sich auf die holprige Strecke konzentrierte. Eine Straße oder so etwas Ähnliches gab es hier nicht.
„Habt ihr euch verirrt? Ihr müsst doch ein Handy oder ein Funkgerät haben. Habt ihr keinen Kompass? Man fährt doch hier nicht zum Lunch her.“ Bernd wurde immer ungeduldiger.
„Lass uns in der Höhle reden. Ich muss mich jetzt konzentrieren, sonst kommen wir überhaupt nirgends mehr an. Wenn ich nicht Rallyefahrer wäre, würden wir schon auf dem Dach liegen.“ Bernd registrierte den ernsten Unterton, und so schwiegen sie für den Rest der Fahrt.
Der Wagen hob dabei einige Male richtiggehend ab, obwohl sie gar nicht so schnell fuhren. Bernd und Silvia hielten sich mit beiden Händen an den Türgriffen fest – die Sicherheitsgurte reichten ihnen nicht. Auf dem Beifahrersitz machte es Anita nicht anders. Am Ziel angekommen, waren sie neuerlich erschöpft und durchgeschwitzt.
„Das war’s, alles aussteigen!“ Andreas wirkte erleichtert.
Vor ein paar Stunden noch über den Wolken mit seinem besten Freund – nur mit einer Sorge: ob der nächste Strand den Frauen auch wirklich besser gefallen würde als der letzte. Und jetzt? Mit einem Rallyefahrer und seiner Frau in der Hölle. Nichts zu essen und anscheinend auch kein Weg aus der Misere. Tolle Zwischenbilanz, dachte Bernd und begutachtete die neue Unterkunft – es war tatsächlich eine geräumige Höhle.
„Ihr könnt zwei Schlafsäcke von uns haben. Wir haben vorsorglich vier mitgenommen, als hätten wir gewusst, was uns erwartet. Auf waagrechtem Grund aufgelegt sind die gar nicht einmal so schlecht. Ich habe hier auch keine schlimmeren Kreuzschmerzen als zu Hause, und ich schlafe jetzt schließlich schon seit drei Monaten in diesen blöden Säcken.“
Wieder so eine Bemerkung. Jetzt wollte Bernd es wissen: „Warum seid ihr drei Monate hier geblieben ohne weiterzufahren? Das verstehe ich nicht.“ Endlich war es ausgesprochen.
„Ich weiß nicht, ob du mir glauben wirst, aber ich kann es dir morgen beweisen. Hier gibt es kein Rauskommen. Wir sind gefangen!“, erklärte Andreas und seine Miene blieb dabei unverändert. Es war kein Scherz.
Bernd setzte sich auf einen der Schlafsäcke, die auf dem Boden lagen, und versuchte ganz ruhig und sachlich zu bleiben. „Ich will hier kein Frage-und-Antwort-Spiel betreiben. Erzähl uns jetzt eure Geschichte in Ruhe und zusammenhängend. Okay?“
„Gut, wenn du glaubst, alles auf einmal zu verkraften …“ Andreas und Anita setzten sich auf den Steinboden wie auf ein Sofa, und Silvia setzte sich zu Bernd auf den Schlafsack. Dann begann Andreas zu erzählen:
„Ich bin wirklich Rallyefahrer – das ist mein Beruf, und Anita ist auch begeisterte Tourenfahrerin. Vor über drei Monaten nahmen wir an einer Safari teil, wenn man es so nennen will. Es war eigentlich mehr eine Abenteuerfahrt ins Blaue. Wir waren vier Jeeps, die mit jeweils einem Pärchen besetzt waren. Das machen wir öfter, diesmal sollte es eben diese Steppe hier in Afrika sein. Das war nichts Besonderes für uns – vom Schwierigkeitsgrad haben wir schon weit gefährlichere Strecken bewältigt, aber das wird euch weniger interessieren. Zur Sache: Wir gerieten nach einem Drittel der Strecke in einen Sandsturm, und in weiterer Folge kamen wir von der Strecke ab. An und für sich ebenfalls nichts Schlimmes – das passiert. Man wartet das Ende des Sturms ab und schließt dann wieder zu den anderen auf, die meistens genauso abwarten. Diesmal hatte es wie durch ein Wunder nur uns erwischt. Die anderen fuhren anscheinend ungehindert weiter – nehme ich einmal an.
Als der Sturm einige Stunden später aufhörte, waren sie auf jeden Fall nicht mehr da. Wir waren allein. Im Sturm fällt das Handy – wenn es in dieser Gegend überhaupt funktioniert – meistens aus. Das ist ebenfalls nichts Ungewöhnliches. In unserem Fall funktionierte aber auch nach dem Sturm nichts mehr. Mit nichts meine ich wirklich nichts. Mein Kompass hat uns noch nie im Stich gelassen. Aber er funktionierte ebenso wenig wie das Funkgerät und das Handy. Der Motor unseres Wagens lief noch – das war alles. Wir versuchten die anderen und unsere ursprüngliche Strecke zu finden und landeten in diesem Dorf hier. Wir durchsuchten zuerst, so wie ihr es getan habt, die Hütten. Auch wir fanden vorerst keinen einzigen Menschen. Wie in einem Albtraum – der es mittlerweile auch geworden ist.“
„Lass die Anspielungen weg und erzähl uns bitte, wieso ihr noch hier seid.“ Bernd war es nun sehr ernst. Seine Geduld war fast aufgebraucht.
„Hier kommt niemand raus. Wir sind von einer unsichtbaren Mauer umgeben – gefangen, wenn du es genau wissen willst. Ob du es glaubst oder nicht, man kann offensichtlich hier herein, aber nicht wieder hinaus. Sonst wärt ihr ja nicht hier, oder?“ Andreas wirkte nicht mehr so freundlich und gelassen. Er war richtig überspannt. „Ihr werdet hier mit uns sterben – so sieht die tolle Geschichte aus, und Ende. Glaubt mir oder nicht – ist mir eigentlich egal. Es ist alles so verrückt und sinnlos – ich kann nicht mehr.“ Die letzten Worte würgte Andreas heraus und umarmte seine Frau. Er weinte.
Die Stille, die sich daraufhin ausbreitete, war unerträglich. Silvia flüsterte Bernd ins Ohr: „Der weint wirklich. Ist der Mann durch die Hitze verrückt geworden oder träumen wir das alles nur?“
„Das ist kein Traum“, sagte Anita, die anscheinend besser hören konnte, als sie zum Sprechen aufgelegt war. „Morgen werden wir es euch beweisen, und jetzt schlafen wir besser.“
Keiner wollte mehr nachsetzen und alle verkrochen sich in ihre Schlafsäcke. Nachdem die anderen zu seiner Verwunderung ziemlich schnell eingeschlafen waren, machte sich Bernd seine Gedanken. Obwohl er ebenso erschöpft war wie die anderen, hätte sein Gehirn Schlaf nie zugelassen. Nicht nach diesen Erlebnissen. Bis zum Morgengrauen dachte er nach.
BEGREIFEN
Ob er wenigstens kurz geschlafen hatte, konnte er nicht mit Sicherheit sagen, aber seine Neugier und der Überlebenstrieb hielten ihn hellwach. Bernd wollte hier raus, und damit meinte er nicht diese Höhle, sondern die ganze verdammte Gegend. Da stand doch ein fahrender Untersatz, und sie hatten Benzin, und wenn hier alle zu blöd waren, dann würde er eben selbst einfach losfahren. Immer gerade in Richtung Sonne, wie sie es in den Filmen machen. Damit man nicht im Kreis fährt, orientiert man sich nach der Sonne. Das würde er sicher schaffen – auch ohne Rallyeausbildung. Irgendwann musste man doch auf Menschen treffen, und das war dann das Ende dieser Geschichte – die Rettung. Bernd war fest entschlossen und teilte dies seinem Gegenüber jetzt auch mit.
„Ein neuer Tag, ein neuer Plan. Also, mein Freund, zeig mir bitte, warum wir hier gefangen sind. Vor der Höhle steht auf jeden Fall kein Wächter und gefesselt sind wir auch nicht“, sagte er zu Andreas, der gerade aufgewacht war und sich verschlafen aufsetzte.
„Du wirst noch Zeit genug haben, dich bei mir zu entschuldigen. Wir fahren gleich los. Zur Erinnerung: Ich bin nicht schuld an dem Ganzen hier. Ich nicht. Da waren höhere Gewalten am Werk.“ Andreas begann sich anzuziehen.
Zwanzig Minuten später saßen sie wieder im Wagen. Bernd musste unweigerlich an die Vier im Jeep denken – einen seiner Lieblingsfilme. Seine Gedanken spielten wieder einmal verrückt, aber das war eben so. Er war gespannt, was jetzt wohl kommen würde.
Silvia saß neben ihm und hatte ganz andere Sorgen. Sie hatte Hunger. Kein Bissen zu essen seit gestern und keiner machte Anstalten, über Nahrung zu sprechen – wahrscheinlich gab es keine. Aber irgendetwas mussten die zwei doch gegessen haben, sonst hätten sie nicht überlebt. Mit Wasser allein hält man doch keine drei Monate durch. Silvia behielt ihre Gedanken vorerst für sich und schwieg.
„Ob ich die Stelle wieder finde, an der ich die Kollision hatte, weiß ich nicht, aber ungefähr nach dem Baum da vorn kommt die Mauer oder wie ihr es nennen wollt“, erklärte Andreas nach einer zehnminütigen Fahrt in Richtung Sonne.
Andreas war anscheinend unbeabsichtigt Bernds Plan gefolgt, da er geradeaus auf die Sonne zufuhr. Er hielt den Wagen an und stieg aus. „Noch einmal fahre ich nicht dagegen. Beim ersten Mal hatte ich sehr viel Glück. Wir fuhren in einem spitzen Winkel auf und ich habe mir nur den Kotflügel eingedrückt. Frontal möchte ich keine Bekanntschaft mit diesem Ding machen.“ Er zeigte Bernd den linken vorderen Kotflügel, der komplett eingedrückt war und wie durch ein Wunder noch am Fahrzeug hing.
„Ich habe ihn ein wenig zurückgebogen, damit er nicht am Reifen streift. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Kommt, wir gehen zu Fuß weiter.“ Andreas zeigte wieder in Richtung Sonne.
„Ich bleibe hier, ich kenne diesen Wahnsinn ja schon.“ Anita blieb sitzen.
„Ich auch. Mit meinen Füßen schaffe ich sowieso keine großen Strecken mehr.“ Zur Bekräftigung zeigte Silvia ihre blutigen Zehen her.
„Schade, du versäumst etwas und wirst es vermutlich nicht glauben, wenn es dir dein Mann danach erzählen wird.“ Andreas wartete kurz, ob sie nicht doch noch mitkommen wollte.
„Ich glaube meinem Mann seit zehn Jahren alles. Mach dir da keine Sorgen. Ich bleibe hier.“ Silvia setzte sich als Zeichen, dass ihre Entscheidung unwiderruflich war, wieder in den Wagen. Bernd und Andreas gingen los.
„Ist es weit?“, fragte Bernd, als sie außer Hörweite der Frauen waren.
„Weiß ich nicht genau. Wie das Wort durchsichtig schon sagt: Man sieht die Mauer nicht!“ Andreas hob einen Ast vom Boden auf, den er wie eine Wünschelrute vor seinen Oberkörper hielt, als er wortlos weiterging.
Die Art dieses Mannes machte Bernd zu schaffen. Immer diese verwirrenden, kryptischen Ansagen und alles abwechselnd mit Resignation oder Spott vorgebracht. Ein wahrer Freund würde er wohl kaum werden. Also weiter im Programm, von undurchsichtigen Aussagen umgeben auf die durchsichtige Mauer zu, dachte Bernd und brachte sich dadurch wieder einmal selbst zum Schmunzeln.
Sie waren noch einige Minuten gegangen, als das Unglaubliche passierte. Ein lautes Knacken durchbrach die Stille, die entstanden war, nachdem die Unterhaltung abgerissen war. Bei der Hitze brauchte man auch jeden Atemzug, um sich fortzubewegen – dabei noch zu sprechen wäre zu anstrengend gewesen.
Andreas erschrak nicht weniger als Bernd, obwohl er damit gerechnet hatte. Er drehte sich zu Bernd um und hielt nur noch ein kleines Stück Holz in der Hand. Das Knacken war durch das Brechen des Astes erzeugt worden.
„Wieso hast du ihn abgebrochen?“, wunderte sich Bernd.
„Ich habe den Ast nicht abgebrochen, mein Lieber. Wir sind da.“
Für Bernd sah der Weg vor ihnen nicht anders aus als die Strecke, die sie bereits zurückgelegt hatten. Er konnte keinen Unterschied feststellen. „Was meinst du? Wo sind wir angekommen?“, fragte er.
„Am Ende unserer Freiheit. Hier geht es nicht mehr weiter. Der Ast ist an der unsichtbaren Barriere oder was immer es ist zerbrochen. Bitte, überzeug dich doch selbst.“ Andreas deutete Bernd, den Weg weiterzugehen.
Bernd folgte der Aufforderung und stieß Sekunden später mit dem Kopf und seiner rechten Schulter auf ein unsichtbares Hindernis. Wäre er ein wenig schneller gegangen, hätte er vermutlich einen Cut davongetragen – so wurde es nur eine kleine Beule auf der Stirn. Bernd schrie kurz auf, mehr durch den Schock als durch den Schmerz dazu veranlasst.
„Das gibt’s doch nicht. Was ist das?“ Mit beiden Händen tastete er das unsichtbare Hindernis ab. Es war glatt und fühlte sich an wie eine Glaswand. Er ging einige Meter die Wand entlang. So weit er sich auch nach oben streckte und bis zum Boden hinuntertastete – sie war da. Eine durchsichtige Wand! Er schlug mit der Faust dagegen, ohne ein Geräusch zu verursachen oder etwas zu verändern. Dann trat er mit seinen Füßen dagegen und erreichte ebenso wenig.
„Das habe ich alles schon probiert – und noch viel mehr. Da kommt nichts dabei raus. Sie hat keine Öffnungen oder Löcher. Wir sind gefangen. Das Ding dürfte sich in Kreisform um dieses kleine Dorf hier gebildet haben.“ Andreas stand jetzt neben Bernd und begutachtete dessen Verletzung. „Nur eine kleine Beule, Glück gehabt – glaubst du mir jetzt?“