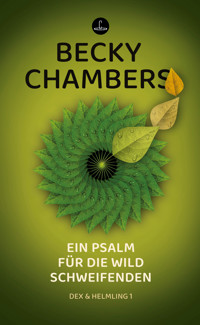12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
An der Wende zum 22. Jahrhundert macht die Wissenschaft eine bahnbrechende Entdeckung: Mittels einer revolutionären Methode namens Somaforming werden Menschen so verändert, dass sie auch im Weltall überleben können. Damit ist die letzte Grenze überwunden, und endlich brechen Raumschiffe zu extrasolaren Planeten auf, um herauszufinden, ob dort andere Lebensformen existieren. Ariadne befindet sich an Bord eines dieser Raumschiffe. Fünfzehn Lichtjahre von der Erde entfernt erforscht ihr Team potenziell bewohnbare Welten. Über die Wunder und Gefahren ihrer Reise schickt Ariadne Berichte an die Erde. Dort vergeht unterdessen fast ein Jahrhundert. Gelingt es ihr zu verhindern, dass sie dann nach Hause zurückkehren – und völlig vergessen sind? Becky Chambers ist die Poetin des Weltraumzeitalters. Wie keine andere Autorin weiß sie die Sehnsucht nach den Sternen mit Themen zu verknüpfen, die uns heute beschäftigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem
amerikanischen Englisch
übersetzt von Karin Will
Impressum
Titel der Originalausgabe: To Be Taught If Fortunate
Erstmals erschienen 2019 bei Hodder & Stoughton in London
© 2019 by Becky Chambers
© der Übersetzung 2025 by Karin Will
© dieser Ausgabe 2025 by Carcosa Verlag, Wittenberge
Alle Rechte vorbehalten
Carcosa Verlag ist ein verschwistertes Imprint von
Memoranda Verlag | Hardy Kettlitz | Ilsenhof 12 | 12053 Berlin
www.carcosa-verlag.de | www.memoranda.eu
Dieses Buch erscheint mit freundlicher Unterstützung des L.O.K.I. e. V., der den Metropol Con in Berlin ausrichtet.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherhheitsverordnung
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns ausdrücklich vor.
Lektorat: Hannes Riffel
Korrektorat: Anne-Marie Wachs
Umschlaggestaltung: s.BENeš [www.benswerk.com]
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz
ISBN: 978-3-910914-32-2 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-910914-33-9 (E-Book)
Für Emily, die das nicht lesen muss, mich aber auf die richtigen Gedanken gebracht hat.
BITTE UNBEDINGT LESEN
Selbst wenn ihr sonst nichts von alldem lest, was wir nach Hause schicken, lest wenigstens das hier. Während ich es schreibe, ist mir völlig klar, dass diese Bitte im Widerspruch zu meinen tiefsten Überzeugungen steht. Unsere wissenschaftlichen Ergebnisse sind in unseren Berichten enthalten, und diese Ergebnisse sind bei Weitem das Wichtigste. Die Besatzung des Raumschiffs ist zweitrangig. Drittrangig sogar.
Dennoch, es hängt wirklich viel daran, dass jemand diesen Bericht empfängt.
Ihr müsst euch nicht beeilen. Diese Datei wird, wenn sie die Erde erreicht, vierzehn Jahre alt sein, und selbst wenn wir Glück haben und sie sofort gelesen und beantwortet wird, dann wird diese Datei wieder vierzehn Jahre brauchen. Wir können zwar nicht ewig warten, aber die Dringlichkeit ist – wie so vieles in der Raumfahrt – relativ.
Wahrscheinlich könnt ihr auch direkt zum Ende springen. Ihr wärt nicht die Ersten, die das tun, und offen gesagt steht dort das, was uns am meisten betrifft. Und falls ihr schon wisst, wer wir sind und was wir tun – falls ihr vielleicht zu denen gehört, die uns hierhergeschickt haben –, dann könnt ihr das tun und werdet dennoch alles verstehen. Aber selbst in diesem Fall bin ich der Meinung, dass das Warum für unser Anliegen wichtig ist. Natürlich bin ich befangen, und das gleich in doppelter Hinsicht: Es geht in diesem Bericht nicht nur um die Besatzung der Merian, sondern wir sind auch Wissenschaftler. Die Frage nach dem Warum ist unser Lebenselixier.
Es ist jetzt fünfzig Jahre her, seit wir die Erde verlassen haben, und ich weiß nicht, wem die Augen oder Ohren gehören, die diese Botschaft erreichen wird. Mir ist klar, wie sehr sich eine Welt binnen einer Lebensspanne verändern kann. Beweggründe schwanken, Erinnerungen verblassen. Auch habe ich keine Ahnung, wie viel du ganz persönlich über das Universum jenseits von unserem Heimatplaneten weißt. Vielleicht gehörst du zu den oben erwähnten wohlunterrichteten Leuten, kannst die Geschichte der Raumfahrt schneller herunterrattern als ich und verfolgst die gleichen Ziele. Oder du bist jemand, der außerhalb meiner Blase lebt. Vielleicht ist das alles ja Neuland für dich. Weißt du, was ich meine, wenn ich Begriffe wie »Exoplanet« oder »Roter Zwerg« verwende? Damit will ich dich nicht auf die Probe stellen, und ich finde es auch nicht weiter schlimm, wenn dir diese Begriffe nichts sagen. Im Gegenteil, es liegt mir ebenso viel daran, mich dir verständlich zu machen wie den Fachleuten – eher sogar noch mehr. Wenn ich meine Bitte nur an Menschen richte, die ohnehin auf meiner Seite stehen, die meinen Traum und meine Sprache teilen, dann ist sie von vornherein sinnlos.
Aus diesem Grund werde ich mich bemühen, sowohl Fachleute als auch Laien anzusprechen. Ebenso scheint es mir wichtig, von vorne anzufangen, um unsere Situation als Ganzes zu verdeutlichen. Ich bezweifle, dass mein Bericht objektiv sein wird. Ich werde mir fast sicher widersprechen.
Allerdings verspreche ich, die Wahrheit zu sagen.
Mein Name ist Ariadne O’Neill, und ich bin die Bordingenieurin des OCA-Raumschiffs Merian. Außerdem gehören der Besatzung die Missionsspezialisten Elena Quesada-Cruz, Jack Vo und Chikondi Daka an. Wir sind Teil des Lawki-Programms, einem Programm zur umfassenden ökologischen Erforschung der Exoplaneten – Planeten außerhalb unseres Sonnensystems –, bei denen sicher ist oder vermutet wird, dass es auf ihnen Leben gibt. Unsere Mission (Lawki 6) konzentriert sich auf die vier bewohnbaren Himmelskörper, die um den Roten Zwerg Zhenyi (BA-921) kreisen: den Eismond Aecor und die erdähnlichen Planeten Mirabilis, Opera und Votum. Derzeit bin ich auf Letzterem stationiert.
Ich wurde am 13. Juli 2081 in Cascadia geboren. An jenem Tag war es fünfundfünfzig Jahre, acht Monate und neun Tage her, seit ein Mensch ins All geflogen war. Ich war die zweihundertvierte Person, die wieder dorthin aufbrach, und gehörte zur sechsten extrasolaren Besatzung. Ich schreibe diese Zeilen in der Hoffnung, dass wir nicht die Letzten sein werden.
AECOR (UND DIE ERDE)
Ich habe nie eine Erde gekannt, die nichts von außerirdischem Leben wusste. Neunundzwanzig Jahre vor meiner Geburt entnahm die Cetus-Sonde den Geysiren Europas Proben, die voller Bakterien waren; die ersten Geländewagenfotos von den fossilen Gliederfüßlern auf dem Mars trafen ein, als meine Eltern noch in der Ausbildung waren. Ich weiß nicht, wie es in den einsamen Jahren davor war, als wir die Erde für eine singuläre Zufluchtsstätte hielten, eine Oase in der galaktischen Wüste. Manchmal wünschte ich, ich wüsste es. Ich wünschte, ich hätte dabei sein können, als die ersten Ergebnisse von Cetus per Funk durchgegeben wurden. Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, wie es in einem der alten Kontrollzentren oder den Forschungslaboren oder Nachrichtenredaktionen zuging, als wir gemeinsam mit dem gesamten Planeten in Echtzeit erfuhren, dass uns unser enges Weltbild auf das Prachtvollste um die Ohren geflogen war. Am Anfang meines Lebens jedoch, nur dreißig Jahre später, war extraterrestrisches Leben Allgemeinwissen – etwas, das für jedes Kind selbstverständlich war. Menschen sind ungemein anpassungsfähig.
Noch ein Wunsch: euch erzählen zu können, dass ich schon immer Astronautin werden wollte. Das wäre doch eine viel bessere Geschichte, nicht wahr? Ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen könnten (und können) das von sich sagen. Ein ganzes Leben, ins Rollen gebracht vom Anblick der Saturnringe durch ein Straßenteleskop oder von verbissener Zielstrebigkeit, inspiriert von dem Moment, in dem der Betreffende die ersten verschwommenen Bilder eines wolkengesprenkelten, blaugrünen Exoplaneten sah. Keine dieser Erzählungen kann ich für mich beanspruchen. Ich war vier, als uns die Fotos des Tarter-Raumteleskops erreichten, und weiß tatsächlich noch, wie sie mir gezeigt wurden. Meine Mutter nahm mich vor ihrem Tablet auf den Schoß. Ihre Stimme war leise vor Staunen, und sie hielt mich ganz fest.
»Schau, Liebling«, sagte sie. »Das ist ein Planet, der um einen anderen Stern kreist. Da gibt es Luft und Ozeane, genau wie bei uns.«
Meine Antwort darauf ist der Zeit und der Unzuverlässigkeit der Erinnerung zum Opfer gefallen, aber ich kann mich noch an mein völliges Desinteresse erinnern. Das Bild war langweilig, und was mir dazu erklärt wurde, mochte zwar neu und ganz interessant gewesen sein, aber ich war vier. Neu und ganz interessant traf auf etwa neunzig Prozent meines Lebens zu – von dem Schorf auf einer Wunde über einen neuen Zeichentrickfilm bis zum unerwarteten Geschmack des Safts beim Mittagessen. Es ist schwer, neue Entdeckungen wertzuschätzen, wenn man die Grundlagen der Wirklichkeit noch nicht kennt. Und so fiel die Bedeutung des ersten fotografischen Beweises eines bewohnbaren Exoplaneten bei mir auf unfruchtbaren Boden. Wahrscheinlich ist jede Kindheit voller Fehleinschätzungen.
Meine Eltern lebten in einer Wohnung im zwölften Stock einer Wohnanlage mit Blick auf den Fraser. Das klingt schöner, als es war. Ich kannte nur das Gewimmel der Großstadt, und mein Zugang zur Natur beschränkte sich auf die Hydrokulturbehälter unseres kastenförmigen Balkons, wo mein Vater das Gemüse zog, das wir abends aßen. Ein Hydrokulturbehälter hat mit der echten Natur nur wenig gemeinsam, aber er ist dennoch ein Ökosystem. Oft saß ich stundenlang dort draußen in der heißen Stadtluft, fasziniert von den Insekten, die ihrerseits von Dingen angezogen wurden, die grün sind und wachsen. Sie waren ein kleines Wunder, diese Tierchen – winzige, erstaunliche Ungeheuer, die überhaupt nicht zu den uns umgebenden Betonblöcken passten, Miniaturtiere, die mir wie Magie vorkamen und weit wilderen Orten angehörten, als es die Paprikapflanzen meines Vaters waren. Da waren Käfer und Bienen, Spinnen und Raupen. Ich beobachtete, wie sie von einem Blatt zum anderen flogen oder sich abseilten. Ich ließ sie über meine Handfläche krabbeln. Ich staunte darüber, wie etwas so Kleines an einen Ort gelangt war, der selbst für mich, die im Vergleich zu ihnen eine Riesin war, unfassbar hoch oben lag. Sie hatten ihre eigenen Dramen, ihre eigenen Ziele. Sie brauchten mich nicht, wie es bei einem Hund oder einem Goldfisch der Fall gewesen wäre. Diese Unabhängigkeit, diese völlige Losgelöstheit vom Reich der Menschen gefiel mir am besten an ihnen.
Manche Insekten werden gleichsam zweimal geboren. Zuerst wird ein Ei gelegt. Eier sind für die meisten irdischen Spezies der vorgezeichnete Weg, und bei größeren Tieren, die sich auf diese Weise fortpflanzen, ist die Sache einfach. Das Ei bricht auf, das Jungtier – sagen wir: ein Entenküken – schlüpft, und äußerlich unterscheidet es sich nicht sonderlich von seinen Eltern. Ein Entenküken ist immer noch als Ente erkennbar. Es wird wachsen, in die Pubertät kommen und seinen niedlichen Flaum verlieren, aber es schwimmt und watschelt und pickt. Bei Insekten ist der Vorgang komplizierter. Nehmen wir beispielsweise einen Nachtfalter. Aus dem Ei schlüpft eine Larve, die wir als Raupe kennen. Dieses Wesen hat Beine, Organe, eine Mundöffnung – alles, was ein Lebewesen braucht. Die Raupe ist perfekt an ihre derzeitigen Bedürfnisse angepasst, die darin bestehen, alles zu fressen, was ihr vor die Nase kommt, und sich von Feinden fernzuhalten. Sie kriecht und frisst und kriecht und frisst und kriecht und frisst, bis sie eines Tages damit aufhört. Sie sucht sich einen Zweig oder ein Blatt. Sie hüllt sich in ein schützendes Proteinnetz ein. Und dann löst sie sich unglaublicherweise auf. Die Raupe zerfällt zu organischem Schleim, und nur einige wenige, wesentliche Bestandteile bleiben intakt. Binnen einiger Wochen setzt sich der Schleim neu zusammen und erschafft dabei eine völlig neue Gestalt. Sobald das Tier seinen Körper erneuert hat, schlüpft es abermals, und ein Wesen kommt zum Vorschein, das sich so sehr von seiner vorherigen Gestalt unterscheidet, dass man, hätte man die Metamorphose nicht mitangesehen, vernünftigerweise davon ausgehen würde, dass Raupe und Motte zwei verschiedene Spezies sind.
Vielleicht konnte ich damals mit bewohnbaren Exoplaneten nichts anfangen, aber bei der Metamorphose war das anders. Die Veränderlichkeit der äußeren Erscheinung ist in meinen Augen immer etwas Wunderbares gewesen.
Aus dem Kälteschlaf zu erwachen, gehört nicht zu den Dingen, die ich besonders gern mache. Auf einer Skala des Unwohlseins würde ich es mit einem leichten Kater vergleichen oder mit der Sorte Erkältung, bei der die Nebenhöhlen knacken, wenn man mit der Hand daraufdrückt. Die Wahrnehmung an sich lässt sich mit keiner dieser beiden Erfahrungen vergleichen. Rein körperlich fühlte ich mich etwas steif, ein bisschen schwach, aber ansonsten okay. Aufzuwachen ist eher psychisch unangenehm, eine Phase, in der sich das Bewusstsein nach jahrelanger Untätigkeit erst wieder zurechtfinden muss. Ihr dürft nicht vergessen, dass die medikamentös induzierte Kältestarre nicht das Gleiche ist wie Schlaf. Im Schlaf erlebt man, wie die Zeit vergeht, selbst wenn man nicht träumt. Nicht so beim Kälteschlaf. Man ist erst wach, dann wieder nicht, dann doch wieder … Aber etwas fehlt, und es lässt sich nie genau bestimmen, was das ist.
Sobald die Merian in die Umlaufbahn um ihr erstes Ziel eingetreten war, schickte der Navigationscomputer ein Signal an die Kälteschlafkammern der Besatzung. Ein automatisiertes System fügte unserer Nährlösung eine chemische Substanz bei, die anschließend in unsere Gehirne gelangte, wo sie uns ganz langsam weckte. Soviel ich weiß, dauert dieser Vorgang etwa eine Stunde, aber für mich geschah es innerhalb eines Augenblicks. Licht. Schatten. Verwirrung. Ich musste mir die grundlegendsten Dinge ins Gedächtnis rufen, ganz so, als würde ich alles rekapitulieren, was ich in meiner Kindheit gelernt hatte. Ich habe Hände. Ich habe einen Mund. Was ich da sehe, sind Farben. Ich bin Ariadne. Ich existiere. Dann kamen die Erinnerungen und Zusammenhänge und schließlich ein Lächeln.
Wir sind auf Aecor.
Nach und nach befreite ich meinen Geist von der sprichwörtlichen Watte und brachte die vorgeschriebene Prozedur hinter mich. Als Erstes zog ich an den Schlaufen, um meine Handgelenke von den weichen Stoffhalterungen zu befreien, dann löste ich die Fesseln um Taille und Fußknöchel. Es mag makaber klingen, gefesselt in etwas zu liegen, das letzten Endes eine Hightech-Transportkiste ist, aber die Gurte sind aus gutem Grund da und lassen sich im Handumdrehen entfernen. Sie sind fest in den Wänden der Kälteschlafkammer verankert, sodass ich im Zustand der Bewusstlosigkeit in der Mitte des Containers schwebe und nicht gegen die Wände stoße. Das ist viel besser, als voller blauer Flecken aufzuwachen.
Sobald ich meine Gliedmaßen bewegen konnte, drückte ich auf den Knopf, der die Tür zur Kammer öffnete. Das Licht in meiner Kabine war gedämpft, aber ich zuckte dennoch zusammen, während meine Augen sich daran erinnerten, wie sie sich anpassen mussten. Kälteschlafkammern waschen ihre Bewohner regelmäßig, aber täglich mit Reinigungslösung besprüht zu werden, ist nicht das Gleiche wie ein richtiges Bad. Meine Augen, meine Nase und mein Mund waren um die Ränder herum völlig verklebt. So ist das, wenn man sich achtundzwanzig Jahre lang nicht richtig wäscht.
Meine Haare, die ich mir vor dem Start abrasiert hatte, reichten mir jetzt ein gutes Stück über die Schultern. Auch meine Nägel waren furchtbar lang geworden – in etwa so, wie man es nach zwei Jahren ohne Nägelschneiden erwarten würde. Ungefähr so viel war ich in den achtundzwanzig Jahren Flug gealtert – zwei Jahre. Der Kälteschlaf fährt einen runter, und eine interstellare Reise bei halber Lichtgeschwindigkeit lässt die Uhr noch langsamer laufen, aber ohne die Pausetaste ganz zu drücken. Zellteilung und Herzschlag gehen weiter. Wir erkaufen uns im Kälteschlaf Zeit, nicht die Unsterblichkeit.
Ich öffnete das Hygienekit, das ein cleverer Einrichtungsingenieur an eine Wand geschraubt hatte, die sich in Reichweite meiner Hände befand. Als Erstes zog ich den Nagelknipser heraus, gefolgt von einem winzigen Sammelbeutel. Ich kürzte meine Nägel und machte meine Finger wieder einsatzfähig. Gekrümmte Keratinschnipsel schwebten wenig appetitlich vor meinem Gesicht, und ich verstaute sie so schnell wie möglich in dem kleinen Beutel. Mein wirres Haar würde warten müssen, aber ich entnahm dem Kit ein Gummi und band mir die Locken, die mir wie einer Meerjungfrau um den Kopf schwebten, hinten zusammen. Die Arbeitsgruppen auf der Erde denken wirklich an alles.
Stück für Stück entfernte ich die Elektrodenpflaster, die mich von Kopf bis Fuß bedeckten. Ihre regelmäßigen Stromstöße hatten meine Muskeln vor dem Schrumpfen bewahrt, wofür ich wirklich dankbar war. Als Nächstes löste ich den Zugang für die Nährlösung von meinem Arm, legte einen Verband an und fing die wenigen Blutstropfen ein, die davongeschwebt waren. Dann atmete ich tief durch, dachte mir sicherheitshalber ein paar therapeutische Flüche aus und entfernte den Katheter von dort, wo Katheter hineinführen.
Wie glamourös ist doch die Raumfahrt!
Ich hörte das leise Geraschel, mit dem die anderen Besatzungsmitglieder gerade die gleiche Aufwachprozedur hinter sich brachten. Die Wände an Bord der Merian sind dünn, aber immerhin gibt es Wände, und das ist wichtig. Ich habe Bilder aus alten Filmen gesehen, in denen die Besatzung eines Raumschiffs in den Kälteschlaf versetzt wird, aber die Kammern oder Kapseln oder was auch immer liegen immer genau nebeneinander – trostlose Reihen von Behältern, die an Leichenschauhäuser erinnern. Um es deutlich zu sagen: Wenn man nach fast dreißig Jahren künstlicher Bewusstlosigkeit aufgeweckt wird und alle Körperöffnungen klebrig sind, die Nägel wie Klauen aussehen, die Haut wie eine Mischung aus frisch geputztem Krankenhausflur und Raubtiergehege riecht und man gerade einen urinfeuchten Schlauch aus sich herausgezogen hat … dann will man unbedingt kurz allein sein. Und da reden wir erst mal nur von Hygiene und Eitelkeit. In dieser Phase gibt es aber noch einen psychologischen Aspekt, der sogar noch wichtiger ist.
Der Spiegel.
Sobald man sich erinnert hat, wer und was man ist und wo man sich befindet, ist die erste Regung nach dem Kälteschlaf, zu schauen. Aber so wie das Erwachen nach einem chirurgischen Eingriff verstörend sein kann, können es auch diese ersten Sekunden sein, in denen man seinen modifizierten Körper wahrnimmt. Man sieht anders aus. Man braucht ein bisschen, um sich darauf vorzubereiten, und wahrscheinlich etwas länger, um es zu verarbeiten, und das alles will man nicht in der Gruppe absolvieren. Deshalb gibt es in jeder Astronautenkabine einen Ganzkörperspiegel, der einem ganz allein gehört. Der Spiegel ist nicht gegenüber der Kälteschlafkammer angebracht, sondern an der Wand rechts davon, außerhalb des eigenen Blickfelds, aber sichtbar, sobald man beschließt, vorwärts zu schweben. Der Spiegel weiß, wie dringend man sich sehen will, aber er sagt: Lass dir Zeit. Ich bin hier, wenn du bereit bist, und keine Sekunde früher. Mir ist kein Gegenstand bekannt, der je so rücksichtsvoll platziert worden wäre.
Für den Fall, dass unsere Methoden in Vergessenheit geraten sind oder falsch dargestellt wurden – oder ihr einfach noch nie davon gehört habt –, will ich kurz über Somaforming sprechen.
Über Homo sapiens kann man sagen, was man will, aber wir sind unbestreitbar eine vielseitige Spezies. Auf der Erde können wir eine beträchtliche Bandbreite von Hitze wie Kälte aushalten. Wir verzehren eine verblüffende Vielfalt von Flora und Fauna und können unsere Ernährung radikal umstellen, je nach Bedarf und Stimmung. Wir können Wüsten, Wälder, Tundren, Sümpfe, Ebenen, Gebirge, Täler, Küsten und alles dazwischen bewohnen. Ganz ohne Frage, wir sind Generalisten.
Aber sobald man uns von unserem Heimatplaneten wegnimmt, ist es vorbei mit dieser Anpassungsfähigkeit. Raumfahrt über längere Zeit ist Gift für den menschlichen Körper. Ohne die Herausforderung der Schwerkraft hören Knochen und Muskeln schnell auf, in die verbleibende Masse zu investieren. Das Herz wird faul und pumpt weniger Blut. Der Augapfel verändert seine Form, was zu Sehproblemen und Kopfschmerzen führt. So unangenehm diese Beschwerden sind, sie sind ein Klacks im Vergleich mit dem Ansturm der Strahlung, von der die scheinbare Leere erfüllt ist. In den frühen Jahrzehnten der Raumfahrt genügten sechs Monate in der erdnahen Umlaufbahn – kaum dreitausend Meter über dem Meeresspiegel –, um das Krebsrisiko insgesamt erheblich zu steigern. Je weiter man in den interplanetaren Raum vordringt und sich von den sanften Gestaden der Atmosphäre entfernt, desto stärker wird die Belastung.
Aus diesem Grund wurde die bemannte Raumfahrt jahrzehntelang eingestellt – wegen der einen technologischen Nuss, die niemand knacken konnte: Wie lassen sich Menschen im All lange genug am Leben halten, um einen anderen Planeten zu erreichen? Wir tüftelten an der Entwicklung von Hilfsmitteln, die tun konnten, wozu unsere Anatomie nicht in der Lage war. Wir zerbrachen uns die Köpfe über Algorithmen, um künstliche Intelligenz zu erschaffen, die an unserer Stelle zu fremden Welten vorstoßen sollte. Aber unsere Maschinen waren unzulänglich, und unsere Software erwachte nie zu Bewusstsein. Wir wussten, dass es auf anderen Planeten Leben gab, aber es gelang uns nicht, unseren eigenen Vorgarten zu verlassen. Und auch wenn Sonden und Raumteleskope uns immer mehr Informationen über unsere galaktische Nachbarschaft lieferten, ist das, was man durch ein Guckloch sieht, begrenzt. Um einen Ort wirklich zu erkunden, braucht man Bodentruppen. Man braucht menschliche Intuition. Man braucht Augen, die erkennen, wenn ein vermeintlicher Stein womöglich mehr ist als das.
Als die Wissenschaft erst einmal so weit war, erwies es sich als sehr viel einfacher, stattdessen unsere Körper umzubauen.
Letzten Endes haben wir nicht viel modifiziert – nichts, was uns entstellen oder aus dem Reich des Menschlichen verbannen würde, und nichts, was mein Denken, mein Handeln oder meine Wahrnehmung verändert. Tatsächlich ist nur eine kleine Anzahl genetischer Modifizierungen möglich, und keine davon ist von Dauer. Immerhin besteht der Körper eines erwachsenen Menschen aus Milliarden von Zellen, und wenn die behutsam vorgenommenen Änderungen nicht ständig aufrechterhalten werden, dann kehren die Zellen während ihrer natürlichen Erneuerung entweder wieder zu ihrer ursprünglichen Form zurück, oder sie mutieren bösartig. Deshalb das Enzympflaster: ein synthetisches, hautähnliches Verabreichungsverfahren, das unseren Körper mit den kleinen Extras versorgt, die wir zum Überleben auf fremden Welten benötigen. Ohne die Pflaster würde mein Körper die Modifikationen irgendwann abstoßen, und ich wäre wieder diejenige, die ich war, bevor ich Astronautin wurde (mit den Jahren und den Erinnerungen).
Somaforming ist eine elegante Lösung, aber sie lässt sich nicht im Handstreich umsetzen. Falls Enzympflaster in der Medizin noch Verwendung finden, wisst ihr das bereits – zum Beispiel, wenn ihr unter Diabetes leidet und euer Körper von sich aus kein Insulin produziert. Aber falls ihr noch nie ein Pflaster hattet (oder diese inzwischen überholt sind), dann stellt ihr euch das Ganze vielleicht dramatischer vor, als es tatsächlich ist. Bei einer Informationsveranstaltung unterhielt ich mich einmal mit einem Jungen, der sehr enttäuscht war, als er erfuhr, dass ein Pflaster keine sofortige Transformation zur Folge hat (inklusive Sound- und Videoeffekten, nehme ich an). Wir Astronauten sind weder Superhelden noch Gestaltwandler. Wir sind Menschen wie ihr. Unser Körper ist zwar erstaunlich wandelbar, aber wir brauchen Zeit, um uns anzupassen. Lebensrettende Organtransplantate oder wirkungsvolle Medikamente haben oft mit einem gewissen Maß an physiologischem Widerstand zu kämpfen; für Somaforming gilt das Gleiche. Es ist weit angenehmer, wenn man bewusstlos ist, während der Körper alles von selbst erledigt.
Um es noch einmal zu sagen: Ich bin denkbar voreingenommen, aber ich halte Somaforming für die in ethischer Hinsicht beste Herangehensweise, wenn jemand die Erde verlassen will. Meine Aufgabe ist es zu beobachten, nicht zu erobern. Mir liegt nichts daran, andere Welten zu verändern, um sie für mich passend zu machen. Ich wähle die sanftere Methode: Ich verändere mich selbst, um mich ihnen anzupassen.
Als ich auf Aecor aufwachte, sah ich auf den ersten Blick kaum anders aus als früher. Das Enzympflaster auf meiner Schulter – von einem zweckdienlichen automatischen Mechanismus während des Kälteschlafs regelmäßig gewechselt – hatte mich mit dem Basismedikament für Astronauten versorgt, das ich schon seit meiner ersten Trainingsmission in der erdnahen Umlaufbahn bekam. Mein Blut produziert sein eigenes Frostschutzmittel, um die extremen Temperaturen im All und auf den Planeten zu überleben. Meine Haut absorbiert passiv Strahlung und wandelt sie in Nahrung um. Diese Modifikationen habe ich schon lange. Aber während mein gewichtsloser Körper durch die Mikroschwerkraft schwebte wie Seetang in einer ruhigen See, machte sich eine neue Modifikation bemerkbar.
Glitter.
Mir fällt mindestens ein Labortechniker zu Hause ein, der diese Bezeichnung missbilligen würde. Genau genommen verfügte ich über synthetisches Reflectin, ein Protein, das sich in der Natur bei bestimmten Tintenfischarten findet. Aber lasst mir doch den Spaß. Es ist Glitter. Meine Haut glitzerte, und für einen Moment verspürte ich kindliche Freude – als hätte ich einen Berg Bastelkram über mir ausgekippt, als hätte ich mir zu Karneval das Gesicht geschminkt, als wäre ich in einer Wolke Feenstaub hierher geflogen. Aber der Astro-Glitter hatte eine praktische Funktion. Aecor ist etwa so weit von seinem Gestirn entfernt wie Uranus von unserem, weshalb die Sonne, die am Himmel steht, nicht größer als ein Fingerabdruck ist. Tag und Nacht unterscheiden sich nur unwesentlich voneinander. Glitter erfüllte für uns hier den gleichen Zweck wie zu Hause bei den Meerestieren: Es fing das Licht ein und reflektiert es. Während der Arbeit trugen wir zwar überwiegend Kleidung, aber es schadet nicht, wenn man vor einer stockfinsteren Eisfläche die glitzernden Gesichter der anderen Besatzungsmitglieder sehen kann. Außerdem konnten wir auf besagten stockfinsteren Eisflächen Arbeitslampen nur eingeschränkt verwenden, denn Licht bedeutet Wärme, und wir wollten nicht, dass das Eis schmolz. Und an Bord des Raumschiffs bedeutet Reflectin weniger Energie für die Innenbeleuchtung, was großartig ist auf einem Planeten, wo Sonnenkollektoren nutzlos sind und alles mit Akkus betrieben wird.
Und davon abgesehen: Ichglitzerte. Ich fand, dass es eine Affenschande war, mich anzuziehen, aber ich schaffte es trotzdem.
Chikondi sah ich an jenem Tag als Erstes, und sein Gesicht erschreckte mich viel mehr als mein eigenes. In meiner Erinnerung hatte ich mich vor etwa einer Stunde von ihm verabschiedet, aber da war er, mit schmutzigem Gesicht und Glitter auf der Haut … und sichtlich gealtert. Er ist der Jüngste von uns, und diese zwei Jahre machten sich im Gesicht eines Menschen, der Mitte zwanzig war, weit stärker bemerkbar. Dünner war er auch, und ich ebenso, aber ich hatte mich geistig so lange darauf vorbereitet, wie anders ich sein würde, dass ich nicht bedacht hatte, wie sehr sich meine Freunde wohl verändern würden.
Chikondi schien es genauso zu gehen, denn er starrte mich kurz an, bevor er die peinliche Situation mit einem Lachen überspielte. »Guten Morgen«, sagte er.
»Guten Morgen«, erwiderte ich. »Gut geschlafen?«
»Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe meinem Bruder geholfen, eine riesige Bibliothek neu zu organisieren, und in den Büchern stand nur Kauderwelsch, und plötzlich habe ich gemerkt, dass es gar keine Bücher waren, sondern Kuchen …«
Ich runzelte die Stirn. Eigentlich hätte sein Bewusstsein gar nicht aktiv sein dürfen. In Gedanken begann ich durchzugehen, was es damit auf sich haben könnte – was in der Kammer schiefgelaufen sein mochte, die Fehlfunktionen, die ich bei der Inspektion offenbar übersehen hatte, die unvorhersehbaren Folgen, die das womöglich für sein Gehirn haben würde …
Chikondi lächelte mich verschmitzt an. »Ich mache nur Spaß, Ariadne.« Wieder lachte er.
Ich knuffte ihn leicht gegen die Schulter, senkte den Kopf, schwebte an der Leiter vorbei und zog mich mit den Händen an den Wänden entlang. »Dann geht’s dir also gut, ja?«