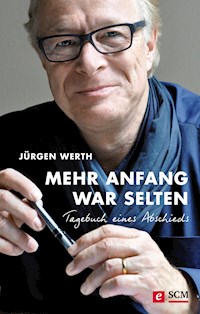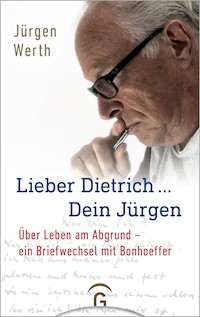5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
»Bleiben Sie offen für Überraschungen!« (Jürgen Werth)
Leinen los und leben – auch das kann ein Motto für das Älterwerden sein. Nicht mehr so angebunden sein, loslassen und freier werden für das Neue, das vor einem liegt. Jürgen Werth versucht sein Älterwerden in genau dieser Weise wahrzunehmen, zu verstehen und zu leben.
Hier erzählt er, was er dabei entdeckt.
Ein heiter-nachdenkliches Buch voller Inspiration und Lebensklugheit.
- Loslassen und Freiheit gewinnen
- Ein kluges Buch vom bekannten Liedermacher und Autor Jürgen Werth
- Heiter, lebensklug, inspirierend und ermutigend
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jürgen Werth
... und immer ist
noch Luft nach oben!
Entdeckungen beim
Älterwerden
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2018 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umsetzung E-Book: Greiner & Reichel, Köln
Coverfoto: © Lea Weidenberg
ISBN 978-3-641-22629-9V003
www.gtvh.de
INHALT
Vorsatz
1 Einführung
2 Die Jahreszeiten des Lebens
3 Das Leben ist eine Wundertüte
4 Da geht noch was
5 Sich einmischen
6 Jüngeren zur Seite stehen – und die Älteren nicht vernachlässigen
7 »Dann will ich mich mal überraschen lassen«
8 Reisen ist gut, pilgern ist besser
9 Neues gibt es nur im Neuland
10 Die Ruhestandskrise
11 Rechtzeitig aufhören
12 Ballast abwerfen – besitzen, nicht besessen werden
13 Menschen loslassen
14 Menschen (auf)suchen
15 Alt werden heißt nicht nur schwächer und kränker werden
16 Mit dem großen und kleinen Scheitern leben
17 Sich versöhnen mit seiner Geschichte
18 Seine Geschichte aufschreiben
19 Sich nicht sorgen
20 Aber vorsorgen
21 Regelmäßig Erntedankfest feiern
22 Loslassen und gelassen werden
23 Den Augenblick leben und lieben
24 Die Sehnsucht nach Heimat wird größer
25 Luft nach oben – am Ende aller Wege
26 Zum guten Schluss: Plus und Minus des Älterwerdens
Anmerkungen und Quellennachweise
VORSATZ
»Ich will nicht ein alter Polterer werden,
der aus Neid die jüngeren Geister ankläfft,
oder ein matter Jammermensch,
der über die gute, alte Zeit beständig flennt«.
Heinrich Heine1
1 EINFÜHRUNG
Ich werde älter. Jeden Tag. Blöd eigentlich. Aber auch schön. Ich kann und darf manches nicht mehr. Ich muss aber auch manches nicht mehr. Dafür kann und darf und muss ich anderes, Neues.
Wir werden älter. Und das gleich im doppelten Wortsinn. Wer im 18. oder 19. Jahrhundert gelebt hat, wurde oft nicht viel älter als 50. Heute werden 13 Prozent aller Frauen 100. Die durchschnittliche Lebenserwartung neugeborener Mädchen liegt mittlerweile bei 92,8 Jahren, die von Jungen bei 87,8.
Als ich ein kleiner Junge war, war Onkel Gustav der Methusalem der Familie. Grauer Bürstenschnitt, schwarzer Anzug und ein bisschen wackelig auf den Beinen. Klar. Er war 80. Ein alter Mann. Ein Senior. Heute würde sich Onkel Gustav vielleicht dreimal überlegen, ob er eine Einladung zum Seniorenkreis annimmt. Man hört das ja nicht selten von 80-Jährigen: »Da geh ich noch nicht hin. Da sind doch nur alte Leute!«
Alt ist heute älter. Alt war früher jünger. Noch viel früher noch viel älter.
Legendär ist die Anekdote von der Anrede, die der Rektor der Universität Königsberg wählte, als er Immanuel Kant (1724-1804) zu dessen 50. Geburtstag gratulierte: »Verehrter Greis«. Auch wenn diese Geschichte nicht belegt ist – sie entspricht dem Denken der Zeit damals. Mit 50 warst du alt, irgendwie, mit 60 uralt.
Da passt das, was Baccalaureus im 2. Teil von Goethes Faust reimt:
»Gewiss! das Alter ist ein kaltes Fieber
Im Frost von grillenhafter Not.
Hat einer dreißig Jahr vorüber,
So ist er schon so gut wie tot.«
Na ja, das hat Goethe dann doch wohl nicht so richtig ernst gemeint. Schließlich ist er selber über 80 geworden. Von 1749 bis 1832 hat er gelebt. Und diese Verse hat er erst in seinen letzten Jahren gereimt.
Und Heinrich Heine? Der also, dessen Zitat sie zu Beginn des Buches ein bisschen unvermittelt begrüßt hat? Nein, er ist wohl kein alter Polterer geworden. Er war nicht einmal 60, als er am 17. Februar 1856 in Paris starb. Gerade noch rechtzeitig, könnte man zynisch anmerken. Aber offenbar waren für ihn alte Männer vor allem das gewesen: Kläffende Polterer, matte Jammermenschen. Gequält vom Neid, dass sie auf dem Karussel der Jüngeren nicht mehr mitfahren dürfen.
Alte. Und Junge. Ein steinaltes und immer junges Thema. Nicht immer verstehen sie einander. Aber, was wir tun können, wir älter Gewordenen, das wollen wir tun. Wenigstens wollen wir es versuchen.
Ich liebe dieses Gebet einer alten Äbtissin, das Theresa von Avila zugeschrieben wird:
»Herr, du weißt es besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der großen Leidenschaft, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. Lehre mich nachdenklich, aber nicht grüblerisch zu sein. Hilfsbereit, aber nicht diktatorisch. Bei meiner ungeheuren Sammlung an Weisheit fällt es mir schwer, sie nicht weiterzugeben, aber ich möchte mir ein paar Freunde erhalten. Lehre mich schweigen über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen zu, und die Lust sie zu beschreiben wächst von Jahr zu Jahr. Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich mich irren kann. Lehre mich an anderen Menschen unerwartete Talente zu entdecken und verleihe mir die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.«
Ich werde älter. Jeden Tag. Weil das Leben eine Reise ist. Leben heißt: Unterwegs sein. Und nicht: Auf der Stelle treten. Es geht weiter. Immer weiter. Auf immer neuen und ungewohnten Wegen. Durch immer neue und unbekannte Landschaften. Zu immer neuen und unbekannten Zielen. Leben ist spannend. Bleibt spannend. Immer ist da noch Luft nach oben.
2 DIE JAHRESZEITEN DES LEBENS
Achtung, das ist ein Gedankenspiel! Teil 1: Stellen wir uns einfach mal vor, unser Leben wäre ein Jahr, ein ganz gewöhnliches Jahr mit zwölf Monaten, und jeder von uns hätte dieselbe Lebenslänge zugeteilt bekommen. Dann hätten wir 365 Tage zur Verfügung. An einem Viertel davon, also an ungefähr 91 Tagen, wäre Frühling, an 91 Tagen Sommer, und an je 91 Tagen Herbst und Winter. Teil 2 unseres Gedankenspiels: Wir stellen uns vor, das Jahr würde mit dem Frühling beginnen. Was ja eigentlich auch ganz schön wäre. (Vielleicht kann die EU-Kommission diesen Vorschlag gelegentlich einmal prüfen.) Unser Lebensjahr würde also mit dem Frühling beginnen und dann in Sommer und Herbst übergehen und schließlich mit dem Winter enden.
Nun haben wir in der Regel mehr als ein Jahr. Aber der Ablauf der Jahreszeiten ist so etwas wie die Blaupause, nach der unsere Lebensjahre ablaufen. Heißt, wer hundert wird, erlebt in den ersten 25 Jahren den Frühling, zwischen 25 und 50 den Sommer, zwischen 50 – ja leider schon da – und 75 den Herbst, und anschließend den Winter.
Das ist eine ausgesprochen grobe Einteilung, ich gebe es zu. Aber mir hat sie schon manchmal geholfen, mich in meiner jeweils aktuellen Lebensphase zu verorten und zurechtzufinden.
Im Frühling erwacht das Leben. Alles knospt und sprießt. Die Welt blüht auf und strotzt geradezu vor Lebenslust und Optimismus. Sie weiß, dass der Winter noch lange nicht kommt, dass also noch viele gute, bunte Monate vor ihr liegen. Vor uns liegen, wenn wir unsere ersten 25 Jahre denn mit dem Frühling vergleichen wollen. Alles signalisiert Anfang. Wir Menschen tun unseren ersten Schrei, gehen tapsend unsere ersten Schritte, stammeln unsere ersten Wörter. Gehen in den Kindergarten, in die Schule, auf die Universität, lernen einen Beruf. Lernen leben. Manchmal gründen wir auch schon eine Familie.
Im Frühling werden die Grundlagen gelegt. Darum ist diese Jahreszeit so besonders wichtig. Und gefährdet. Plötzliche Frosteinbrüche können lebensgefährlich sein für junge Knospen und Triebe, können im schlimmsten Fall zu totalen Ernteausfällen führen. Auch bei uns Menschen. Die Kleinen müssen gehegt und gepflegt werden, geschützt und gefördert. Sie müssen in einem möglichst gut klimatisierten Lebensraum heranwachsen. Wer hier Schaden nimmt, hat oft ein ganzes Leben damit zu tun, die Folgen zu bekämpfen. Wer hier Gutes erlebt, kann ein ganzes Leben davon zehren. In der Regel erleben wir beides.
Ich erinnere mich: Mein Frühling war eine aufregende Zeit. Entdeckungszeit. Eroberungszeit. Es war die Zeit des Staunens, aber auch die Zeit des Fürchtens. So viel Unbekanntes! Blütenträume und Alpträume in stetem Wechsel. Manchmal himmlisch, manchmal höllisch. Jedenfalls nicht immer schön. Es gab Wachstumsschmerzen, Identitätskonflikte. Wer bin ich eigentlich, wer will ich sein? Was kann ich eigentlich? Was sollte ich darum fördern, was besser sein lassen? Was will ich werden? Welche Menschen passen zu mir? Wer tut mir gut? Lauter spannende Fragen, die beantwortet werden wollten.
Am Anfang waren es die Eltern, natürlich. Die Großeltern auch und alle Tanten und Onkel, die die Familie aufzubieten hatte. Aber zunehmend wurden es auch Lehrer, Jungscharleiter, Schulkameraden, Freunde. Und dann endlich die Freundin! Die Vertraute! Die Angetraute! Der Frühling ist die Zeit des Aufbruchs und des Ausprobierens. Der ungehemmten Träume und Fantasien, heller und dunkler. Aber auch die Zeit der ersten Enttäuschungen. Die wiegen in der Regel schwerer als spätere, weil wir noch nicht so geübt sind, sie zu ertragen und aus ihnen zu lernen.
Dann kommt der Sommer. Alles ist aufgeblüht. Alles ist üppig belaubt. Alles zeigt sich in den schönsten Farben und Formen. Es ist angenehm warm. Meistens. Aber manchmal wird es auch unangenehm heiß und schwül, und die Hitze trocknet Böden und Bäche und Talsperren aus. Dann müssen Menschen haushalten mit den Ressourcen, die sie zum Leben brauchen.
Der Sommer ist auch die Zeit der Gewitter, der monsunartigen Regengüsse. Menschen im Sommer haben ihre schützenden Elternhäuser und Schulgebäude verlassen. Sie werden vom Verzehrer zum Ernährer. Müssen ihren Mann und ihre Frau stehen. Der Sommer ist die Zeit, in der sie eigene Häuser bauen, Lebenshäuser auch. Im Sommer macht man Karriere. Was man im Sommer nicht erreicht, erreicht man vermutlich anschließend auch nicht mehr. Der Lebenssommer ist anstrengend. Wie man Beruf und Familie, so man denn eine hat, miteinander vereinbaren kann, ist eine klassische Sommerfrage.
Im Sommer muss man aber auch mit den ersten Dürreperioden zurechtkommen und mit Blitzeinschlägen und Überschwemmungen. Es gibt die berüchtigte Krise in der Lebensmitte, die Midlife-Crisis. Mancher kommt ans Ende seiner Kraft im Sommer, erlebt vielleicht sogar sein erstes Burnout, brennt aus. Die Anforderungen, die das Leben stellt, sind übermächtig geworden. Was soll man nicht auch alles leisten im Sommer des Lebens! Was soll man nicht auch alles sein!
Ich erinnere mich: Ich war verheiratet und wollte ein guter Ehemann sein, wir hatten drei Kinder, die wir zum selbstständigen Leben und zum selbstständigen Denken erziehen wollten, die wir fördern und fordern wollten, hüten und freilassen. Ich sollte und wollte erfolgreich sein im Beruf, wollte und sollte Lieder schreiben und möglichst professionell mit meiner Band aufführen, ich schrieb mein erstes Buch, ich sollte und wollte aber auch meinen Körper nicht vernachlässigen, sollte und wollte Freundschaften pflegen, mich ehrenamtlich im Verein und in der Kirchengemeinde engagieren und was weiß ich noch alles. Der Sommer ist vielleicht die schönste, auf jedem Fall aber auch die kräftezehrendste Phase des Lebens.
Und dann der Herbst. Man fröstelt in der Nacht und manchmal auch am Tag. Man ahnt schon, dass es bald Winter wird. Die Tage werden kürzer. Die ersten Blätter verfärben sich und lassen schon bald die ganze Welt so aussehen, als wäre sie komplett in einen Farbkasten gefallen. Ein letztes Aufbäumen der Natur gegen den nahenden Tod. Dann fallen sie zu Boden.
Es ist aber auch Erntezeit. Fröhliche und dankbare Erntedankfestzeit. Man sieht, was geworden ist. Dass man sich nicht vergeblich gemüht hat. Manche Gartengeräte werden schon mal in den Keller oder in den Schuppen geschafft. Manche Spielgeräte auch. Das Leben verlagert sich mehr und mehr von draußen nach drinnen. Wir pflegen das, was so nur wir Deutschen kennen: Gemütlichkeit. Der erfrischend kühle Weißwein weicht dem wärmeren und weicheren Rotwein.
Im Lebensherbst blicken wir öfter zurück als in den vergangenen Jahreszeiten. Manchmal träumen wir vom Frühling, vom Sommer. Manchmal sind wir auch wieder ganz froh, dass wir das alles geschafft und hinter uns gelassen haben. Keine Klassenarbeiten mehr. Keine Pubertätskonflikte mit den Eltern. Kein Kampf mehr um den richtigen Platz im Leben. Keine Karriereplanungen mehr. Kein Postengeschacher. Keine Streitereien mit den flügge werdenden Kindern wegen unterschiedlicher Lebensentwürfe.
Ich erinnere mich nicht, denn ich stecke da mitten drin. Und ich mutmaße mal, liebe Leserinnen und Leser, dass das für die meisten von Ihnen auch gilt. Man beginnt sich zu arrangieren mit dem, was man erreicht hat. Und mit dem, was sich nun wohl auch nicht mehr erreichen lässt. Man genießt die ruhigen Abende am Kamin. Immer weniger muss man den anderen etwas beweisen, den Gleichaltrigen nicht und schon gar nicht den Jüngeren. Obwohl man sich doch auch heimlich immer mal wieder an ihnen misst. Möchte noch einmal genauso schlank sein wie sie, noch einmal auch so einen wilden Haarschopf zu bändigen haben wie sie, noch genauso neugierig und hungrig sein. Man spürt, dass man langsam den Anschluss verliert. An den aktuellen Musikgeschmack, an das, was »man« so trägt, an die Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Was »zu unserer Zeit« schick und modern war, ist heute, »zu ihrer Zeit«, ein bisschen verstaubt. Die Beatles waren der letzte Schrei damals in den wilden 60ern. Für die Jungen heute ist das die Musik der Großeltern. Also das, was für uns »Das alte Försterhaus« war. Und wenn man selber Lieder schreibt, so wie ich, muss man neidlos akzeptieren, dass es inzwischen Herbstlieder sind und die Frühlingskinder ganz und gar andere Lieder hören und singen und lieben.
Andererseits: Der Herbst hat keine gemeinsame Grenze mit dem Frühling, dazwischen liegt das Land des Sommers. Das bedeutet, dass es auch keine Grenzstreitigkeiten zwischen den Frühlingsbewohnern und den Herbstlingen gibt. Das kann man zu entspannten Begegnungen und Gesprächen nutzen. Wohl auch deshalb kommen Großeltern oft besonders gut mit ihren Enkeln klar. Zuweilen besser jedenfalls als die Eltern mit ihren Kindern. Herbstmenschen sind gelassener als Sommermenschen.
Und endlich wird es Winter. »Endlich«. Denn der Winter macht es uns unmissverständlich klar, dass unser Leben endlich ist. Wie das Jahr. Der Winter ist die Jahreszeit des Todes. Vieles wird schwächer und blasser und stirbt. Lebensenergie und Körperkraft und Abenteuerlust. Manchmal sterben auch die elementaren Fähigkeiten unseres Körpers. Die Sehkraft, das Hörvermögen. Der Winter zieht die Grenzen enger. Er verweist uns ins Haus. Endgültig. Die meisten von uns fürchten den Winter. Wenigstens solange er uns bevorsteht. Wir haben Bilder gespeichert von schwachen und siechen Menschen, die in einem sterilen Heim vor sich hindämmern und auf den Tod warten.
Ich erinnere mich jetzt doch. Nicht an meinen Winter, der steht mir noch bevor, aber an einen Satz, den unser Ältester gesagt hat, als er sieben oder acht war. Zusammen mit anderen Jungen und Mädchen aus seiner Jungschar hatte er in einem Altersheim unserer Stadt ein paar Lieder gesungen. Am Abendbrottisch platzte es auf einmal aus ihm heraus: »Seitdem ich in diesem Heim war, habe ich Angst vor der Zukunft.«
Ja, man kann Angst haben vor der Zukunft, vor dem Winter. Aber man muss nicht. Oft gibt es herrlichen Sonnenschein im Winter. Oft lädt eine verschneite Zauberwelt zu einem kleinen Spaziergang ein. Man sieht und hört vieles, was man im Getriebe des Sommers und des Herbstes meist übersehen und überhört hat. Man freut sich an den kleinen Dingen des Lebens – wenn man sich denn freuen will. Man freut sich an den kleinen Wohltaten freundlicher Mitmenschen – wenn man sie denn sehen will. Man darf zurückblicken auf ein ganzes langes gefülltes und erfülltes Leben. Der Erntekorb ist gut gefüllt.
Ich schaue mich um. Und ich sehe viele zufriedene und vergnügte Alte. Unsere freundliche Nachbarin etwa, inzwischen deutlich über hundert. Wenn es einigermaßen geht, spaziert sie mit dem Rollator und ihrer polnischen Unterstützerin ein paar Schritte unsere Straße auf und ab. Manchmal kommt sie sogar noch in den Gottesdienst in unserer Kreuzkirche. Einmal strahlte sie schelmisch: »Heute ist mir wirklich etwas Wunderbares passiert. Vor meinem Haus haben sie ja einen Graben ausgehoben. Da lag heute Morgen nur ein schmales Brett drauf. Da hätte ich mich nicht rüber getraut. Aber da sagte doch einer der Arbeiter: Kommen Sie, ich hebe Sie rüber. Stellen Sie sich das vor: Ich bin heute schon auf Händen getragen worden.«
Immer sind da Menschen, manchmal auch Engel. Und immer ist da Gott. Mit dem man nun mehr Zeit verbringen kann als früher. Der Schriftsteller Jochen Klepper hat eine biblische Zusage Gottes in ein wunderbares Gedicht gefasst. Ein paar Verse daraus:
»Ja, ich will euch tragen
bis zum Alter hin.
Und ihr sollt einst sagen,
dass ich gnädig bin.
Ihr sollt nicht ergrauen,
ohne dass ich’s weiß,
müsst dem Vater trauen,
Kinder sein als Greis.
Stets will ich euch tragen
recht nach Retterart.
Wer sah mich versagen,
wo gebetet ward?
Lasst nun euer Fragen.
Hilfe ist genug.
Ja, ich will euch tragen,
wie ich immer trug.«
Jochen Klepper2
Wer sich diese Zusage zusagen lässt, muss auch im Winter nicht dauerhaft frieren.
Die Jahreszeiten des Lebens haben bei jedem von uns einen anderen Anfang, einen anderen Schluss. Manchmal überlappen sie einander. Und zuweilen purzeln sie ganz und gar durcheinander. Da ist es plötzlich Frühling mitten im Herbst. Da schneit es im Sommer, und an Silvester wird gegrillt. Unser Leben ist immer einzigartig. Ein Original, keine Kopie. Jede Lebensgeschichte ist immer auch Schöpfungsgeschichte. Und unsere Jahreszeiten sind es auch.
3 DAS LEBEN IST EINE WUNDERTÜTE
Also bei mir ist immer alles anders gekommen, als ich es mir vorgestellt hatte. Schon immer. Bis heute. Bis heute?
In den Kindergarten sollte ich. Klar. Weil Mama was dazuverdienen musste. Doch als mich die ausgesprochen unfreundliche Schwester Elisabeth in den Keller sperren wollte, weil ich das stolz ergatterte Dreirad partout nicht mit einem anderen Jungen teilen wollte, war’s aus mit der Kindergartenkarriere. »Da geh ich nicht mehr hin!«, beschloss ich. Und Oma hatte Erbarmen und bot mir fortan einen Privatkindergarten.
Auf die Realschule sollte ich. Weil meine Eltern kein Geld fürs Studieren hatten und ein Abitur ohne Studium keinen Sinn machte. Jedenfalls hatte uns das mein Volksschullehrer so beschieden. Das war eine gute Entscheidung. Zunächst. Ich hatte tolle Lehrer und lernte auch die praktischen Seiten des Lebens kennen. Doch als ich nach der Mittleren Reife Inspektorenanwärter bei der Stadtverwaltung werden wollte, griffen zwei ältere Freunde beherzt ein. »Das geht gar nicht! Du und Stadtverwaltung! Du musst aufs Gymnasium und Theologie studieren!«
So ging ich aufs Gymnasium mit der unerwartet freundlichen Unterstützung meiner Eltern, um anschließend Theologie zu studieren. Wozu es allerdings nicht kam. Denn kurz bevor es soweit war, entschied ich mich für ein Volontariat bei der »Westfälischen Rundschau«, um Redakteur zu werden.
Das wurde ich dann auch. Und hatte meinen Traumjob gefunden. Doch so ein bisschen Theologiesehnsucht steckte doch noch in mir. Und als der Chef des Evangelischen Presseverbands von Westfalen mich einlud, zur Wochenzeitung »Unsere Kirche« nach Bielefeld zu wechseln, sagte ich begeistert zu. Da sollte ich nebenbei noch ein bisschen Theologie studieren. Wozu es dann allerdings wieder nicht kam, weil die Aufsichtsgremien des Verbandes einen Einstellungsstopp über das fromme Blatt verhängten.
Als ich den schriftlichen Bescheid im Briefkasten fand, lag da auch ein Brief vom »Evangeliums-Rundfunk« in Wetzlar. Ob ich mir eine Mitarbeit bei diesem damals noch jungen Sender vorstellen könnte. Eigentlich hätte ich nicht gekonnt – doch in dieser Situation … Meine Frau und ich fuhren also statt nach Bielefeld nach Wetzlar und ich unterschrieb wenig später einen Vertrag.
Da war ich nun, da blieb ich nun. Über vierzig Jahre – was ich mir damals auch beim besten Willen nicht hätte vorstellen können. Allerdings blieb auch Wetzlar Überraschungsland.
Ich hatte in meinem Geburtsort Lüdenscheid Musik gemacht. Eine Band gehabt. Lieder geschrieben für Konzerte und für einen Jugendgottesdienst, der einmal im Monat stattfand. In Wetzlar war das nun alles zu Ende. Mangels Band und Jugendgottesdienst und überhaupt. Als aber der Sender für sein Jugendprogramm nach neuen Musikaufnahmen verlangte – Platten gab’s einfach nicht genug, um die vier wöchentlichen Sendungen zu füllen –, kam wieder alles anders. Die Leute vom Sender kannten meine Lieder und fanden sie wohl nicht ganz unmöglich. Sie ließen jedenfalls von einer amerikanischen Folkrockgruppe Playbacks produzieren und mich dazu singen – und erlaubten anschließend einem benachbarten Verlag, davon eine Schallplatte zu produzieren.
Das war von mir so wenig geplant worden wie alles andere zuvor.
Um eine lange und überaus abwechslungsreiche Geschichte abzukürzen: Die letzten zwanzig Jahre meines Berufslebens war ich der Chef dieses Senders. Mit knapp 200 Mitarbeitenden und einem aus Spenden gespeisten Jahresetat von zuletzt über zwölf Millionen Euro.
Ich? Ja, ich.
Mit meinen Beziehungen lief’s ähnlich ungeplant und unerwartet. Mit 17 ging ich zum Schulball meiner alten Realschule. Mit Karin. Doch beim Schneeballtanz hopste ich immer häufiger mit Angela durch den Saal. Die war eigentlich mit Michael gekommen. Doch ein paar Wochen später waren wir zusammen. Und ein paar Jahre später verheiratet. Da war sie 19, ich immerhin schon 21. (Nein, nein! Nicht »deshalb«. Unser erster Sohn kam erst zur Welt, als ich schon 24 war …)
Das Leben ist eine Wundertüte. Du weißt nicht, was drin steckt, wenn du sie nicht öffnest. Das ist am Anfang so. Das bleibt bis zum Schluss so. Wenn du nicht vorzeitig müde wirst und die Wundertüte gelangweilt bei Seite legst, weil du denkst, du weißt schon, was drin ist.
Immer wieder treffe ich Menschen, älter gewordene und richtig alte Menschen, die bis zum Schluss Neues entdecken und erleben. Die bis zum Schluss gespannt sind und neugierig bleiben. Und dadurch irgendwie auch jung.
Angelas Vater war so einer. Mathe- und Physiklehrer an »meinem« Gymnasium und Chef der lokalen Wetterstation. Später dann auch noch Informatiklehrer. Zu einer Zeit, als die meisten noch überhaupt nicht wussten, was Informatik ist. Computerbesitzer, als seine Mutter das Wort noch nicht einmal richtig aussprechen konnte. »Kommpuuuter« sagte sie. Bis zu seinem Tod mit knapp über 90 immer interessiert. Immer auf der Höhe der Zeit. Auf den Wetterseiten der NASA zuhause, Facebook-Nutzer. Auf dem Wohnzimmertisch die dicke Wochenzeitung. Im Bücherregal immer neue Wälzer. Wissenschaftliches und Schöngeistiges. Manchmal habe ich zu ihm gesagt: »Wenn ich dich so anschaue, habe ich keine Angst mehr vor dem Altwerden.«
Tante Emmi war so eine. Meine angeheiratete Großtante. Sie baute ganze Wohnlandschaften aus Legosteinen. Selbst dann noch, als sie die 80 überschritten hatte. Was mich natürlich unglaublich faszinierte, wenn ich kleiner Kerl sie besuchte. Nein, nicht ich musste ihr erklären, was man mit neuen Steinen so alles anfangen konnte – sie erklärte es mir.
Hanna war so eine. Immer auf der Pirsch. Immer interessiert an neuen Farben des Lebens. Mit über 70 bekam sie Krebs. Musste nach Bestrahlung und OP zur Reha. Und lernte dort malen. Und kam begeistert zurück. Und maltemaltemalte. Jeden Tag. Jede Woche. Jeden Monat. Ihr kleines Reihenhaus wurde ihre Galerie. Motive hatte sie genug, weil sie mit offenen Augen lebte, mit offenen Sinnen. Immer entdeckte sie Wunderbares im scheinbar Alltäglichen. Staunte und freute sich und – malte. Und malte gut. Für andere. Aber eigentlich vor allem für sich.
Das Leben ist eine Wundertüte. Kann eine Wundertüte bleiben. Ich muss nur leben. Erwartungsvoll leben. Offen sein für Überraschungen. Für Begegnungen. Und Neurobiologen machen Mut: Unser Gehirn ist bis ins hohe Alter in der Lage, neue Schaltungen anzulegen. Man muss ihm nur ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Indem man sich selber überrascht. Und irgendwann auch andere. Mal das Wohnzimmer umräumen. Mal beim Essen auf einem anderen Stuhl Platz nehmen. Mal die Uhr rechts tragen. Mal eine schrille Brille kaufen. Mal einen neuen Supermarkt erkunden. Mal ganz woanders hin in Urlaub fahren. Mal ausgerechnet die Nachbarn einladen, mit denen das Reden immer ein bisschen schwer fällt. Mal einen Film anschauen, der einen zunächst gar nicht interessiert.
Nichts ist schlimmer als dieselbe Leier jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr.
Mancher klagt, dass die Zeit so schnell vergeht, wenn man älter wird. Das stimmt ja. Und es hängt wohl damit zusammen, dass der Vergleichszeitraum immer größer wird. Wenn man zehn ist, macht ein Jahr ein Zehntel des Lebens aus. Mit 80 gerade mal noch ein Achtzigstel.
Aber auch das stimmt wohl: Wenn jeder Tag dem anderen gleicht, weil er immer gleich abläuft, vergeht er umso schneller. Das ist ja auch im Urlaub so: Der Urlaub erscheint einem am längsten, in dem man sich die unterschiedlichsten Aktivitäten an den unterschiedlichsten Orten gegönnt hat. 14 Tage nur am Strand, von morgens bis abends Dösen im Sand, vergehen wie im Flug.
Was den englischen Schriftsteller Graham Greene (1904-1991) zu seinem wunderbar skurrilen Roman »Die Reisen mit meiner Tante« inspiriert hat.
Sie treffen sich nach vielen Jahren wieder, Tante Augusta und ihr Neffe Henry. Bei der Beerdigung seiner Mutter. Ob er immer noch »in dieser Bank« arbeite, will sie wissen. Nein, er sei seit zwei Jahren im Ruhestand. Darauf sie: »Ruhestand? Ein junger Mensch wie du! Gott im Himmel, was fängst du jetzt eigentlich mit deiner Zeit an?« »Ich züchte Dahlien, Tante Augusta.« Was sie entsetzt.
In seiner Bank, so bekennt er, hat er gelernt, sich nicht überraschen zu lassen. Das soll nun möglichst auch so bleiben. Doch die exzentrische Tante, eigentlich viel älter als er, aber irgendwie doch spürbar jünger, macht einen dicken Strich durch diese Rechnung. Sie ist immer schon viel gereist. Und reist immer noch. Und überredet ihn, der zeitlebens hauptsächlich da geblieben ist, wohin er zu gehören glaubte, sie zu begleiten. Und eine denkwürdige und abenteuerliche Reise folgt auf die andere. Und das Leben wird schrill und bunt und aufregend und – es kommt ihm auf einmal so viel länger vor, als es ihm all die Jahre zuvor im Garten bei seinen Dahlien oder gar in seiner Bank vorgekommen ist. Länger weil ausgefüllter und ausfüllender. Und er wird nicht älter und müder dabei. Sondern jünger und wacher und lebendiger.
Bei mir ist immer alles anders gekommen, als ich es mir vorgestellt hatte. Und das darf gerne auch so bleiben – wenn ich es mir wünschen darf.
Neugierig bleiben. Unterwegs bleiben. Solange es geht. Darauf kommt es wohl an. Und sich immer neu darüber wundern, wie viel Luft nach oben da noch ist.
4 DA GEHT NOCH WAS
Sie saßen am Frühstückstisch. Wie jeden Morgen. Und kamen wieder einmal auf dieses Thema zu sprechen. Ihr Thema seit Monaten. Kommt da noch was? Oder war’s das jetzt? Blieb das jetzt so? Bis zum Schluss? Barbara und Udo Klemenz genossen ihren Ruhestand, ja, und sie hatten eigentlich genug zu tun. Sie wurden gebraucht. In der Familie, im Dorf, in der Kirchengemeinde. Aber nach dem vollen, prallen Leben, dass sie in den Jahrzehnten zuvor gelebt hatten, erschien ihnen das dann doch ein bisschen wenig. Barbara und Udo Klemenz beteten. Das taten sie oft. Sie wollten ja nicht einfach irgendetwas tun, sie wollten es schon mit dem Segen ihres Gottes tun. Und es sollte irgendeine Bedeutung haben für andere Menschen.
Warum waren sie so unruhig? Warum wollten sie mehr? Warum genügte es ihnen nicht, es nun einfach ein paar Jahre oder Jahrzehnte einfach nur noch gut zu haben? Weil sie ahnten: Nein, man hat es nicht gut, wenn man es nur gut haben will. Man hat es erst dann wirklich gut, wenn man mithilft, dass andere es gut haben.
Udo war Bauingenieur gewesen. Bei einem großen deutschen Bauunternehmen. Er hatte große Projekte verantwortet, war viel unterwegs gewesen, hatte ein großes Rad gedreht. Vielleicht war es ja auch einfach nur dieses ungewohnte Gefühl der Bedeutungslosigkeit, ja, der Nutzlosigkeit. Der eigenen und dessen, was man so den lieben langen Tag tut.
Als das Telefon klingelte. Weder Udo kannte die Nummer, die das Display anzeigte, noch Barbara. Und die Stimme, die sich meldete, klang auch nicht vertraut. »Guten Tag, Herr Klemenz. Mein Name ist John. Klaus-Dieter John. Ich bin Arzt.« »Ja, was kann ich für Sie tun?«