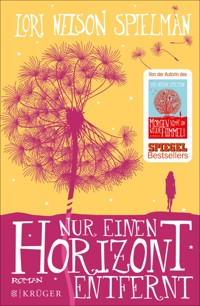8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Achtsamkeitsromane
- Sprache: Deutsch
Ein ergreifender und aufrüttelnder Bestseller von Lori Nelson Spielman, der Mut macht, sich auf die Suche nach dem Glück zu machen. Man weiß nie, wo man es finden wird. Als Annie erfährt, dass ihre Schwester Kristen bei einem Zugunglück gestorben ist, bricht eine Welt für sie zusammen. Sie sollten beide in diesem Zug sein – auf dem Weg zur Uni. Annie fühlt sich schuldig am Tod ihrer Schwester. Sie sucht Trost bei ihrer Mutter Erika, doch diese flüchtet sich in ihre Arbeit. Annie begreift nicht, was mit ihrer liebevollen Mutter passiert ist, die für jedes Tief einen Rat wusste, deren Lachen so ansteckend war und deren Liebe die Familie zusammenhielt. Erika weiß nicht wohin mit ihrer Trauer um Kristen, möchte aber vor Annie keine Schwäche zeigen – bis diese plötzlich verschwindet. In ihrer Verzweiflung denkt sie immer wieder an eine Lebensweisheit ihrer Mutter "Verwechsle niemals das, was wichtig ist, mit dem, was wirklich zählt". Erika wird klar: Sie muss Annie finden! Sonst verliert sie auch noch ihre zweite Tochter. Sonst verliert sie vielleicht alles. Endlich – der dritte herzergreifende Roman von Weltbestsellerautorin Lori Nelson Spielman! Nach den Erfolgsromanen ›Morgen kommt ein neuer Himmel‹ und ›Nur einen Horizont entfernt‹ kommt mit ›Und nebenan warten die Sterne‹ ein neuer bewegender Roman /für alle Mütter, Töchter und Schwestern /der jede Leserin begeistern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lori Nelson Spielman
Und nebenan warten die Sterne
Roman
Über dieses Buch
Erika ist verzweifelt. Nachdem ihre Tochter Kristen bei einem Zugunglück tödlich verunglückt ist, hat sich jetzt auch noch ihre andere Tochter Annie von ihr abgewandt. Nächtelang vergräbt sich Erika in Kristens Zimmer und grübelt über einem alten Album mit Lebensweisheiten. An einem Zitat ihrer Mutter bleibt sie hängen: »Verwechsle niemals das, was wichtig ist, mit dem, was wirklich zählt.« Immer wieder denkt sie darüber nach, und langsam erkennt sie, dass sie sich selbst verloren hat. Hat sie tatsächlich vergessen, was im Leben wirklich zählt? Als Annie nach einem Streit dann auch noch spurlos verschwindet, macht sich Erika auf den Weg nach Mackinac Island. Auf dieser Insel ist sie aufgewachsen, hier muss sie nun ihrer Vergangenheit entgegentreten. Doch Mackinac Island ist nur der Beginn ihrer Suche – nach ihren Töchtern, nach Hoffnung, nach Vergebung und nach Liebe.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 by Lori Nelson Spielman
Published by an arrangement with Lori Nelson Spielman.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück gmbH, 30827 Garbsen.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403636-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für meine Familie
1 Erika
2 Annie
3 Erika
4 Annie
5 Erika
6 Erika
7 Annie
8 Erika
9 Annie
10 Annie
11 Erika
12 Erika
13 Erika
14 Annie
15 Erika
16 Erika
17 Annie
18 Erika
19 Annie
20 Erika
21 Annie
22 Erika
23 Annie
24 Erika
25 Annie
26 Annie
27 Erika
28 Erika
29 Erika
30 Erika
31 Annie
32 Erika
33 Erika
34 Erika
35 Annie
36 Erika
37 Annie
38 Erika
39 Annie
40 Erika
41 Annie
42 Erika
43 Annie
44 Erika
45 Annie
46 Erika
47 Annie
48 Erika
49 Erika
50 Annie
51 Annie
52 Annie
53 Erika
54 Erika
Danksagung
Für meine Familie
»Finde in dir einen Ort der Freude, dann wird die Freude den Schmerz besiegen.«
Joseph Campbell
1Erika
Wenn dich etwas aufhält, bleib stehen. Das würde meine Mutter sagen. Wenn sie noch lebte, könnte ich ihr antworten, dass das im Moment nicht möglich sei. Meine Karriere nimmt gerade richtig Fahrt auf. Doch sie würde den Kopf schütteln und durchaus zutreffend erwidern, es ginge immer, man müsse sich nur dazu entschließen.
Ich schlüpfe in einen schwarzen Rock und hochhackige Schuhe. In Gedanken gehe ich meine ellenlange To-do-Liste durch: Vertrag für Parc 77 abschließen, Vergleichsangebote für die Zweizimmerwohnung im Mayfair einholen. Das alles muss ich noch erledigen, bevor ich die Mädchen heute Vormittag, wie versprochen, nach Philadelphia bringe.
Ich checke meine Mails. Oh, oh. Chung Wang, der Makler aus Peking, hat auf meine Nachricht zu dem Apartment im Plaza reagiert. Er hätte noch Zeit für eine Besichtigung, aber sein Flug gehe am Mittag. Richten Sie es bitte ein.
O nein! Nicht heute, wo ich mir für meine Töchter freigenommen habe! Aber Mr Wang vertritt meine wichtigsten Kunden. Wenn ich es nicht für ihn »einrichte«, übernimmt das sicher gerne die Konkurrenz.
Wird gemacht, tippe ich zurück.
Mein Magen verkrampft sich. Wie soll ich den Mädchen beibringen, dass ich sie doch nicht zur Uni fahren kann? Annie kann den alten Spruch, dass die Arbeit vorgeht, mit Sicherheit nicht mehr hören. Und ich bin ihn, ehrlich gesagt, auch leid. Aber ich will einen Wettbewerb gewinnen. Noch acht Monate in dieser Tretmühle, dann kehrt wieder etwas mehr Ruhe ein.
Als ich meine Schlafzimmertür öffne, begrüßen mich der Duft von Toast und das Geklapper von Geschirr. Ich schaue auf die Uhr. Fünf Uhr sechsunddreißig. Kristen hat die Nacht durchgemacht. Mal wieder.
Im Flur ergänze ich in Gedanken meine Liste um einen weiteren Punkt: Mit Brian über unsere Tochter reden. In Zeiten wie diesen – wenn die Launen unserer Neunzehnjährigen so unvorhersehbar wechseln wie die Lieblingslieder auf ihrer Playlist – bin ich froh, dass mein Exmann Arzt ist.
Ich nehme die Abkürzung durchs Esszimmer, wo Kristens Handtasche auf dem Tisch liegt. Ihr Portemonnaie und ein Päckchen Minzbonbons sind herausgerutscht. Als ich näher hinsehe, entdecke ich einen offensichtlich gefälschten Führerschein auf den Namen einer gewissen Addison. Mit dem Ausweis geht sie als einundzwanzig und damit als volljährig durch – wahrscheinlich war sie gestern in einer Disko und hat Alkohol getrunken. Also wirklich, Kristen! Doch für so was habe ich jetzt keine Zeit. An der Schwelle zu meiner sonst so makellosen Küche bleibe ich wie angewurzelt stehen.
Auf den weißen Marmorflächen herrscht ein wildes Durcheinander von Töpfen und Pfannen, die zwischen Butterverpackungen und Eierschalen stehen. Mehl und Puderzucker zieren den dunklen Holzfußboden. Kristen hat in der Kupferschüssel Sahne geschlagen. Schon von der Tür aus kann ich die weißen Spritzer auf dem Edelstahlherd sehen. Die Unordnung hinter den weißen Schranktüren kann ich mir lebhaft ausmalen.
Und da steht sie, an der Kücheninsel, immer noch in dem gelben Kleidchen, das sie am Vorabend anhatte. Sie ist barfuß, ihre lilafarbenen Zehennägel blitzen. Auf dem Kopf hat sie den kabellosen Kopfhörer. Während sie Erdnussbutter auf dicke Toastscheiben schmiert, singt sie schief einen Hip-Hop-Song mit.
Am liebsten würde ich meine chaotische Tochter gleichzeitig umarmen und erwürgen.
»Guten Morgen, Schätzchen!«
Mit wippendem Kopf träufelt Kristen Honig auf die Erdnussbutter, leckt sich die Finger ab und legt die Brotscheibe in die Pfanne mit schäumender Butter.
Ich komme näher und tippe ihr auf die schmale Schulter. Sie fährt zusammen, dann strahlt sie übers ganze Gesicht.
»Hey, Mom!« Sie reißt sich den Kopfhörer von den Ohren. Die Musik dröhnt weiter, bis Kristen sie auf dem Handy leiser stellt. »Lust auf ein leckeres Frühstück?« Ihre blauen Augen tanzen, doch hinter der Fröhlichkeit erkenne ich den glasigen Blick von zu wenig Schlaf.
»Wieso bist du nicht im Bett, Süße? Hast du gar nicht geschlafen?«
Kristen hält mir ihre Espressotasse entgegen und zuckt mit den Schultern. »Schlaf wird überbewertet. Hey, guck mal, was ich für dich gemacht habe!«
Ich hole tief Luft. »Ach, wie lieb! Aber ich hoffe, du räumst dieses Durcheinander auch noch auf, bevor ihr los…« Ich unterbreche mich, als ich ein handgeschriebenes Schild entdecke, das an den Küchenschränken hängt – befestigt mit braunem Klebeband!
Tschüs, Mom! Du wirst uns fehlen! 1000 Küsse
»Heute ist unser letzter gemeinsamer Morgen.« Kristen schlingt die Arme um mich.
»Das stimmt.« Ich löse mich von ihr. »Vorsichtig! Auf deine klebrigen Fingerabdrücke würde ich lieber verzichten.«
»Ups! ’tschuldigung! Du siehst übrigens schick aus«, sagt sie und fügt dann hinzu: »Ich dachte, wir brauchen einen zünftigen Abschied.«
Ein zünftiger Abschied. So hat das meine Mom immer genannt. Und wie jede anständige Mutter hätte sie Kristen zugestimmt. Eigentlich müsste ich jetzt am Herd stehen und ein Abschiedsfrühstück für meine Töchter zubereiten, nicht umgekehrt.
Kristen führt mich zum Tisch, der bereits für drei Personen gedeckt ist. Ein Krug mit Orangensaft steht in der Mitte, daneben eine Vase mit pinkfarbenen Blumen, die verdächtige Ähnlichkeit mit den Pentas vom Balkon haben, die Annie im vergangenen Frühjahr gepflanzt hat.
Meine Tochter zieht einen Stuhl für mich hervor, dann springt sie in den Flur: »Hey, Annie! Raus aus den Federn!«
»Kristen!« Ich versuche, mit einer Ruhe zu sprechen, die ich gar nicht empfinde. »Sei bitte leise! Willst du das ganze Haus aufwecken?«
»Sorry!« Sie kichert. »Pass auf, probier mal das hier: Toast mit Erdnussbutter, Honig und gerösteten Pekannüssen. Die pure Geschmacksexplosion, das schwöre ich dir.«
Ich schüttele den Kopf. In dem Moment kommt Annie, meine zweite neunzehnjährige Tochter, hereingetapert. Ihr hübsches rundes Gesicht hat dank ihrer Latina-Gene und der Sommersonne einen satten Braunton angenommen, ihre langen schwarzen Haare sind ein einziges Lockengewirr. Auch wenn sie einen Meter fünfundsiebzig misst, ist sie in ihrem gestreiften Pyjama und den flauschigen Elefantenpantoffeln immer noch mein kleines Mädchen. Ich stehe auf und gebe ihr einen Kuss.
»Guten Morgen, Schätzchen.«
»Was ist mit Krissie?«
»Sie macht uns Frühstück.«
Annie registriert die Pentasblüten in der Vase und seufzt. Sie geht zum Herd, wo ihre Schwester das nächste Sandwich in die heiße Butter legt, und zupft einen Klecks Schlagsahne aus Kristens blondem Haar.
»Was hast du gemacht? Eine Bombe gezündet?« Annies Stimme ist sanft, als spräche sie mit jemandem, der sehr empfindlich ist.
»Das ist mein Abschiedsfrühstück für dich und Mom«, erklärt Kristen. Mit einem Pfannenwender holt sie die ersten gebräunten Toasts heraus.
»Du meinst: für Mom«, korrigiert Annie.
Kristen schaut sie an, dann herüber zu mir. »Ah, stimmt. Ein Abschiedsfrühstück für Mom. Du und ich, wir fahren ja zur Uni. Zusammen.«
»Was ist los, meine Damen? Will eine von euch ihre Sommerferien etwa ein wenig verlängern?«, frage ich.
»Natürlich nicht«, sagt Kristen, legt einige Bananenscheiben auf den Toast, besprenkelt ihn mit Sirup und setzt einen Klecks Schlagsahne obendrauf. »Voilà!« Sie hält den Teller in die Höhe, als würde sie ihn den Göttern darbieten, und reicht ihn dann Annie. »Gibst du ihn bitte Mom?«
Wie unglaublich lieb ist es von meinen Töchtern, ein Abschiedsessen für mich zu veranstalten! Doch ich denke im Moment nur daran, wie schnell ich dieses zweitausend Kalorien schwere Frühstück verdrücken und zur Arbeit fahren kann.
Ich schaue zu Annie hinüber, die mein Handy beäugt. Ich stelle den Klingelton ab und lege es mit dem Display nach unten auf den Tisch.
Während Kristen zwischen Herd und Tisch hin- und hereilt, schildert sie uns lachend und wild gestikulierend die vergangene Nacht mit ihren Freunden, bis ins kleinste Detail. Kaum zu glauben, dass dieses Mädchen sich noch vor einer Woche auf ihr Zimmer zurückgezogen hat und nichts essen wollte. Ich nehme an, dass sie sich wieder mit Wes vertragen hat, schneide das Thema jetzt aber lieber nicht an.
»Ich hab drei Stunden durchgetanzt, Minimum!« Kristen wirft sich auf ihren Stuhl und piekst eine Bananenscheibe mit der Gabel auf, dann schiebt sie den Teller von sich. »Mir ist schlecht.«
O Gott, bitte nicht! Ich lege ihr die Hand auf die Stirn. »Du hast aber kein Fieber. Hast du vielleicht beim Kochen zu viel genascht?«
Sie grinst. »Nur ungefähr fünf Löffel Erdnussbutter … ein bisschen Sirup … und zwei Espressi.« Sie lacht, ich bin erleichtert.
»Wann fahren wir heute los?«, will Annie wissen.
»Ach ja, das wollte ich …«, setze ich an, doch Kristen unterbricht mich.
»Ich bin so froh, dass wir nicht den Zug nehmen müssen! Wo wollen wir zu Mittag essen? Ich hatte an das White Dog Café gedacht. Oder vielleicht italienisch im Positano.«
Ich reibe mir den Nacken. Annie beobachtet mich, spürt mein Unbehagen und stößt einen übertriebenen Seufzer aus. »Lass mich raten: Du kannst uns nicht hinbringen?«
Ich ziehe den Kopf ein, hasse mich selbst dafür, mein Versprechen brechen zu müssen. »Es tut mir furchtbar leid, aber für heute Vormittag ist in letzter Minute eine Besichtigung angesetzt worden. Wenn ihr bis morgen warten könntet …«
»Können wir aber nicht. Krissie hat heute Nachmittag einen wichtigen Termin.« Annie stürzt sich auf ihr Frühstück. »Schon gut, Mom, wir haben verstanden. Es ist wirklich wichtig, dass du diesen Wettbewerb gewinnst«, sagt sie dann.
»Schatz, es tut mir leid.« Ich will nach Annies Schulter greifen, doch sie entzieht sich mir.
»Mit dem Zug geht ja auch«, wirft Kristen ein. Sie ist immer diejenige, die mich beruflich mehr unterstützt. »Auf welchem Platz bist du diese Woche? Schon unter den Top Fifty der besten Makler in Manhattan?«
Ich atme aus, erleichtert, dass wenigstens eine meiner Töchter stolz auf mich ist. »Auf Platz 63, aber nächste Woche stehen zwei Abschlüsse an.«
»Das packst du, Mom!«
Das Handy auf dem Tisch vibriert. Ich lege die Hand darauf.
»Entschuldigung.«
»Na los!«, sagt Kristen. »Auf die Top Fifty!«
»Bis zum dreißigsten April ist noch viel Zeit. Da kann eine Menge passieren.«
»Aber bei dir wird’s nur aufwärts gehen. Da fällt mir ein …« Kristen hält einen Finger hoch und verlässt die Küche. Kurz darauf ist sie wieder da. »Für dich«, sagt sie und reicht mir eine kleine beigefarbene Karte mit dunkelblauer Schrift:
Agentur Blair
Individuelle Immobilienlösungen in Manhattan
Erika Blair, Maklerin/Inhaberin
Telefon: 347 555 1212
»Ist die schön!«, freue ich mich und drücke ihr einen Kuss auf den Scheitel. Annie mag etwas gegen meine Arbeit haben, aber Kristen ist durchaus bewusst, dass ein Platz unter den fünfzig besten Maklern von Manhattan unser Leben verändern kann. Allein der Werbeeffekt ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Mein Name würde bekannt, und ich bekäme den nötigen seriösen Ruf, um mich selbständig zu machen. Davon träume ich seit Jahren.
»Ich hab gedacht, wenn du ein kleines Haus oder so entwirfst, könnte man es als Logo mit draufmachen.«
Ich bin gerührt. Schwer vorstellbar, dass meine Begeisterung für Kunst mal genauso groß war wie mein beruflicher Ehrgeiz als Maklerin. Kristen hat das nicht vergessen. »Nächsten Herbst«, verkündet sie, »ist die Agentur Blair dick im Geschäft!« Sie jubelt und hält mir die Hand hin, damit ich sie abklatsche.
Natürlich entgeht mir nicht, dass Annie schweigend ihren Toast isst. »Schatz, hast du gesehen, was Kristen für mich gemacht hat?« Ich halte ihr den Entwurf hin. »Die allererste Visitenkarte der zukünftigen Agentur Blair.«
»Toll.« Annie wendet sich ab. »Dann kannst du ja endlich noch mehr arbeiten.«
Ich bin ernüchtert. Ob sie mir je verzeiht, dass ich als alleinerziehende Mutter mit Arbeit und Familie jonglieren muss? Dass ich versuche, sowohl meine Töchter als auch Carter Lockwood zufriedenzustellen, meinen knallharten Chef, der genauso besessen davon ist wie ich, meinen Namen unter den besten fünfzig Maklern zu sehen? Ich berühre Annies Arm.
»Wenn ich selbständig bin, kann ich mir meine Termine selbst einteilen. Aber noch bin ich Carters Angestellte bei Lockwood. Und einer muss eben arbeiten. Ich kann doch auch nichts dafür.«
»Schon in Ordnung!«, sagt Kristen. »Übrigens, kannst du mir noch ein bisschen Kohle überweisen?«
»Jetzt schon? Was hast du denn mit dem Geld gemacht, das du Montag bekommen hast?«
Kristen senkt den Kopf und schielt nach oben, ihr Bitte-nicht-schimpfen-Gesicht. »Ich habe auf der Straße einen alten Mann mit einem kleinen Welpen gesehen. Der war so dünn und sah so traurig aus …«
»Ach, Kristen.« Ich schüttele den Kopf und beschließe, sie nicht auf die neuen High Heels von Tory Burch anzusprechen, die sie gestern Abend trug. Die mit dem Riemchen, in denen ihre neue Pediküre so gut zur Geltung kommt. Schließlich arbeite ich hart, damit ich meinen Töchtern Dinge ermöglichen kann, die ich als Kind nicht hatte. Ich stehe auf. »Ich überweise dir heute Nachmittag noch was – aber das ist für Lebensmittel, nicht für süße Welpen, verstanden?«
Kristen grinst. »Verstanden.«
Ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange. »Danke für das leckere Frühstück. Hab dich lieb, Mausi. Sag Bescheid, wenn du sicher angekommen bist.« Dann nehme ich sie lächelnd in die Arme: »Halt dich tapfer! Und denk dran, du bist die Beste.«
Das ist mein Abschiedsgruß; dieselben Worte hat meine Mutter früher immer zu mir gesagt. Ich drehe mich zu Annie um, will sie ebenfalls umarmen, doch sie ist schon aufgesprungen. »Ich bringe dich zur Tür«, sagt sie nur.
Ich wappne mich gegen weitere Vorwürfe, doch kaum haben wir die Küche verlassen, wird Annie zur besorgten Schwester. »Mom«, flüstert sie, »ist dir das auch aufgefallen? Sie ist total … überdreht.«
Ich lege Annie den Arm um die Schulter. »Ich weiß. Ist doch schön, dass sie wieder gut drauf ist, oder?«
»Sie hat sich überhaupt nicht mehr im Griff. Genau wie letztes Frühjahr während der Abschlussprüfungen. Als wäre sie manisch oder so.« Annies bedrückter Blick bricht mir das Herz. Sich Sorgen zu machen ist die Aufgabe einer Mutter, nicht der Schwester. Ich streiche ihr eine Locke aus dem Gesicht.
»Zuerst mal«, sage ich, »ist hier niemand krank. Zweitens sind Stimmungsschwankungen bei Jugendlichen normal. Aber ich finde es lieb, dass du dir Gedanken machst. Ich sage eurem Vater, dass er Kristen einen Therapeuten empfehlen soll. Sie macht gerade eine Menge mit: die Uni, die neuen Kommilitoninnen, die Beziehung zu Wes.«
»Einen Therapeuten? Meinst du, damit ist es getan? Ich glaube, sie braucht Medikamente.«
Ich greife nach meiner Handtasche und ignoriere ihre Bedenken. »Rede nicht so, Annie. Kristen ist einfach gut drauf.« Und leiser füge ich hinzu: »Sie hat einen gefälschten Führerschein in der Tasche. Ich glaube, sie hat letzte Nacht zu viel gefeiert.«
Annie legt den Kopf schräg. »Meinst du, sie ist noch betrunken?«
»Möglich, oder es liegt am Koffein. Wahrscheinlich kommt sie nicht allein mit der Küche zurecht. Kannst du ihr helfen?«
»Ja klar.«
»Danke, meine Süße.« Ich lege Annie die Hand auf die Wange. »Es tut mir wirklich leid, dass es heute anders gelaufen ist als geplant. Komm doch zum Labor-Day-Wochenende nach Hause, dann fahren wir nach Easton!«
Meine großmütige Tochter gibt nach. Zum einen liebt sie unser Haus in der Chesapeake Bay, zum anderen kann sie niemandem lange böse sein. »Au ja! Vielleicht haben wir Glück, und der Strom fällt wieder aus.«
Wir lächeln uns an, und ich vermute, dass wir beide an den spontanen Ausflug im letzten Jahr denken, als die Mädchen zum Labor-Day-Wochenende zu Hause waren. Es war Freitagabend, die Wettervorhersage für die nächsten Tage war katastrophal. Zu allem Übel hatten die beiden in der ersten Woche am College eine Erkältung bekommen. Als es aussah, als würde der dunkle Himmel jeden Moment seine Schleusen öffnen, schlug Kristen vor, ins Ferienhaus zu fahren.
»Schatz, es ist acht Uhr abends«, entgegnete ich.
»Ach bitte, Mom«, fiel Annie ein. »Das wird lustig!«
Während die Mädchen in ihre Zimmer flitzten, um die Reisetaschen zu packen, holte ich Lebensmittel und Getränke aus dem Kühlschrank. Dreieinhalb Stunden später erreichten wir mitten in einem schweren Regenguss unser Haus am LeGates Cove, nur um festzustellen, dass es durch das Gewitter einen Spannungsausfall gegeben hatte und wir keinen Strom hatten.
Ich machte ein Feuer im Kamin, wir entzündeten ein halbes Dutzend Kerzen. Annie links und Kristen rechts neben mir, machten wir es uns unter einem Berg von Decken auf dem Sofa gemütlich. Im Schein einer Laterne las ich ihnen aus Betty und ihre Schwestern vor, ihrem Lieblingskinderbuch. Fast kann ich noch das Gewicht ihrer Köpfe in meinen Armbeugen und die Wärme ihrer Körper an meinem spüren. Das Feuer warf Schatten auf ihre friedlichen Gesichter. Hin und wieder schmiegten sie sich bei einem Donnergrollen noch enger an mich. Bei jedem Umblättern wurden ihre Augenlider schwerer, und ich hörte, wie ihre Atemzüge tiefer wurden, bis sie schließlich einschliefen.
Bis drei Uhr morgens las ich weiter, zum Schluss nur noch flüsternd. Ich hatte einfach Angst, dass sie aufwachen würden, wenn ich aufhörte. Und ich wollte die kostbaren Stunden so lange wie möglich genießen, in denen ich die beiden Menschen im Arm hielt, die ich auf der Welt am meisten liebte, diese zwei Mädchen, die keine Kinder mehr waren, aber auch noch keine Frauen.
»Ich überrede Kristen, dass sie auch mitkommt«, holt mich Annie aus meinen Erinnerungen zurück. »Ein Wochenende am Wasser wird ihr guttun.«
»Perfekt.« Ich lege die Hand auf ihre Wange. »Ich weiß nicht, was deine Schwester ohne dich tun würde. Und ich auch nicht.«
»Zumindest hättest du mehr zu essen im Kühlschrank.«
Ich schüttele den Kopf über diesen Witz auf ihre Kosten. Annie ist die kurvigere von beiden Mädchen, sie hat breite Hüften und Oberschenkel, die zu ihrem üppigen Busen passen. In vielen Kulturen wäre sie der Inbegriff von Weiblichkeit. Doch in New York, einer Stadt voller dürrer Möchtegernmodels, hat Annie ein verzerrtes Selbstbild entwickelt, auch wenn ich mein Bestes tue, dem entgegenzuwirken. Dass ihre Schwester und ihre Mutter dünn sind, ist dabei nicht gerade hilfreich.
»Ich liebe deinen gesunden Appetit, meine Hübsche«, sage ich und streiche eine verirrte Strähne aus ihrem Gesicht. »Halt dich tapfer! Und denk dran, du bist die Beste.«
Lachend zeigt sie mit dem Finger auf mich. »Und du bist bescheuert. Willst du das auch noch sagen, wenn Krissie und ich fünfzig sind?«
»Das werde ich immer sagen. Denn ihr seid wirklich die Besten.« Und mein Leben wäre so viel einfacher, wenn deine Schwester genauso viel Verantwortungsbewusstsein hätte wie du. Das spreche ich natürlich nicht laut aus. Und selbstverständlich habe ich es verdient, für diesen Gedanken von einem glühenden Meteoriten getroffen zu werden.
»Es beruhigt mich zu wissen, dass ihr beide heute mit demselben Zug fahrt. Hab ein Auge auf Kristen, ja? Und schreib mir, wenn ihr in Philadelphia seid.« Ich umarme Annie ein letztes Mal. »Ich hab dich lieb …«, beginne ich.
»… wie ein Kätzchen das Spätzchen«, schließt Annie.
2Annie
Mit einem leisen Stöhnen blickt Annie auf die Tür. Ihre Mutter wird ausflippen, wenn sie heute Abend nach Hause kommt und feststellt, dass Annie nicht in Philadelphia ist, um ihr zweites Jahr an der Universität Haverford anzutreten. Sie hatte geplant, es ihrer Mutter kurz vor der Abfahrt zu beichten, um ihr den Tag über Zeit zu geben, die Nachricht zu verdauen und sich abzuregen, bevor Annie ihr am Abend wieder gegenübertreten würde.
Sie geht zurück in die Küche. Neben dem Herd liegt das Handy ihrer Schwester. Der Akku ist leer. Im Fernsehzimmer lacht Kristen hysterisch über irgendeine Comedysendung.
Annie holt tief Luft. In den nächsten zwei Stunden muss sie dafür sorgen, dass ihre Schwester runterkommt, ihre Sachen packt und den Zug nach Philadelphia erwischt. Und wenn ihre Mutter von der Arbeit zurück ist, wird Annie ihr, ohne Krissies moralischen Beistand, beibringen müssen, dass sie ein ganzes akademisches Jahr lang von der Uni ausgeschlossen wurde.
Sie nimmt sich den letzten gebratenen Toast. Er ist kalt, doch das stört sie nicht. Auf die Bananen verzichtet sie, aber Sirup und Schlagsahne müssen sein. Das alles überstäubt Annie mit Puderzucker und greift zur Gabel.
Nichts ist so furchtbar, als dass man nicht noch eine Fressattacke obendrauf setzen könnte – damit man sich dann so richtig mies fühlt.
Annie steht auf einem Hocker in Kristens begehbarem Kleiderschrank und betrachtet das Durcheinander von Kleidern und Schuhen. Typisch für Kristen, ihr Album mit den Sprüchen zu verlieren. Wie soll sie bloß ohne Annie in Philadelphia zurechtkommen? »Hier ist es nicht«, ruft sie ihrer Schwester zu.
»Hätte ich dir auch sagen können.« Kristen steht auf ihrer Matratze und durchsucht das Regal über dem Bett. Sie droht das Gleichgewicht zu verlieren, aber fängt sich wieder. »Hu!« Lachend beginnt sie, auf und ab zu hüpfen. »Komm, Annie! Mach mit!«
»Hör auf, Krissie. Wir müssen dein Album finden. Es muss hier irgendwo sein.«
»Spielverderber!« Doch sie springt vom Bett; ihr zierlicher Körper landet so elegant wie der einer Turnerin. »Ich muss gleich los. Schick es mir einfach nach.«
Annie wühlt in der obersten Schublade von Kristens Schreibtisch herum. »Wo kann es nur sein? Vielleicht in den Kisten, die wir letzte Woche vorausgeschickt haben?«
»Woher soll ich das wissen?«
Kristen hat recht. Annie war auf Zehenspitzen durch das Zimmer geschlichen und hatte lautlos die Klamotten ihrer Schwester eingepackt, während die schlafend im Bett lag. »Hey, denk noch mal nach! Dein Zug fährt in einer Stunde.«
»Ist doch egal. Dann nehme ich halt einen Zug später.«
»Nein. Das wird zu knapp. Ich fasse es immer noch nicht, dass Mom uns versetzt hat. Sie hätte dich fahren sollen.«
»Lass gut sein, Annie. Ich hab kein Problem mit dem Zug.« Kristen lässt sich wieder aufs Bett fallen. »Ist mir scheißegal, wie ich zum Campus komme … oder ob ich überhaupt ankomme.«
Am liebsten würde Annie laut schreien. Nach allem, was Kristen mitgemacht hat, ist es ihr plötzlich scheißegal? »Was redest du da? Du bist doch gerne auf der Penn.«
»Es ist alles so sinnlos. Vielleicht lasse ich die Uni Uni sein und fliege stattdessen nach Michigan.« Kristen lacht, eine seltsame Mischung aus Übermut und Verzweiflung.
Annie rutscht das Herz in die Hose. »Ist das auf Wes’ Mist gewachsen?«
»Nein, Wes will momentan nichts mit mir zu tun haben. Ich will das wieder geradebiegen mit ihm. Aber alles, was ich sage, kommt falsch bei ihm an.«
Bei dem falschen Menschen gibt es keine richtigen Worte, würde Annie am liebsten erwidern. Nicht dass sie sich auf dem Gebiet besonders gut auskennen würde, aber für ein schlaues Mädchen kann Kristen ganz schön dämlich sein, wenn es um Jungs geht. Der letzte in ihrer Reihe männlicher Fehlgriffe ist Wes Devon, ein Typ, der alles für die große Liebe seines Lebens tun würde. Nur dass die Liebe seines Lebens zu Kristens Pech Wes Devon heißt.
Annie und Kristen haben ihn im Juni während der Ferien auf Mackinac Island kennengelernt. Den Rest des Sommers waren Kristen und Wes unzertrennlich, kamen kaum noch aus dem Bett heraus. Doch seit die Mädchen vor zwei Wochen nach New York zurückgekehrt sind, herrscht Totenstille um Wes.
»Setz niemals ein Ausrufezeichen hinter jemanden, der nach dir nur ein Komma macht«, bemerkt Annie.
Kristen schnaubt verächtlich. »Was soll das denn heißen?«
»Vergiss ihn, Kristen! Du bist zu gut für ihn.«
Ihre Schwester geht ans Fenster und legt die Stirn an die Scheibe. »Ich muss noch einmal mit ihm sprechen«, flüstert sie. »Ich muss einfach.«
Annie greift nach Kristens Armen. »Nein. Du musst nur eins tun: zur Uni fahren und diesen armseligen Blödmann vergessen. In drei Jahren machst du deinen Abschluss und wirst der nächste Steve Jobs … nur weiblich und netter.« Annie hebt den Finger. »Aber zuerst müssen wir dein Sprüchealbum finden. Es bringt Pech, wenn du es nicht dabeihast.«
»Mach nicht so ein Drama daraus. Als wir die Hefte bekommen haben, waren wir sechs oder so.«
»Weisheit kennt kein Alter. Ich finde die Sprüche immer sehr tröstlich, besonders die von Mom.«
Kristen hockt sich aufs Bett und zieht ihre Schwester neben sich. »Annie, ich muss dir etwas sagen …« Sie verstummt.
»Was denn?«
Krissie schüttelt den Kopf. »Ach nichts. Du erzählst es ja doch Mom.«
»Nein, bestimmt nicht!«, versichert Annie und sieht auf die Uhr. Mist! Sie muss sich noch umziehen, bevor sie aufbrechen können. »Sag schon, schnell!«
Kristen winkt ab. »Nicht so wichtig. Aber du musst wirklich langsam Moms Rockzipfel loslassen. Es wird Zeit, erwachsen zu werden.«
»Behauptet die Dame, die gerade noch auf dem Bett herumgehüpft ist.«
»Im Ernst«, sagt Kristen. »Möchtest du nicht unabhängig sein?«
»Ich war doch das ganze Jahr an der Uni und im Sommer auf der Insel.«
»Schon, aber du hast Mom quasi jeden Tag angerufen.«
»Hab ich gar nicht!« Annie wendet den Blick ab. »Hab ihr nur geschrieben.«
Kristen wirft die Hände in die Luft. Selbst Annie muss lachen. »Na gut. Ich werde an meiner Unabhängigkeit arbeiten, versprochen.«
»Schön. Du hast jetzt ein ganzes Jahr frei. Geh doch irgendwohin … wo es aufregend ist. Zum Beispiel nach Paris.«
»Aber Mom …«
»Mom wird sich freuen. Sie hat genug zu tun, falls dir das noch nicht aufgefallen ist.«
Alle haben viel zu tun, denkt Annie. Alle außer ihr. Die Einsamkeit, ihre alte, treue Begleiterin, erhebt wieder ihr Haupt. Du gehörst nicht dazu. Du bist nicht dabei.
Wie kommt es, dass sich in den letzten zwölf Monaten alles grundlegend geändert hat? Noch vor einem Jahr war Annie eine vielversprechende junge Literaturstudentin am Haverford College, zumindest hatte der Englischprofessor ihr das bescheinigt. Sie lebte so nah an der Penn University, dass sie ihre Schwester treffen konnte, wann immer sie wollte, und nach New York war es auch nicht weit, so dass sie am Wochenende nach Hause fahren konnte, um bei ihrer Mutter zu sein. Jetzt ist alles anders. Weil man Annie Diebstahl geistigen Eigentums vorwirft, ist sie für ein Jahr gesperrt worden. Krissie ist nun zwei Stunden weit weg. Und ihre Mutter wird völlig von ihrem Job vereinnahmt.
»Hey«, sagt Kristen. »Ich wollte dich nicht ärgern. Ich finde nur, du solltest mal etwas Aufregendes erleben. Und nächsten Sommer, wenn wir dann wieder zusammen sind …« Kristen hält inne, als müsste sie sich sammeln. »Nächsten Sommer haben wir uns dann ganz viel zu erzählen.«
»Stimmt«, sagt Annie und streicht ihrer Schwester über die Wange.
Kristen zieht sie an sich und umarmt sie so fest, dass Annie kaum noch Luft bekommt. »Du bist die beste Schwester der Welt. Das weißt du doch, oder?« Sie schaut Annie in die Augen. »Vergiss das nie, egal was passiert, ja?«
Die Intensität von Kristens Ton und ihr ferner, glasiger Blick machen Annie eine Gänsehaut. Sie schlägt ihrer Schwester auf den Arm, um die Stimmung aufzulockern. »Und du bist die allergrößte Nervensäge, vergiss das auch nicht!« Sie erhebt sich. »Warte, ich gebe dir mein Album mit. Das kannst du so lange nehmen, bis du deins wiederfindest.«
»Vergiss das Teil! Ich bin jetzt weg.« Kristen springt auf und greift zu ihrem Koffer.
»Nein, warte!«, ruft Annie. »Ich komme mit zum Bahnhof.«
Sie läuft in ihr Zimmer am Ende des Gangs und nimmt ihr eigenes Sprüchebuch vom Nachttisch. Schnell schlüpft sie in eine Yogahose und ein T-Shirt und geht mit dem goldenen Büchlein in den Händen zurück zu ihrer Schwester.
»Meine blöden Kommentare am Rand darfst du nicht beachten. Die habe ich letztes Jahr an einem Besuchswochenende reingeschrieben, als Mom mich versetzt hatte, genau wie heute. Sie muss echt mal an ihren Prioritäten arbeiten.« Annie schaut auf. »Krissie?«
Das Zimmer ist leer. Annie wirft das Buch aufs Bett und schießt durch den Flur. »Krissie! Du kannst doch nicht ohne mich fahren … und ohne das Sprüchebuch!«
3Erika
Es ist halb eins am Freitagnachmittag, ich sitze auf einem Barhocker im Fig and Olive und feiere mit einem Glas Wein den Verkauf des Top-Apartments im Plaza. Schnell schicke ich den Mädchen eine Nachricht, erkundige mich, ob sie heil angekommen sind. Dabei spüre ich, dass ein Mann am Ende der Bar mich beobachtet. Irgendwann schaue ich zu ihm hinüber. Sein Gesicht erhellt sich.
»Erika Blair!«, ruft er. »Hab ich’s mir doch gedacht!«
Ich studiere den attraktiven Typen mit dem graumelierten Haar. Er sieht verdächtig wie die ältere Version eines ehemaligen Kollegen vom Elmbrook Memorial Hospital aus. Dann muss ich lachen. »John Sloan?«
Er nimmt sein Glas und kommt zu mir herüber. »Wow, ich glaub’s ja nicht! Ich bin hier auf einer Konferenz des Sozialarbeiter-Verbands. Aber ich habe heute schon genug über die Reform gehört und beschlossen, mir den Nachmittag freizunehmen. Was für ein Zufall, dass ich dich treffe!«
»Freut mich auch total! Wie geht es dir denn so? Setz dich doch!«
John nimmt den Hocker neben mir, und in den folgenden zwanzig Minuten unterhalten wir uns über die alten Zeiten. Er berichtet, was aus meinen ehemaligen Kollegen geworden ist und wie es ihm selbst erging. Sein einziger Sohn ist gerade in seinem letzten Jahr an der University of Wisconsin. Vor drei Jahren hat John sich scheiden lassen.
»Unfassbar, dass du jetzt in Immobilien machst«, sagt er mit Blick auf meine Visitenkarte – seine Karte liegt vor mir.
»Schon seit acht Jahren«, erkläre ich.
»Aber du warst so gut in deinem Beruf, Erika. Du hattest ein großes Talent, auf Menschen zuzugehen, das sage ich nicht einfach so. Hast du den Wechsel nie bereut?«
Vielleicht liegt es am Wein, doch zum ersten Mal seit Jahren verspüre ich einen kleinen Stich der Sehnsucht. Achselzuckend versuche ich, ihn abzuschütteln. »Versuch mal, in Manhattan zwei Kinder mit dem Gehalt einer Sozialarbeiterin großzuziehen.« Mein Lachen klingt hohl. »Als mein Mann mich verlassen hat, hatte ich nicht mehr genug Geld, um hierzubleiben, aber ich konnte auch nicht weg. Die Mädchen brauchten ihren Vater.« Ich umfasse den Stiel des Weinglases.
»An einem Tag«, fahre ich fort, »ungefähr einen Monat nach der Scheidung, kam ich nach Hause, total erschöpft und ausgelaugt – damals habe ich in einer schäbigen kleinen Klinik für Drogenabhängige gearbeitet. Meine Tochter Kristen saß auf der Veranda unseres Hauses in Brooklyn und stopfte sich die Weintrauben in den Mund, die für das Mittagessen am nächsten Tag gedacht waren. Ich bin fast durchgedreht, bin die Verandatreppe hoch und hab ihr die leere Schüssel aus den Händen gerissen. ›Was denkst du dir dabei? Du weißt doch, dass du nach der Schule nur sechs Weintrauben essen darfst!‹, habe ich sie angeschrien.«
Ich halte mir die Hand vor den Mund – bis heute schäme ich mich dafür.
»So war das damals. Kristen hat mich angesehen, und ich werde ihren Gesichtsausdruck niemals vergessen. Sie war verletzt, aber es stand auch noch was anderes darin: Verachtung.«
Erschrocken merke ich, dass meine Stimme bricht, und halte inne, um meine Fassung zurückzugewinnen, bevor ich die Geschichte zu Ende erzähle. »Damals habe ich mir geschworen, dass es meinen Kindern an nichts im Leben mangeln soll. Sie sollten nicht so arm aufwachsen wie ich – und vor allem sollte es nicht so weitergehen wie bisher.«
John nickt. »Dein Ex hat dich so richtig über den Tisch gezogen, was?«
»Eigentlich nicht. Es gab kein Vermögen zu verteilen. Brian hat damals noch sein Studiendarlehen abgezahlt.«
Ich stoße ein unsicheres Lachen aus und hebe den Finger. »Aber meine Leidensgeschichte hat ein glückliches Ende genommen. Die Immobilienmaklerin, die Brian und mir unsere erste Wohnung vermittelt hat, als wir nach Manhattan zogen, brauchte eine Assistentin. Ich habe Fortbildungen besucht, zwei Jahre alles von der Pike auf gelernt, und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.« Ich erwähne nicht, dass ich heute in einem Monat mehr verdiene als früher als Sozialarbeiterin im ganzen Jahr. Dass ich, weil ich in weiser Voraussicht ein bisschen Mandarin gelernt habe, im Rennen um die Top Fifty der besten Makler New Yorks bin, die nächstes Frühjahr mit einer Preisverleihung im Rahmen einer Gala geehrt werden.
John zuckt mit den Schultern. »Wahrscheinlich ist das gar nicht so abwegig. Du hilfst den Menschen ja immer noch, jetzt besorgst du ihnen bloß ein passendes Heim.«
Ich nicke, als würde ich wirklich mit arglosen jungen Pärchen, die das Haus oder die Wohnung ihrer Träume suchen, durch die Stadt streifen. Doch dann gestehe ich: »Genau genommen habe ich mich auf den ausländischen Markt spezialisiert – insbesondere auf asiatische Investoren. Deren Makler kommen für vierundzwanzig, maximal achtundvierzig Stunden rüber. Ich zeige ihnen im Schnelldurchlauf ein halbes Dutzend Objekte, die den Anforderungen ihrer Auftraggeber entsprechen, und wir suchen was aus. Das ist wie Speeddating für Häuser.«
»Eher ein Blind Date«, bemerkt John mit gerunzelter Stirn. »Wie geht es deinen Zwillingen?«, fragt er dann.
Die meisten halten meine Töchter, die nur fünf Monate auseinander sind, für Zwillinge. Ich berichtige John nicht.
»Sie treten gerade ihr zweites Jahr am College an.« Ich schaue auf die Uhr. »Sie müssten jetzt zurück auf dem Campus sein. Kristen geht zur University of Pennsylvania. Sie ist ein Energiebündel, hält mich auf Trab. Genießt das Leben in vollen Zügen. Wild, rebellisch und blitzgescheit. Annie ist die Zurückhaltendere von beiden. Sie liebt Literatur und Musik. Eine Träumerin, die glaubt, dass alles möglich ist – außer vielleicht, dass ich irgendwann kürzertrete.« Ich schmunzele nicht sehr überzeugend, um einen unerwarteten Anflug von Traurigkeit zu überspielen. »Sie hat sich Haverford ausgesucht, damit sie in der Nähe ihrer Schwester sein kann.«
»Schön«, sagt John. »Hör mal, hast du schon gegessen?«
Ich weise auf die Schale auf der Theke. »Abgesehen von diesen Salzbrezeln, meinst du?«
Er beugt sich vor, das Gesicht rot vor jungenhafter Freude. »Nehmen wir uns einen Tisch! Ich lade dich ein.«
Ich schiele auf das Handy. Immer noch keine Nachricht. Ich habe eigentlich Zeit, weil ich mir ja den Tag für die Mädchen blockiert hatte.
»Warum nicht?«, sage ich mit einem leichten Kribbeln von Übermut und Aufregung.
»Super.« John gibt dem Barkeeper ein Zeichen, dass er zahlen will. »Ich muss Bob Boyd unbedingt erzählen, dass ich dich getroffen habe. Er war total verknallt in dich – Mann, das waren wir alle. Jedes Mal, wenn ich einen Film mit Sandra Bullock sehe, muss ich an dich denken.«
Ich werde rot. Früher habe ich öfter gehört, dass ich mit meinen dunklen Haaren und dem breiten Lachen Ähnlichkeit mit der Schauspielerin habe, aber das ist lange her.
John lächelt mich an. »Du siehst besser aus als je zuvor.«
»Ja klar«, winke ich ab. Doch zum ersten Mal seit Jahren ist mir nach Flirten zumute. Ich fühle mich sexy und ein klein wenig beschwipst.
John hält meinen Hocker fest, ich stehe auf. Als ich nach meiner Tasche greife, streift mein Blick den Bildschirm über der Theke. Dort läuft CNN. Eine Sondermeldung. Aus irgendeinem Grund – vielleicht ist es Instinkt – halte ich inne. Der Monitor zeigt Bilder von einem Zug, der vor zwei Stunden in Pennsylvania entgleist ist. Augenblicklich nüchtern, erstarre ich.
»Meine Töchter«, sage ich und spüre, wie das Leben aus mir hinausrinnt. »Sie sind in dem Zug.«
4Annie
Annie sitzt an der Kücheninsel, vor sich ihr Laptop und eine Chipstüte. Sie schwingt auf dem ledernen Barhocker hin und her, isst eine Handvoll Chips und liest erneut den Brief, den sie gerade verfasst hat. Sorgfältig hat sie ihre Gefühle in präzise Sätze und Abschnitte gegossen, die Zeichen effektvoll gesetzt. Ihre Gedanken fließen viel leichter, wenn sie sich der Tastatur statt ihrer Stimme bedient. Annie schnaubt leise. Schon ein Witz, dass ihre geschriebenen Worte der Grund dafür sind, dass sie ein Jahr aussetzen muss.
Noch einmal überfliegt sie den Text, ändert Falls ich nach Haverford zurückkehre zu Wenn ich nach Haverford zurückkehre, bevor sie die zweiseitige Rechtfertigung schließlich ausdruckt.
So. Fertig. Heute wird sie so lange aufbleiben, bis ihre Mutter von der Arbeit kommt, egal, wie spät, und ihr den Brief überreichen. Während sie ihn liest, wird Annie sich zwingen, keinen Mucks von sich zu geben.
Es rumort in ihren Eingeweiden, sie schlägt die Hände vors Gesicht. Ihre Mutter wird durchdrehen, wenn sie es erfährt. Aber Annie ist gewappnet … so gut es eben geht. Sie wird ihr von ihrem Plan erzählen. Dass sie ein Jahr freimachen und sich einen Job bei Starbucks suchen will oder vielleicht im The Strand. Und nächsten Herbst wird sie nach Haverford zurückkehren. Man hat ihr ja versprochen, sie wieder aufzunehmen.
Ihr Handy klingelt. Sie schaut aufs Display. Verdammt, ihre Mutter! Jetzt ruft sie sogar an, statt nur zu simsen. Soll Annie sich melden und so tun, als wäre sie schon auf dem Campus? Kurz überlegt sie, den Anruf auf die Mailbox springen zu lassen, doch das kommt ihr zu feige vor.
»Hallo, Mom.«
»O Gott! Mein Schatz! Ich bin so erleichtert!«
Sie klingt völlig verzweifelt.
»Wieso? Warum bist du erleichtert?«
»Ach, meine Süße! Es geht dir gut! Ich hatte gedacht, du … und Kristen …« Sie ist atemlos, verschluckt sich. »Sie meldet sich nicht. Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen …«
»Immer mit der Ruhe. Krissies Akku ist leer. Wo bist du überhaupt?«
Ihre Mutter lacht nervös und senkt die Stimme. »Ich bin zum Mittagessen verabredet, Annie. Ein spontanes Date sozusagen. Kannst du dir das vorstellen? Aber dann habe ich die Nachricht mit dem Zug gesehen und das Schlimmste angenommen.«
Annies Herz schlägt schneller. Sie lehnt sich gegen die Küchentheke, um Halt zu finden. »Was für ein Zug? Wovon redest du, Mom?«
»Der Acela-Express, kurz vor Philly. Ganz furchtbar, Annie. Er ist mit einem Tanklaster zusammengestoßen. Gott sei Dank wart ihr nicht drin.«
Annies Knie geben nach. Sie rutscht am Schrank nach unten auf den kalten Holzboden.
»Krissie«, flüstert sie mit einer Stimme, die jemand anderem zu gehören scheint. »O mein Gott. Krissie.«
5Erika
Vierundzwanzig Stunden vergehen in einem Nebel des Nichtbegreifens. Es ist, als wäre ich weg, untergetaucht an einen Ort, zu dem keine Sinneseindrücke vordringen. Mein Körper läuft auf Autopilot. Es ist Samstagnachmittag, und Brian, Annie und ich sitzen mit einer Trauerbegleiterin im Büro des Amtsarztes am Mercy Hospital von Philadelphia. Ich hatte erwartet, in eine kahle Leichenhalle geführt zu werden, wo man eine Decke zurückschlagen und uns die Leiche meiner Tochter auf einem Metalltisch präsentieren würde. Stattdessen sitzen wir hier mit einer Afroamerikanerin mittleren Alters namens JoAnna, die mit gedämpfter Stimme spricht. Sie sagt, wie leid ihr unser Verlust tue, und versichert uns, wir hätten alle Zeit der Welt, um unsere Tochter zu identifizieren.
»Dazu kommen wir gleich hier, mit Hilfe von Fotos.« Sie weist auf ihr Klemmbrett, auf dem ein Bild mit der Rückseite nach oben liegt. »Bevor ich die einzelnen Fotos umdrehe, werde ich Ihnen genau erklären, was darauf zu sehen ist.« JoAnna lächelt. »Ihre liebe Tochter hat uns diese Aufgabe ein wenig erleichtert. Sie hatte nämlich ihren Studentenausweis in der Gesäßtasche der Jeans. Deshalb sind wir uns relativ sicher, dass der fragliche Leichnam wirklich der von Kristen Blair ist.«
Sie hält den Lichtbildausweis hoch. Ich sehe das verschmitzte Lächeln meiner Kleinen, lebensfroh und sorglos, ohne die geringste Ahnung, was sie erwartet. Bevor ich die Hand vor den Mund halten kann, schluchze ich auf. Mehrmals schnappe ich nach Luft.
»Entschuldigung.« Ich bemühe mich, nicht zu hyperventilieren. »Das ist nur so … unwirklich.«
JoAnna legt die Hand auf meinen Arm. »Das verstehe ich.«
Ich kämpfe gegen den Drang, sie anzuschreien, sie habe keine Ahnung, wie es mir geht. Woher will sie bitte wissen, wie es ist, wenn das strahlende Leben des eigenen Kindes, seine Träume, Hoffnungen und Erwartungen, einfach ausgelöscht wurden wie eine zu Ende gerauchte Zigarre?
Annie drückt meine Hand, Brian beugt sich vor. »Alles gut?«
Ich hole tief Luft und nicke, greife nach Annies Hand und ermahne mich, stark zu sein. Für sie. Wieder danke ich Gott, dass sie den Zug verpasst hat.
»Auf dem ersten Foto ist ein rechter Fuß zu sehen. Bedenken Sie bitte, dass der Körper schwere Verletzungen erlitten hat. Man sieht Hämatome und Schwellungen. Ich möchte Sie bitten, auf Erkennungsmerkmale zu achten, zum Beispiel auf Leberflecke, Tätowierungen oder Narben.«
JoAnna dreht das erste Bild um. Ich erblicke einen geschwollenen Fuß, der keinerlei Ähnlichkeit mit dem meiner Tochter hat. Dann sehe ich, dass die Zehennägel lila lackiert sind. Ich fasse mir an den Hals, habe das Gefühl, keine Luft zu bekommen. »Der Lack«, bringe ich hervor, und zum zweiten Mal bricht meine Welt zusammen.
Nacheinander dreht JoAnna Fotos von Knöcheln, Beinen und vom Rumpf meiner Tochter um. Trotz der Schwellungen kann ich ihren knochigen Brustkorb erkennen. Mit dem Finger streiche ich über das Bild. »Meine Süße«, flüstere ich.
JoAnna wartet, bis ich mich wieder im Griff habe. »Die Aufnahmen, die jetzt kommen, sind besonders schwierig. Der Großteil der Brust und das Gesicht wurden bei der Explosion verbrannt.«
Annie wimmert. Ich lege den Arm um sie, möchte ihren Schmerz gerne lindern. »Schatz, ist alles in Ordnung? Wir können auch nach draußen gehen.«
»Nein«, beharrt sie und richtet sich auf. »Ich bin kein Kind mehr.«
Dieser schlichte Satz bricht mir das Herz. Sie hat recht. Ohne eigenes Zutun wurde sie in die Erwachsenenwelt katapultiert, auf grausamste Weise hineingestoßen.
JoAnna dreht das Foto um. Brian hält die Luft an. Ich werfe nur einen kurzen Blick darauf, dann kneife ich die Augen zu. Instinktiv ziehe ich Annie an meine Brust.
»Ich denke, wir haben genug gesehen«, sage ich und hoffe inständig, dass wir uns auf Dauer an Kristens weiche elfenbeinfarbene Haut erinnern werden, nicht an dieses verkohlte Antlitz. »Brian, machst du bitte weiter?«
Er reibt sich das Gesicht. »Klar.« Er ist enttäuscht, dass ich ihn mit der Aufgabe alleinlasse. Kann ich ihm nicht verübeln. Doch im Moment geht es mir nur um Annie.
»Bitte sehr!« JoAnna gibt mir ihre Visitenkarte. »Ich bin rund um die Uhr erreichbar. Außerdem kann ich Ihnen einen sehr guten Trauerbegleiter in Manhattan empfehlen.«
Ich murmele ein Dankeschön und verlasse das Büro mit Annie im Arm. Hinter uns kündigt JoAnna das nächste Foto an. Als ich die Tür schließe, höre ich Brian sagen: »Ja, das ist sie. Das ist unsere Kristen.«
Während Annie zur Toilette geht, warte ich im Korridor des Krankenhauses und betrachte den Studentenausweis, den ich eben von JoAnna bekommen habe. Ich hole mein Portemonnaie heraus, um ihn unter die Klarsichthülle zu schieben. Dabei stoße ich auf das Familienbild, das aufgenommen wurde, als die Mädchen drei Jahre alt waren. Ich denke sechzehn Jahre zurück, als wir noch in unserem kleinen Bungalow in Madison lebten.
Es war ein Samstag, und wir hatten einen Fotografen für ein Familienfoto nach Hause bestellt. Gerade waren wir mit dem Mittagessen fertig, Brian war nach oben gegangen, um zu duschen und sich umzuziehen. Kristen und Annie halfen mir, den Tisch abzuräumen, mit ihren kleinen Händchen trugen sie die Suppenteller zur Spüle. In unserer altmodischen gelben Küche summte es vor Geschäftigkeit.
»Wir müssen unsere schönsten Sachen anziehen«, erklärte ich den beiden, während ich das Geschirr entgegennahm und es spülte. »Wenn der Fotograf fertig ist, fahren wir Oma und Opa Blair besuchen. Und heute Abend gehen wir alle zusammen im Lombardino essen.«
»Dürfen wir unsere schicksten Sachen anziehen?«, fragte Kristen.
»Natürlich!«, erwiderte ich. »Lombardino ist was ganz Besonderes. Das ist Daddys Lieblingsrestaurant.«
»Jippie!«, jubelte Annie. Wie zum Nachdruck rutschte ihr der Suppenteller aus der Hand. Tausend kleine Porzellansplitter verteilten sich auf dem Fliesenboden.
»Keiner bewegt sich!«, rief ich und klemmte mir Annie unter den einen und Kristen unter den anderen Arm. Ich trug die beiden zur Treppe und stellte sie auf der untersten Stufe ab. »Passt auf, ich mache jetzt die Küche sauber, und ihr geht nach oben und macht euch fertig, ja? Eure erste Aufgabe lautet: Putzt euch den Milchbart ab!«
»Nur Jungs haben einen Bart«, sagte Annie.
Sie sprangen die Treppe hinauf. »Komm, Annie, wir machen uns schön!«, rief Kristen.
Ich kehrte die Scherben zusammen und brachte sie nach draußen in den Müll, anschließend wusch ich das Essgeschirr ab. Dabei lauschte ich lächelnd dem Kichern und Quietschen der Mädchen im Zimmer direkt über der Küche.
Brian kam in einem gestärkten Hemd herunter, er roch nach seinem kernigen Aftershave. »Hab ich einen schönen Mann!«, sagte ich.
Als ich mich reckte, um ein Glas in den Schrank zu stellen, trat er hinter mich und gab mir einen Kuss in den Nacken. Ein Frieden erfüllte mich – nein, es war mehr als Frieden, es war ein seltener Moment puren Glücks. Ich hatte die Familie, von der ich immer geträumt hatte. Wir vier waren gesund und zufrieden. Es gab nichts, gar nichts, was mir fehlte.
Eine Viertelstunde später trippelten kleine Füße oben durch den Flur. »Macht die Augen zu!«, rief Kristen hinunter.
Ich nahm Brian an der Hand und zog ihn in den Flur. Unten an der Treppe blieben wir stehen und legten demonstrativ die Hände vor die Augen.
»Aufmachen!«, rief Annie.
Ich erblickte zwei kleine Prinzessinnen. Händchenhaltend stiegen sie die Stufen hinunter, als befänden sie sich in einem Palast.
»Oh, ihr Süßen!« Ich war so gerührt.
Die beiden hatten sich ihre Disneykostüme angezogen: Annies war rosa, Kristens violett. Bei jedem Schritt in ihren Satinballerinas wippten die Tüllröcke. Auf dem Kopf trugen sie spitze Feenhüte, von denen kleine Bänder wehten.
»Sind wir nicht schön?!«, fragte Kristen, mehr eine Feststellung als eine Frage. Annie war nicht ganz so selbstsicher. Voller Hoffnung schaute sie von mir zu Brian.
Tränen sprangen mir in die Augen. »Und wie!«, rief ich. »Ihr seid wunderschön!«
Annies besorgte Miene hellte sich auf. »Wir haben uns selbst angezogen«, erklärte sie stolz.
Brian grinste. »Aber für die Fotos könnt ihr die Kostüme nicht nehmen. Mom hilft euch, vernünftige Kleider auszusuchen.«
Freude und Stolz schwanden aus ihren Gesichtern. Ich wusste genau, was sie in ihren kleinen Köpfen dachten. Sie hatten ihren Vater enttäuscht. Obwohl sie sich so angestrengt hatten, waren sie nicht gut genug. Aus eigener Erfahrung wusste ich, wie sich das anfühlte.
»Nein«, widersprach ich Brian, ein seltener Bruch unserer elterlichen Einheit. »Ihr seht absolut perfekt aus.«
Den Rest des Tages nahm Brian mir das übel. Ich verstand seinen Ärger, wirklich. Selbst der Fotograf wirkte verdutzt, dass ich den Mädchen erlaubte, ihre Prinzessinnenkostüme zu tragen. Aber bis heute ist es mein liebstes Familienfoto.
Zurück im Hier und Jetzt kommt Annie auf mich zu, ihre Augen sind rot gerändert. Ich schlucke meine Tränen hinunter und schiebe Kristens Ausweis in das Fach hinter das Prinzessinnenfoto. Mit gesenktem Blick versuche ich, mich zu fangen. Bleib stark. Du brichst hier nicht zusammen.
Schließlich hebe ich den Kopf und bringe für meine übrig gebliebene Prinzessin ein unsicheres Lächeln zustande, doch ich bin mir sicher, dass Annie es durchschaut. Sie weiß ebenso gut wie ich, dass unser so wunderbares Königreich niedergebrannt wurde und nie wieder aufgebaut werden kann.
Erst wenn wir uns ganz schwach fühlen, erfahren wir, wie stark wir wirklich sind. Dann erhebt sich unsere Stärke wie ein Gänseblümchen aus einem Riss im Asphalt. Ich treffe Entscheidungen, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Begräbnis oder Einäscherung? Urne oder Grabstein? Ein Gottesdienst mit anschließender Beisetzung oder eine private Gedenkfeier zu Hause? Ich wähle die Einäscherung und einen Grabstein, eine Trauerfeier in der Holy Trinity und danach eine kleine Zusammenkunft bei uns.
Um sieben Uhr abends stehe ich in meinem schwarzen Leinenanzug in der Tür und verabschiede die letzten Gäste, vier von Kristens engsten Freundinnen von der Columbia Prep School.
»Danke, dass ihr Kristens Freundinnen wart!« Ich drücke jede an meine Brust, eine nach der anderen, atme ihren süßen Duft der Jugend ein. »Sie hat euch so gern gehabt.«
»Alles Gute, Mrs Blair«, sagt Lauren Rush und streicht mir über den Arm.
»Wir sehen uns, Mädels!« Meine Stimme bebt. Lauren dreht sich noch mal um und lächelt traurig. Die Mädchen gehen zum Aufzug. »Kommt uns besuchen!«
Seit Jahren gilt unser Apartment als erster Anlaufpunkt, der angestammte Treff für Kristen und ihre Freunde. Bald werden sie einen anderen finden. Müssen sie ja.
Ich gehe zurück in die Küche und versuche zu verarbeiten, dass ich nicht nur Kristen, sondern auch ihre Freundinnen verloren habe und mit ihnen den Wirbel von Energie, den sie immer verbreitet haben. Vorbei ist es mit dem gemeinsamen Kochen, mit Übernachtungen und spontanen Partys. Obwohl die Mädchen auch Annies Klassenkameradinnen waren, gehörte sie nie zu Kristens Kreis. Annie genügt ihre enge Freundschaft mit Leah.
In der Küche sitzt meine Tochter an der Insel und isst ein Stück Baklava von dem Tablett mit Kristens Leibspeisen. Sie stützt die Ellbogen auf die Arbeitsplatte, kaut geistesabwesend und schaut in die Ferne. Tränen rinnen ihr über die Wangen. Der Anblick bricht mir das Herz.
Nicht einmal Leah war heute für sie da. Bis zu den Winterferien bleibt sie in Stanford. Wieder frage ich mich, ob ich nicht darauf hätte bestehen sollen, dass Annie nach Haverford zurückkehrt, statt ein akademisches Jahr Pause einzulegen, um sich zu erholen. Zu viel Freizeit tut niemandem gut, schon gar keinem Trauernden. Ich schlucke den Kloß im Hals hinunter und küsse Annie auf die Schläfe.
»Wie geht es dir, mein Schatz?«
»Okay.« Sie wendet sich ab und wischt sich mit der Schulter über die verweinte Wange. »Und dir?«
Ich setze mein tapferes Gesicht auf, obwohl ich nichts lieber täte, als Annie in die Arme zu nehmen und loszuheulen. Sie soll mich so wahrnehmen wie alle anderen: stark, robust, sogar dankbar. Ja, dankbar. Wenn Annie an jenem Morgen nicht noch mal wegen ihres Handys nach Hause gefahren wäre, hätte sie auch in dem Zug gesessen, und ich hätte beide Töchter verloren. Und damit auch mich selbst. Ohne Annie hätte ich keinen Grund, stark zu sein.
»Alles gut«, lüge ich.
»Schön.« Sie nimmt sich noch ein Baklava und verschwindet in ihrem Zimmer.
Irgendwie wäre es einfacher, wenn sie mich anschreien würde, wenn sie Antworten verlangte. »Warum hast du Kristen nicht zur Uni gefahren, wie du es versprochen hast? Warum war dir dein beschissener Job wichtiger als wir?«
Doch anstatt eine Erklärung zu fordern, zieht Annie sich in ihr Zimmer zurück. Ich habe meine Töchter im Stich gelassen. Wieder einmal. Durch Brians Auszug ist unsere Familie zum ersten Mal geschrumpft, nun geschieht es ein weiteres Mal. Bloß ist es jetzt ganz allein meine Schuld. Wenn ich mein Versprechen gehalten hätte, würde Annies Schwester noch leben. Mit dem Wissen muss ich nun klarkommen.
Ich gehe schnell zum Schrank neben der Kaffeemaschine, schüttele eine Xanax aus dem orangefarbenen Behälter und schlucke das Beruhigungsmittel hinunter. Schweigend schicke ich einen stillen Dank an die Pharmaindustrie und bete, dass diese kleine Tablette in den nächsten fünf Stunden meine Schmerzen betäubt … beziehungsweise in den nächsten fünfzig Jahren.
Als ich die Arbeitsfläche abwische, kommt meine vierunddreißigjährige Schwester Kate in die Küche. Sie hat ihre hochhackigen Schuhe ausgezogen, an ihrem nackten Fuß prangt eine kleine tätowierte Rose. Kate greift nach dem Geschirrtuch. »Setz dich, Rik. Ich übernehme das.«
»Schon gut. Wenn ich mich setze, fange ich an zu grübeln.«
Sie rutscht auf den Hocker, den Annie gerade verlassen hat. »Das war eine wirklich schöne Feier.«
»Danke. Vielleicht machen wir nächstes Jahr im Herbst noch eine, nur für die Familie. Um die Asche zu verstreuen. Zwei Wochen sind zu kurz, um sich endgültig zu verabschieden.«
»Es wäre schön, wenn Dad hier sein könnte«, bemerkt Kate.
Ich wende mich ab, tue so, als würde ich einen Fleck am Kühlschrankgriff wegschrubben. Warum muss sie ausgerechnet jetzt meinen Vater erwähnen, den Mann, den ich für den Tod meiner Mutter verantwortlich mache? »Er ist noch nie für mich da gewesen. Warum sollte das heute anders sein?«
»Mach mal halblang, Rik. Er hat gerade eine neue Hüfte bekommen. Es geht ihm total schlecht.«
Weil ihn die Hüfte schmerzt oder weil er mich im Stich lässt? Ich tippe auf Ersteres. Ich werfe das Geschirrtuch in die Spüle und drehe mich zu Kate um. »Der Mensch, den ich am meisten vermisse, ist Mom. Sie hätte genau die richtigen Worte gefunden.«
Meine Schwester kommt zu mir. »Sie fehlt dir im Moment bestimmt unglaublich.« Kate legt den Arm um mich, ich schlucke meine Tränen hinunter. »Du bist nie über Moms Tod hinweggekommen, nicht wahr?«
Ich war zehn, als unsere Mutter ertrank, Kate noch ein Kleinkind. Manchmal beneide ich sie darum.
Ich schüttele den Kopf. »Ich will nicht über sie hinwegkommen.«
»Und jetzt hast du noch einen Menschen verloren, ein noch herberer Verlust. Aber irgendwann musst du weitermachen, Rik. Das würde Kristen auch wollen.«
Ich sehe sie an, spüre, wie die Tränen hinten im Hals aufsteigen. »Wie denn, Kate? Wie soll eine Mutter weitermachen, hm?« Ich umklammere ihre Arme und presse die Worte durch zusammengebissene Zähne hervor. »Verrat mir das! Das würde ich wirklich gerne wissen.«
»Ach, Süße.« Sie nimmt mich in die Arme. »Das wüsste ich auch gerne.«
Ich drücke die Wange an die Brust meiner Schwester und kneife die Augen zu. »Ich würde sofort mit Kristen tauschen, weißt du? Ich hätte kein Problem damit, für sie zu sterben – für meine beiden Töchter.«
»Das weiß ich. Aber deine Aufgabe ist ungleich schwieriger: Du musst weiterleben.«
Der Herbst geht in den Winter über, und die Natur gleicht meinem Inneren: ein trübes schwarz-weißes Stillleben. Die Weihnachtsferien bringen mich fast um. Annie und ich schleppen uns durch die Feiertage, tauschen trüb bedeutungslose Geschenke aus und begrüßen das neue Jahr ohne jeden Tusch, ohne Vorsätze oder Hoffnung. Annies zwanzigster Geburtstag kommt und geht, ich bestelle im Biosupermarkt eine Torte für sie und übers Internet ein Sweatshirt, das zwei Tage zu spät eintrifft. Ich glaube, wir fühlen uns beide wie Verräter, etwas ohne Kristen zu feiern.
Ich hangele mich von einer Stunde zur nächsten. Und stündlich ändert sich mein Gemütszustand: Eben noch empfinde ich einen derart rasenden Zorn, dass ich an den Straßenrand fahren und aufs Lenkrad einschlagen muss, und kurz darauf überfällt mich eine so erstickende Melancholie, dass ich an meinem Kragen ziehe, um Luft zu bekommen. Und im Zentrum dieses emotionalen Strudels lauert das endlose, kräftezehrende schwarze Loch der Schuld. Warum? Warum habe ich das Versprechen gegenüber meinen Töchtern gebrochen?
Um halb sechs an einem Montagmorgen im Februar sitze ich allein in meiner dunklen Küche und trinke einen Kaffee. Das kleine weiße Quadrat auf meinem Handy verkündet den Monatsletzten. Wie jeden Morgen wähle ich Kristens Nummer und warte auf ihre Ansage vom Band.
»Hey, hier ist Kristen. Nachrichten nach dem Signalton.«
Ich schließe die Augen, um mich in die Stimme meiner Tochter zu versenken.
»Mailbox voll«, verkündet eine andere Frauenstimme.
»Ich hab dich lieb«, flüstere ich trotzdem. »Es tut mir so leid, Süße.« Ich drücke auf Wahlwiederholung und raune noch eine Nachricht, gelobe, das Handy weiter zu bezahlen, um für alle Zeit meine Tochter hören zu können.
In dem Moment klingelt das Festnetz. Ich erschrecke. Als ich Kates Namen auf dem Display sehe, reiße ich mich zusammen und grüße fröhlich: »Hey, Katie. Du bist ja früh auf!«
»Ich backe vor der Arbeit Plätzchen für Molly und die Kinder. Jonah kommt heute aus dem Krankenhaus.«