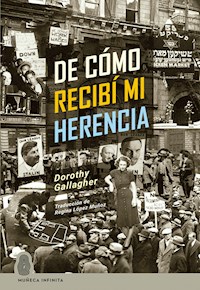15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AKI Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Dorothy Gallaghers Ehemann starb 2010. Jahrelang litt der Publizist und Verleger Ben Sonnenberg an Multipler Sklerose, war zuletzt beinahe vollständig gelähmt, doch sein wunderbarer, spielerischer Geist blieb ungetrübt. In Und was ich dir noch erzählen wollte bewegt sich Gallagher frei assoziierend zwischen Gegenwart und Vergangenheit, beschwört die gemeinsame Zeit mit ihrem Mann, seine letzten Tage, das Leben nach seinem Tod – allein, und in Gedanken doch immer bei ihm, in einer Welt, die heimgesucht wird von Erinnerungen, Erinnerungen, die ihr zugleich oft Trost bedeuten. Offen und unprätentiös spricht sie über die kleinen Dinge ihres Alltags in New York, den Umzug in eine neue Wohnung, wie sie sich dort einrichtet, auf der Dachterrasse Tomaten zieht, ihre zwei Hunde und die Katze Bones, wie sehr ihr die eleganten Anzüge ihres Mannes fehlen, aber auch seine zärtlichen, sehr britischen Liebesbekundungen. Gallaghers Mutter, am Ende besiegt von der Demenz, ist auch da, zusammen mit vielen Freunden, einer alten Schreibmaschine und einem Foto, nie aufgenommen, aber umso bedeutsamer für Gallaghers Beziehung zu ihrem verstorbenen Mann. Was Dorothy Gallagher hier erzählt, mag gewöhnlich erscheinen, doch wie sie es tut, lakonisch und tiefgründig, ist einmalig. Dieses schmale, zutiefst berührende Buch entfaltet die Beziehungsgeschichte eines Paares, Logik und Mysterium ihres Zusammenseins, erzählt von unheilbarem Verlust und unendlicher Liebe und destilliert so die Essenz des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 84
Ähnliche
Dorothy Gallagher
Und was ich dir noch erzählen wollte
Aus dem amerikanischen Englisch von Monika Baark
Für Ben, dann doch.
When I was a young girl,
well I had me a cowboy …
John Prine
Vorwort
Ben starb plötzlich an einem sonnigen Junimorgen im Jahr 2010. Im Oktober verkaufte ich die Wohnung, in der wir in den dreißig Jahren unserer Ehe gelebt hatten, drängte unsere betagte Katze in ihren Tragekorb und zog mit ihr ein paar Blocks weiter in die Studiowohnung im vierten Stock ohne Lift, die mein Büro gewesen war.
In den Monaten vor Bens Tod hatte ich angefangen, für ein Buch zu recherchieren, eine Biographie. Jetzt nahm ich die Arbeit daran wieder auf: Von frühmorgens bis zum frühen Nachmittag tauchte ich in ein fremdes Leben ein. Die verbleibenden Stunden des Tages und die Nächte waren dunkel vor Trauer, die Zeit, die ich mit dem Buch verbrachte, eine Atempause. Ich war so dankbar, beschäftigt zu sein.
Unweigerlich kam der Tag, da war das Buch fertig: Die letzte Zeile war geschrieben, der Text redigiert, die Fahnen gelesen. Dennoch ging ich jeden Morgen durchs Zimmer zu meinem Bürostuhl. Nicht um zu schreiben, nur um eine Weile in meinem Stuhl zu sitzen. Fast vierzig Jahre lang hatte mein Arbeitstag in diesem oder jenem Bürostuhl begonnen. In den Anfangsjahren saß ich an einer manuellen Schreibmaschine, im Einzug ein Blatt Papier, später an einer elektrischen Schreibmaschine, dann am Computer. Vor einem Schreibinstrument zu sitzen, zu redigieren, zu schreiben war eine lebenslange Gewohnheit, mehr als eine Gewohnheit, eine Sucht. In diesen Stunden ließen sogar Zahnschmerzen nach. Ich dachte nur an die Arbeit vor mir, erfüllt von maßloser Zuversicht, dass ich früher oder später in der Lage sein würde, alle damit einhergehenden Probleme zu lösen. Ich bin sicher, die Buddhisten haben ein Wort dafür.
Es war nie meine Absicht, über Ehe, Witwenschaft und Trauer zu schreiben. Trauer ist Trauer, kein Leben ist dagegen immun, und jede Menge Witwen haben sich darüber ausgelassen. Aber ich merkte, dass ich, wenn ich allein war, die ganze Zeit mit Ben Gespräche führte. Ich erzählte ihm, was ich machte, was ich dachte; ich erzählte ihm Geschichten über das, was seit seinem Tod passiert war; ich erinnerte mich an die Jahre, bevor wir uns kannten; ich schilderte ihm die neue Wohnung, die ich gefunden hatte; ich erzählte ihm vom Tod unserer Katze; ich sinnierte über unser Leben; ich erinnerte ihn an einen gelben Bademantel, den ich mal hatte; ich verhandelte alte Streitfragen, brachte alte Klagen zur Sprache; ich entschuldigte mich für dies und das, und auch für dies und jenes; ich erzählte von unseren Freunden: wer noch lebte, wer gestorben war, wen ich aus den Augen verloren hatte. Fünf Jahre vergingen, und ich führte immer noch Gespräche mit ihm. Eines verschneiten Februarmorgens, als ich sowieso in meinem Bürostuhl saß, fing ich an zu tippen.
Jalta
Sag mir: Glaubst du, dass mein Leben in den Jahren seit deinem Tod einfach so weitergegangen ist? Glaubst du, dass ich immer noch durch unsere Räume gehe, dass meine Kleider noch in den Schränken hängen, unsere Bilder noch dicht an dicht die Wände bedecken, unsere Bücherregale überquellen, dass alles, was wir hatten, noch immer an seinem Platz ist? Stellst du dir vor, dass ich, wenn es Abend wird, Licht mache und unsere Freunde kommen vorbei?
Nein, nichts dergleichen. Ich bin da nicht mehr. Fast alles ist weg – verkauft oder verschenkt. Als ich zum letzten Mal die Wohnungstür hinter mir schloss, waren die Zimmer leer, die Regale und Wände kahl, nichts mehr deutete auf unser Leben. Jetzt gehen wildfremde Leute durch diese Räume. Sie stehen am Fenster und sehen, wie die Sonne über dem Hudson versinkt, sie laden ihre Freunde ein und verbringen einen netten Abend, sie glauben, unsere Wohnung gehöre ihnen.
Soll ich dir erzählen, wo ich jetzt wohne? In zwei Zimmern, die in unser altes Esszimmer passen würden. Nein, keine Sorge. Du hast mich nicht mittellos zurückgelassen. Ich wohne in einem Penthouse, ich habe eine Terrasse, ringsum ist Himmel, ich sehe hinaus auf den Central Park, den Teich, wo die Trauerweiden wachsen, ich sehe hinüber zur Fifth Avenue, wo die Gebäude im Sonnenuntergang wie Feuer glühen.
Diese Wohnung habe ich ein Jahr nach deinem Tod gefunden. Erst dachte ich, nein, nicht groß genug, dann fiel mir wieder ein: Ich bin ja jetzt allein. In jenem ersten heißen Sommer züchtete ich Tomaten in Kästen und Cosmea in Töpfen. Spottdrosseln nisteten auf dem Dach. Sie sangen den ganzen Tag und brüteten Junge aus, die groß genug wurden, um durch meine offene Tür zu flattern. Einmal sah ich einen Habicht in der Luft schweben, am nächsten Morgen schwiegen die Vögel.
Noch lange nach meinem Umzug glaubte ich, es sei etwas schiefgegangen, als wäre ich in den falschen Bus gestiegen und im Leben einer anderen gelandet. Jeden Tag schrieb ich dir eine Mail, immer dieselbe: Wärst du doch nur hier. Wärst du doch nur hier. Wärst du doch nur hier. Manchmal wählte ich unsere alte Telefonnummer, wartete in der Leitung und versuchte, etwas aus der Stille herauszuhören.
Ich habe mich an die Stille gewöhnt, ich lebe ohne Stimmen oder Schritte. Manchmal kreischt unten eine Sirene, manchmal klingelt das Telefon, aber meistens höre ich nur das Klingeln in meinen Ohren und das Klicken des Kühlschranks beim An- und Ausgehen. Und den Wind: Wie er heult hier oben im siebzehnten Stock. Und dann kommt ein Tag wie heute, mitten im Februar, an dem kein einziger Windhauch geht. Der Himmel hat die Farbe von Zinn, Schnee hängt in der Luft wie ein Gazevorhang, die Gebäude jenseits des Parks sehen aus wie gemalte Theaterkulissen. Und, ob du’s glaubst oder nicht, zwei Trauertauben hocken auf dem Terrassengeländer.
Habe ich dir nicht gesagt, sei vorsichtig? »Steck dich bloß nicht bei mir an«, sagte ich. Wie dumm von mir. Ich war leichtsinnig gewesen, und du warst mir ausgeliefert. Vielleicht habe ich mich zu dir gebeugt und dir einen Kuss gegeben, wir haben von derselben Gabel gegessen, ich habe gehustet. Jedenfalls hattest du ein paar Tage später meine Erkältung in der Nase, am Abend rasselte dein Atem, am Morgen darauf hast du kaum noch Luft bekommen. Es war nur eine Erkältung, eine schwere Erkältung, ja, aber nicht deine erste. Was konnte schon passieren an diesem herrlichen sonnigen Junimorgen?
Ich kam mit dem Antibiotikum von der Apotheke zurück. Ich machte dir einen Tee mit Honig und Zitrone. Ich senkte kurz den Blick, um das Etikett auf der Pillendose zu lesen. Ich sah auf. Und was sah ich? Dein Mund stand halb offen, und ein dunkles Rinnsal Tee lief dir übers Kinn. Und deine braunen Augen, heller und klarer als der Tee, waren groß und starrten ins Leere! Leblos! In einem Wimpernschlag! Mitten im Gespräch! Warst du noch da? Hörtest du mich deinen Namen schreien?
Ich weiß, ich weiß. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Wenn der Tod käme, sollte ich ihn ruhig kommen lassen, wenn du sterben müsstest, dann wäre das so. Mit Panik haben wir nicht gerechnet. Und so geschah alles, wie wir es eben nicht gewollt hatten: der hektische Notruf, die Sanitäter, die Herzdruckmassage, das Atemgerät, der Krankenwagen, der dich mit Vollgas ins Krankenhaus bringt, die Intensivstation, wo du sechs Tage lang beatmet wirst, sediert wirst, im Koma liegst, nur hier und da für ein paar Minuten zu dir kommst, und in einem dieser Momente fragte ich dich: »Liebst du mich?« Und du, der nicht sprechen konnte wegen der Schläuche im Hals und der Sauerstoffmaske über dem Gesicht, zogst drei Mal die Augenbrauen hoch. Wie Groucho Marx. Das habe ich als Ja aufgefasst. Was, wenn ich gefragt hätte: »Vergibst du mir?«
Manchmal muss ich an eine Horrorgeschichte denken, die ich vor langer Zeit gelesen habe. In einer mondlosen Winternacht sitzen ein armer Müller und seine Frau in ihrer Hütte vor dem Feuer. Sie trauern um ihren einzigen Sohn, der in die Dreschmaschine seines Vaters geraten ist. Plötzlich taucht aus dem Nichts ein Geist auf. Er gewährt den Eltern einen Wunsch. Natürlich wünschen sie sich, ihr Sohn wäre wieder am Leben. Sehr wohl, sagt der Geist und löst sich in Luft auf. Kurz darauf klopft es an der Tür der Hütte. Freudig reißen der Müller und seine Frau die Tür auf. Dort steht ihr Sohn, verstümmelt und blutüberströmt, so wie im letzten Moment seines Lebens.
Was will uns diese Geschichte sagen? Trau keinem Geist? Der Tod hat das letzte Wort? Käme der Geist zu mir, ich würde ihn auf die Probe stellen. Ich würde ihn bitten, dich noch mal für eine Stunde, meinetwegen eine halbe Stunde, empfindungsfähig zu machen. Ich würde ein Datum angeben: Freitag, 11. Juni 2010, der Tag, an dem wir laut meinem Kalender allein in der Wohnung waren. Ich würde eine Uhrzeit angeben, fünf Uhr nachmittags. Die Sonne neigt sich über New Jersey, der Fluss funkelt wie ein Feuerwerk, und du bist gerade von deinem Nachmittagsschlaf aufgewacht.
Ein ganz normaler Tag also, nur dass ich mich offenbar erkältet habe. Wie üblich um diese Zeit sind wir im Schlafzimmer: du im Bett, ich am Tisch zwischen den beiden Fenstern. Du hast zwei Stunden geschlafen, bist aber immer noch müde; du bist andauernd müde in letzter Zeit. Deine Stimme ist so schwach, dass ich mich vorbeuge, um hören zu können, was du sagst. Worüber haben wir geredet an diesem Nachmittag? Ich kann mich nicht erinnern, es war nichts Wichtiges … Wer angerufen hat … Was ich abends kochen werde. Aber an diesem Tag, den uns der Geist gewährt hat, gibt es kein müßiges Geplauder. Wir wissen, was passieren wird. Wir wissen, dass unsere gemeinsame Zeit zu Ende geht, dass du in sieben Tagen, in dem Moment, als ich dir vorlese, was auf dem Etikett der Dose mit den Pillen steht, die dich gesund machen sollen, an dem Virus sterben wirst, das heute bei mir die ersten Symptome zeigt. Verstehst du, worum ich den Geist gebeten habe? Um nichts Großes. Um alles. Nur ein paar Minuten, um Abschied nehmen zu können.