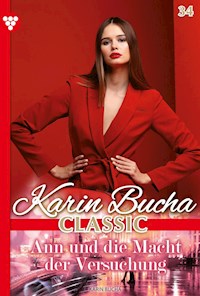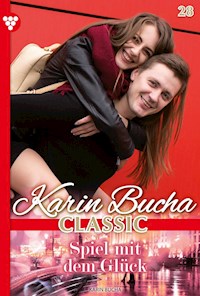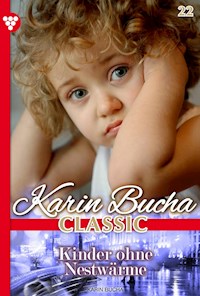Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. Es begann an einem Tag Anfang Juni. Die Sonne verschwendet sich in Wärme und Glanz. Stefanie Hollweg schiebt ihr Rad die Auffahrt zu dem langgestreckten weißen Landhaus hinauf, mit vor Eifer roten Wangen und vor Freude glitzernden Augen. Endlich hat sie die Schule hinter sich. Sie hat ihr Examen mit Auszeichnung bestanden und kann es nicht erwarten, der geliebten Mutter diese so wichtige Nachricht zu überbringen. Sie weiß, daß sie, wenngleich es auch für diese eine Freude sein wird, vorsichtig mit der Kranken umgehen muß. Doktor Hilmer hat es ihr gestern ans Herz gelegt. Noch ehe sie ihr Rad an die Hausmauer gelehnt hat, öffnet sich über den fünf Stufen zum Eingang die Tür, und Milchen, das Faktotum des Hauses, erscheint. »Mil –«, Stefanie verstummt jäh. gezerrt hat, schlägt zu Boden. chens. »Was ist los? Du hast geweint?« Und dann kommt es wie ein Schrei aus ihrem Munde. »Mutti! Ist etwas mit Mutti?« »Komm«, sagt Milchen, die treue Seele, nicht wegzudenken in ihrer Fürsorge und rastlosen Tätigkeit für die Herrin und die heranwachsende Tochter. Hemmungslos rinnen ihr die Tränen über das runde, gutmütige Gesicht und sie schiebt Stefanie, die an allen Gliedern bebt, vor sich her ins Haus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 5 –Und wenn es Liebe wäre?
Ich mußte erst durch tiefes Leid gehen
Karin Bucha
Es begann an einem Tag Anfang Juni. Die Sonne verschwendet sich in Wärme und Glanz.
Stefanie Hollweg schiebt ihr Rad die Auffahrt zu dem langgestreckten weißen Landhaus hinauf, mit vor Eifer roten Wangen und vor Freude glitzernden Augen.
Endlich hat sie die Schule hinter sich. Sie hat ihr Examen mit Auszeichnung bestanden und kann es nicht erwarten, der geliebten Mutter diese so wichtige Nachricht zu überbringen. Sie weiß, daß sie, wenngleich es auch für diese eine Freude sein wird, vorsichtig mit der Kranken umgehen muß. Doktor Hilmer hat es ihr gestern ans Herz gelegt.
Noch ehe sie ihr Rad an die Hausmauer gelehnt hat, öffnet sich über den fünf Stufen zum Eingang die Tür, und Milchen, das Faktotum des Hauses, erscheint.
»Mil –«, Stefanie verstummt jäh.
Das Rad poltert gegen die Mauer, die Mappe, die sie vom Hintersitz
gezerrt hat, schlägt zu Boden. Sie
stolpert, von einem jähen Schmerz erfaßt, die wenigen Stufen empor und umklammert die Schultern Mil-
chens.
»Was ist los? Du hast geweint?« Und dann kommt es wie ein Schrei aus ihrem Munde. »Mutti! Ist etwas mit Mutti?«
»Komm«, sagt Milchen, die treue Seele, nicht wegzudenken in ihrer Fürsorge und rastlosen Tätigkeit für die Herrin und die heranwachsende Tochter. Hemmungslos rinnen ihr die Tränen über das runde, gutmütige Gesicht und sie schiebt Stefanie, die an allen Gliedern bebt, vor sich her ins Haus.
In dem schönsten Zimmer des Hauses, in einem breiten Bett mit der blauseidenen Decke liegt Nina Hollweg. Kerzen brennen zu ihrem Haupte und lassen noch einmal ihre Schönheit geheimnisvoll aufblühen.
»Mutti, liebe – geliebte!«
Stefanie kniet vor dem Lager der Frau, die ihre Mutter war und ihre beste, ihre allerbeste Freundin. Sie ist wie benommen. Zu heftig war der Sturz aus einem wolkenlosen Glücksempfinden in diesen heftigen, würgenden Schmerz. Sie liegt wie hingemäht auf dem weichen hellen Fell vor dem Bett der toten Mutter und findet keine Tränen.
Leise murmelt sie vor sich hin, hält Zwiesprache mit der geliebten Toten, und Milchen, die am Türrahmen lehnt, kann diesen Jammer nicht mehr mit ansehen.
Lautlos gleitet sie neben Stefanie und hebt ihren Liebling vom Boden auf, und Stefanie flüchtet sich in die willig geöffneten Arme wie in ein warmes Nest.
»Gönn’ ihr die Ruhe«, sagt sie leise, nicht störend. »Sie hat sich so sehr danach gesehnt. Sie wollte ja nicht mehr leben –«
»Warum Milchen?« fragt Stefanie leidenschaftlich und schmiegt sich schutzsuchend fester in Milchens Arme. »Wir waren doch so glücklich – wir drei –«
»Ach, Kind.« Milchen streicht eine Locke des schweren schwarzen Haares aus Stefanies Stirn. »Wenn alles Glück wäre…« Sie vollendet nicht, sondern geleitet Stefanie, die jetzt ohne jeden Willen ist, aus dem Zimmer.
Noch einen Blick wirft Stefanie zurück. Die duftigen Mullgardinen flattern etwas im leichten Wind, und die Kerzen flackern auf. Wunderbar schön erscheint die tote Mutter dem jungen Menschenkind.
Und sie weiß nicht, daß sie diese Schönheit geerbt hat. Mit ihrem fast blauschwarzen Haar, den leuchtenden Blauaugen, dem dunklen südländisch anmutenden Teint, den etwas schrägstehenden Augenbrauen hat sie sogar etwas Exotisches an sich.
Im Wohnzimmer, das gleich neben der weiten Halle zur ebenen Erde liegt, wartet Doktor Hilmer auf sie. Er kommt dem verängstigten Mädchen rasch entgegen und umfaßt deren Hände.
»Es ging sehr rasch, Stefanie«, erklärt er mit seiner sanften, beruhigenden Stimme. »Sie hat nicht gelitten. Wenn dir das ein kleiner Trost sein kann.«
Stefanie zieht ihre Hände, die eiskalt sind und leicht beben, zurück. Alles nimmt sie wie hinter einem Schleier wahr. Selbst die Worte des Arztes, der dem Hause ein echter Freund ist, nimmt sie kaum zur Kenntnis. »Ach, Onkel Hilmer«, sagt sie nur.
Sie schlägt die Hände vor das Gesicht und weint bitterlich. Milchen und der stumm dabeistehende Arzt wechseln einen raschen Blick miteinander.
Milchen ist hinausgegangen. Später kehrt sie mit einem Tablett und starkem Kaffee zurück.
»Trink, Kind«, ermuntert sie Stefanie, und rein mechanisch nimmt Stefanie die Tasse aus Milchens Hand. Auch Doktor Hilmer bekommt seinen Kaffee.
»Sie haben es auch nötig«, sagt sie dabei. Der Arzt lächelt sie dankbar an. Sie macht den Eindruck, als habe sie Trost und eine Stärkung am nötigsten.
Hastig trinkt Doktor Hilmer das heiße Getränk. Dann erhebt er sich und geht auf Stefanie zu, die immer noch ihre Tasse in der Hand hält.
»Trink, Kind«, fordert er sie sanft auf, doch sie sieht ihn verständnislos an, dann bricht sie abermals in Schluchzen aus.
Dr. Hilmer nimmt ihr die Tasse aus der Hand und setzt sie neben Stefanie ab.
»Weine dich aus, Stefanie, weinen löst den Schmerz«, tröstet er. Ihm ist dabei selbst erbärmlich zumute. Er hat sehr viel Zuneigung zu den Bewohnern dieses Hauses und leidet jetzt mit Stefanie, als sei es sein eigenes Kind. Dabei hat er schon an unzähligen Totenlagern gestanden. Doch nie hat sein Herz so sehr mitgesprochen wie in diesem Falle.
Er hat sie sehr verehrt, trotz seiner molligen, mütterlichen Frau und den drei wohlgeratenen Kindern. Sie war so ganz anders als die Patienten, die er für gewöhnlich zu betreuen hat.
Er weiß, daß sie irgendein Geheimnis umgeben hat, das sie aber tief im Innern verwahrte. Und er war viel zu taktvoll, sie danach zu fragen.
Sie war seine Patientin, schwer herzkrank, mit schwachem Willen zum Leben. Selbst die heranblühende Tochter hielt sie nicht mehr. Sie lebte schon längst in einer anderen Welt, obwohl sie sich zwang, an dem täglichen Leben teilzunehmen.
Und nun haben sich die schönen, übergroßen, fiebrigen Augen für immer geschlossen. Zurück bleibt ein junges, unerfahrenes, von den Gefahren des Lebens nichts ahnendes Menschenkind.
Er beugt sich über das farblose, in sich gekehrte Gesicht Stefanies.
»Du wirst diesen Schock verwinden, Stefanie«, sagt er warmherzig und erntet dafür einen scheuen Seitenblick. »Du bist nicht allein, Kind. Milchen ist da, und wenn du einen Freund und Ratgeber benötigst, ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Hörst du?«
»Ich höre«, erwidert Stefanie tonlos und blickt wieder über den blühenden, Düfte verströmenden Garten.
*
Drei Tage später sitzt Stefanie wieder in dem behaglich eingerichte-
ten Wohnzimmer, diesmal hat ihr gegen über der Anwalt ihrer Mutter, Dr. Rösler, Platz genommen. Milchen hat sich in den Hintergrund zurückgezogen.
»Tscha«, beginnt er unbehaglich, das wie versteinert wirkende, verweinte Gesicht Stefanies mitleidig betrachtend. »Nun ist alles etwas anders geworden. Mit dem Tode Ihrer Mutter fallen die regelmäßigen Zahlungen fort. Ihnen gehört nunmehr nur das große Haus. Sie werden es kaum halten können.«
Stefanies Augen weiten sich unnatürlich groß.
»Die Zahlungen hören auf? Ich denke, wir sind wohlhabend? Woher kamen diese Zahlungen?«
Auf einmal tritt der Schmerz um die geliebte Tote in den Hintergrund. Dafür taucht das Gespenst der Ungewißheit um die Zukunft auf.
Stefanie neigt sich interessiert vor.
»Bitte, Doktor Rösler, was waren das für Zahlungen?«
»Die Zahlungen trafen regelmäßig von einer ausländischen Bank auf das Konto Ihrer Mutter ein. Woher sie kamen, weiß ich nicht«, erklärt er, sich zur Sachlichkeit zwingend.
»Und mit Muttis Tod fallen sie weg?« wirft Stefanie mit Herzklopfen ein.
»Ich mußte der Bank von dem
Ableben Ihrer Mutter Mitteilung machen und erhielt darauf diese Antwort.«
»Und – und was soll aus mir werden – und aus Milchen?« fragt sie verwirrt und bestürzt.
Bislang hat sie sich nie um Geld zu kümmern brauchen. Das haben Mutti und Milchen allein erledigt.
»Wenn es Ihnen recht ist, werde ich mich um einen Käufer kümmern. Von dem Gelde können Sie eine ganze Weile leben, da Sie ohne große Ansprüche sind.«
Stefanies Blick irrt hinüber zu dem stummen Milchen. Oh, Milchen – denkt sie verzweifelt. Wir sollen aus diesem Haus gehen, das wir beide so unendlich lieben.
Tränen verdunkeln ihren Blick, als sie den Kopf wieder wendet. Milchen sitzt regungslos, als habe sie keinen Anteil an der stattgefundenen Unterhaltung.
»Sie werden von mir hören, Doktor«, sagt Stefanie mühsam zum Abschied zu dem Anwalt.
Sie begleitet ihn bis zur Haustür und kehrt dann wieder zu Milchen zurück. Zunächst herrscht bedrückendes Schweigen zwischen ihnen, das Stefanie endlich bricht.
»Zuerst Muttis Tod – und nun diese Eröffnung, Milchen«, weint sie laut auf. »Das kann ich alles nicht begreifen.«
Auf leisen Sohlen nähert Milchen sich ihr, nimmt sie in die Arme und drückt sie an sich.
»Ich gebe zu, ein bißchen viel auf einmal, Kind, aber noch ist nichts verloren.«
»Milchen«, Stefanie hebt die in Tränen schwimmenden Augen zu der Alten empor, »weißt du nichts über diese geheimnisvollen Zahlungen? Du warst doch Muttis Vertraute. Du hast sie doch viel besser gekannt als ich. Was ist damit?«
Milchen kämpft einen kurzen Kampf, dann öffnet sie den Mund. Er zittert ein wenig. Doch was sie sagt, klingt klar und überzeugend.
»Die Zahlungen kamen von deinem Vater –«
»Von meinem Vater –?« Ungläubiges Staunen spiegeln Stefanies tiefblaue Augen wider. »Ich denke – er lebt nicht mehr?«
»Deine Mutter wollte es so«, berichtet Milchen sachlich weiter. »Deine Mutter war eine geborene Contessa Ricini aus einem alten italienischen Geschlecht. Sehr jung verliebte sie sich in den Arzt Doktor Hollweg, und sie erzwang von ihren Eltern die Heirat mit ihm.
Er hat sie sehr geliebt, aber er liebte auch seinen Beruf. Immer mehr entfernten sie sich voneinander, und Nina verließ ihn zuletzt, an Leib und Seele gebrochen. Sie hatte den Glauben an die Liebe deines Vaters verloren. Sie ließ sich nicht scheiden, und regelmäßig trafen dessen Zahlungen ein. Auch dieses Haus hat er ihr geschenkt. Er muß sie sehr geliebt haben, aber sein Beruf, dem er sich mit Leib und Seele verschrieben hatte, nahm alle Zeit in Anspruch. Er vergaß dabei, daß neben ihm eine zarte Frau lebte, die ihn über alles liebte, für die er das Vaterhaus, überhaupt die Welt bedeutete. Sie verließ ihn, weil sie nicht wollte, daß die Liebe zu ihm in ihrem Herzen starb. Nie hat sie an ihn geschrieben. Aber ich weiß, daß sie immerfort an ihn dachte und an die Zeit ihrer himmelstürmenden Liebe.«
»Und die Familie meiner Mutter?« fragt Stefanie atemlos.
»Sie hat sich natürlich sofort von deiner Mutter zurückgezogen. Für sie war deine Mutter schon tot, als sie den Professor heiratete.
»Warum aber hören nun mit Muttis Tod die Zahlungen auf?« forschte Stefanie erregt weiter.
Milchen gibt sich einen Ruck. »Weil dein Vater nichts von deiner Existenz weiß.«
»Mutti hat ihm das verschwiegen?« Sie schüttelt wie abwesend den Kopf. Nein! Sie findet sich nicht mehr zurecht. Sie hat irgendwo einen Vater, einen Menschen, der blutmäßig zu ihr gehört und der nicht weiß, daß er eine Tochter hat? Wie konnte Mutti das über das Herz bringen!
»Hat Mutti vielleicht geglaubt, mein Vater würde einen Anspruch auf mich erheben?« Ihr Mund verzieht sich erbittert. »Ich wäre niemals zu ihm gegangen, wenn sie es mir gesagt hätte. Wenn er meiner Mutter soviel Herzeleid zugefügt hat, niemals!«
»Und wenn es Liebe war, die die beiden Menschen, die füreinander geschaffen schienen, auseinanderbrachte?«
»Liebe?« Stefanie macht eine verächtliche Handbewegung. »Meine Mutti war so liebenswert, was sind dagegen Ruhm und Ehre, darum ging es schließlich meinem Vater.«
»Kind, Kind«, wehrt Milchen ab. »Du hast ihn nicht gekannt. Er ist ein wertvoller Mensch. Aber Liebe kann sich zu einem schweren Problem auswirken. Auch du wirst nicht davon verschont bleiben. Glaube es mir. Vielleicht sollten wir versuchen, Verbindung mit deinem Vater aufzunehmen?«
»Keinesfalls!« Stefanies schönes Gesicht ist wie in flammende Glut getaucht. »Er hat meine Mutti unglücklich gemacht, während sie ihm alles opferte. Nein! Ich will nichts mit diesem Mann zu tun haben, nur weil er zufällig mein Vater ist.«
»Nicht so stürmisch«, beschwichtigt Milchen besonnen. »Wir werden es uns noch einmal genau überle-gen.«
»Bei mir gibt es nichts zu überlegen, Milchen«, fällt Stefanie ihr hart in die Rede. »Jedenfalls nichts, was meinen Vater betrifft. Wir müssen nur sehen, wie wir weiterkommen. Darüber sprechen wir noch. Ich bin müde, Milchen.« Stefanie befreit sich aus Milchens Umarmung und erhebt sich. »Ich lege mich hin. Essen mag ich nichts.«
»Eine Tasse heißen Tee wenigstens«, schlägt Milchen besorgt vor. »Ich bring ihn dir ans Bett.«
»Meinetwegen«, sagt Stefanie und verläßt das Zimmer, von Milchens besorgten Blicken verfolgt.
Noch schmaler, noch schlanker erscheint das Kind in dem schwarzen Kleid. Trotz ihres leidenschaftlichen Aufbegehrens liegt etwas Hilfloses, Verlorenes über der zierlichen Erscheinung.
Stefanie sucht ihr Zimmer auf, das Zimmer, das sorgsame Mutterhände liebevoll für ihr Kind ausgestattet haben.
Sie entkleidet sich schnell und schlüpft unter die Decke. Sie fühlt sich an Leib und Seele wie zerschlagen. Sie ist fast einer Ohnmacht nahe, so sehr hat sie das Gehörte mitgenommen. Im Kopf spürt sie einen rasenden Schmerz, und ihr Herz ist wie aus Stein. Jedes Gefühl scheint daraus geflohen.
Sie grübelt dennoch. Mutti, liebe Mutti – sinnt sie – ich verstehe dich so gut. Ich hätte nicht anders gehandelt. Wie kann Milchen behaupten: Und wenn es Liebe war? Liebe kann die Menschen doch nicht auseinandertreiben? Sie muß sie unlösbar verbinden, meint sie.
Gehorsam nimmt sie Schluck um Schluck, als Milchen mit dem Tee erscheint. Milchen fühlt unendliches Erbarmen mit ihrem Liebling. Aber sie vermeidet, noch einmal auf das Gespräch zurückzukommen.
»Versuch zu schlafen, Kind«, sagt sie gütig und streicht zärtlich über das schwere, jetzt gelöste blauschwarze Haar Stefanies. »Schlaf hast du jetzt nötiger als alles andere.«
*
Bei Rom, auf einem Hügel gelegen, inmitten üppiger Vegetation, umgeben von einem gepflegten Park, liegt Professor Clemens Hollwegs berühmtes Sanatorium.
Er ist eine nicht zu übersehende Erscheinung mit seiner hohen, in den Schultern breiten, in den Hüften schlanken Gestalt.
Nicht nur ein bekannter Chirurg ist er, sondern auch Wissenschaftler. Tief im Park versteckt liegt sein Labor, und nur wenige Vertraute, zu denen Philipp Titanus gehört, haben dazu Zutritt.
Durch die breite Glastür kann Hollweg seine Privaträume bequem erreichen. Doch meist hält er sich im Sanatorium und in der angeschlossenen Klinik auf. Eigentlich hat er überhaupt kein Privatleben, wie Dr. Titanus immer wieder feststellen muß. Er lebt für seine Kranken und für die Wissenschaft. Das scheint ihn völlig auszufüllen. Es ist schon eine Auszeichnung, wenn er Philipp einmal zu sich in seine Wohnung bittet, und dabei wird auch wieder nur gefachsimpelt.
Im Augenblick sitzt Professor Hollweg regungslos im Sessel am Kamin ein Schreiben des Anwaltes seiner Frau in den Händen. Er hat es immer wieder gelesen, und erst nach und nach den Inhalt begriffen. Nina tot! Sein Herz zieht sich im Schmerz zusammen. Jetzt ist sie zum zweiten Male gestorben für ihn, doch diesmal für immer. Nie wieder wird er die schönen Blauaugen in Liebe auf sich gerichtet fühlen. Nie wieder wird er den weichen Körper an seinem Herzen spüren.
Er glaubt, längst darüber hinweg zu sein und muß erkennen, daß immer die Hoffnung neben ihm gewesen ist: Einmal kommt Nina zu mir zurück.
Was ihn aber völlig aus dem Gleichgewicht wirft, ist die Tatsache, daß er eine Tochter hat, eine achtzehnjährige Tochter, Stefanie heißt sie. Und er hat nichts von ihr gewußt. So grausam konnte Nina sein, ihm diese Tochter zu unterschlagen?
Eine beängstigende Stille ist um den Mann, der auf das Blitzgespräch nach Deutschland wartet. Sekunden dehnen sich zur Ewigkeit, und die Unruhe in ihm verstärkt sich zusehends.
»Stefanie.«
Zärtlich spricht er den Namen vor sich hin. Seine Tochter! Er hat einen Menschen, der blutmäßig zu ihm gehört? Der Gedanke berauscht ihn geradezu. Stefanie! Stefanie! Er versucht, sich ein Bild von ihr zu machen. Gleicht sie ihm? Oder ist sie das Ebenbild ihrer zierlichen und doch hochgewachsenen Mutter, mit den leuchtend blauen Augen und dem tiefschwarzen Haar? Da reißt ihn die Glocke des Fernsprechers aus seiner Versunkenheit. Er eilt an seinen Schreibtisch und hebt den Hörer ab.
»Ja, hier Hollweg!«
Am anderen Ende meldet sich eine Stimme und stellt sich als Dr. Rösler vor. Nachdem sie einige Höflichkeiten gewechselt haben, beginnt Hollweg erregt zu sprechen.
»Über meine Bank wurde mir Ihr Schreiben zugeleitet, Herr Doktor. Ich bin erschüttert über das Ableben meiner Frau, mehr noch über die Tatsache, daß ich eine Tochter habe. Sie können es mir glauben, ich habe bis zur Stunde nichts von ihrem Dasein gewußt. Vielleicht wäre alles anders gekommen.«
Hollweg zwingt seine Stimme zur Festigkeit.
»Selbstverständlich möchte ich sofort nach Deutschland zu meiner Tochter kommen. Aber ich kann nicht von heute auf morgen aus meinem Betrieb heraus. Sie werden das verstehen. Bitte, lieber Doktor, teilen Sie meiner Tochter mit, daß die Zahlungen auf jeden Fall an sie weitergehen. Ich möchte stehenden Fußes zu ihr eilen. Doch es geht wirklich nicht. Vielleicht können Sie veranlassen, daß Stefanie zu mir kommt? Zumindest zahlen Sie ihr das Geld aus, das heute noch an Sie überwiesen wird. Ich möchte nicht, daß meine Tochter in Not kommt. Haben wir uns verstanden?«
Er lauscht auf die Antwort, und nach einigen gewechselten Reden hängt Hollweg befriedigt ein. Merkwürdig! Die Stimme flößt ihm Vertrauen ein. Dieser Dr. Rösler wird auch seine Interessen wahren.
*
Acht Tage später sitzt Stefanie Hollweg dem Rechtsanwalt ihrer Mutter in seiner Kanzlei gegenüber. Telefonisch hat er sie zu sich gebeten, um ihr Wichtiges mitzuteilen.
»Die Zahlungen gehen weiter«, springt er gleich auf den Kernpunkt der Sache.
»Wieso weiter?« fragt Stefanie, keineswegs beeindruckt, unheimlich ruhig.
»Ich habe mich bei der Bank erkundigt«, erwidert Rösler.
»Das haben Sie getan?«
Stefanies Augen verdunkeln sich. Wie Eiseskälte weht es von ihr zu ihm.
Unbehaglich rutscht Dr. Rösler auf seinem Sitz hin und her. Das sieht genauso aus, als wäre sie ihm böse, dabei hat er nur ihr Bestes im Auge gehabt.
»Ja, das habe ich getan«, wiederholt er mit Nachdruck und benetzt mit der Zunge die trockenen Lippen. »Dabei erfuhr ich, daß die Zahlungen von Ihrem – Ihrem Vater geleistet wurden. Ja, ich habe selbst mit ihm gesprochen, telefonisch natürlich. Ich muß schon sagen, ich war sehr beeindruckt, denn Ihr Vater hatte erst jetzt über die Bank erfahren, daß er eine Tochter hat.«
Er hält inne und betrachtet sie aufmerksam. Aber vergeblich sucht er nach einer Gemütsbewegung. Kühl, abweisend ist ihre Haltung, fast feindselig. Mit einem kleinen Seufzer vollendet er:
»Sie werden keine Not zu leiden haben. Ihnen steht so viel Geld zur Verfügung, wie Sie benötigen. Dar-über hinaus würde Ihr Vater, Professor Hollweg, schnellstens zu Ihnen kommen, aber er kann im Augenblick nicht weg. Ich habe Verständnis dafür. Wie wäre es, wenn Sie zu ihm führen? Er bat mich so dringend um diese Vermittlung.«
Stefanies Lippen verziehen sich verächtlich.
»Ich danke Ihnen für Ihr Eingreifen. Sie haben es sicher gut gemeint.« Es klingt kalt und wenig erfreut. »Sie können meinem – meinem Vater mitteilen, daß ich auf sein Geld verzichte. Auch auf seinen Besuch lege ich keinerlei Wert, ebenso wenig wie zu ihm nach Rom zu fahren. Keinen Pfennig nehme ich von ihm an. Wollen Sie ihm das mitteilen?«
Völlig fassungslos blickt Dr. Rösler auf das junge Mädchen, das mit einer Handbewegung ein kleines Vermögen ausschlägt.
»Aber – aber«, stammelt er ratlos. »Sie werden es sich überlegen. Stellen Sie sich vor, das Geld kommt von Ihrem Vater, von keinem Fremden –«
»Nichts gibt es für mich zu überlegen«, unterbricht sie ihn entschieden. »Für mich ist dieser Mann ebenso wenig mein Vater wie ich für ihn seine Tochter. Da sind so viele Dinge, über die ich einfach nicht hinwegkomme.«
Eindringlich betrachtet der Anwalt das schöne, jetzt leidenschaftlich glühende Geschöpf.
»Und wie stellen Sie sich Ihre weitere Zukunft vor?«
Auf einmal ist alles Selbstbewußtsein, alle Energie zusammengebrochen. Hilflos, die Augen zu Boden gesenkt, gesteht sie.
»Ich weiß nicht – ich – ich weiß es wirklich nicht.«
Dr. Rösler steht auf und kommt zu ihr. Väterlich besorgt legt er seine Hand auf ihre Schulter.
»Überlegen Sie sich alles ganz genau«, gibt er zu bedenken. »Warum sollen Sie sich mit Zukunftssorgen quälen, wenn sich alles so einfach regeln läßt?«
Voll Erbitterung sieht sie ihn an. Kann sie ihm sagen, daß sie von diesem Mann, der zufällig ihr Vater ist, kein Geld annehmen kann? Von demselben Mann, der ihre liebenswerte Mutter hat zugrunde gehen lassen, zugrunde an dieser tiefen Liebe, die sie für ihn empfand und über die er sich wegen seiner Arbeit bedenkenlos hinweggesetzt hat?
Ehrlich und gerecht, wie sie ist, muß sie zugestehen, daß er in großzügiger Weise für sie gesorgt hat. Aber es gibt auch eine seelische Not, und in die hat er die zartbesaitete Frau zweifellos gestürzt. Dabei spielt keine Rolle, daß sie ihm ihre Geburt verschwiegen hat.
Stefanie erhebt sich. Ganz klar ist es in ihr geworden.
»Nochmals Dank, Doktor.« Sie nimmt die Hand des Anwaltes, der ehrlich bekümmert ist. »Ich ändere meine Entscheidung nicht. Ich will nichts von dem Gelde und nichts von dem Manne wissen, der mein Vater ist und dessen Namen ich trage.
Bedrückt und unzufrieden mit sich selbst kehrt Rösler zu seiner Arbeit zurück. Da spielen Dinge mit, in die er lieber den Kopf nicht stecken will.
Er ruft schweren Herzens seine Sekretärin und schreibt an Professor Hollweg von der negativ verlaufenen Unterredung.
*
Stefanie geht durch den strahlenden Sonnentag wie eine Fremde. Ihre Beine verrichten mechanisch ihren Dienst, aber gleichgültig, wohin sie führen. Ihr Kopf ist leer, wie ausgebrannt.
Aber ein Gespenst geht mit ihr. Die Not. Was soll aus ihr, aus dem treuen Milchen werden? Was aus dem schönen Haus, das sie so unsagbar liebt und das sie wohl verkaufen muß?
Lieber Gott, was soll ich tun? Sie weiß später nicht, wie sie den Bus erreicht hat und in das Haus zu Milchen zurückgekommen ist. Sie muß erbärmlich ausgesehen haben, denn Milchen hat sie wortlos in die Arme genommen und keinerlei Fragen gestellt.
Erst später, als Stefanie nach einem unruhigen, von häßlichen Träumen geplagten Schlummer die Augen aufschlägt und Milchen neben sich auf einem Stuhl hocken sieht, beginnt sie, von der Unterredung mit Dr. Rösler zu erzählen.
»Habe ich falsch – oder richtig gehandelt, Milchen?«
Milchen nimmt Stefanies kühle Hand auf und streicht behutsam dar-über hin.
»Ich nehme an – richtig, Kind. Deine Mutter hätte nicht anders gehandelt. Sie war unbändig stolz.«
»Was aber soll werden, Milchen? Wie lange können wir noch leben? Wie lange das Haus halten? Vielleicht hätte ich mehr an dich als an mich denken sollen?«
»Unsinn.« Milchen fegt mit der Hand durch die Luft. »Auf mich brauchst du überhaupt keinerlei Rücksicht zu nehmen, Kind. Wir werden einen Ausweg finden. Vorläufig können wir ungefähr einen Monat leben, wenn wir sparsam sind. Die Abgaben für das Haus und Grundstück sind erst in einem Vierteljahr fällig. Auf irgendeine Weise werden wir es schon schaffen. Schade nur, daß wir dieses wunderschöne Haus in der lieblichen Landschaft verlassen müssen. Wie oft haben es Fremde bewundert. Einen Käufer werden wir schnell finden.«
»Milchen!« Mit einem Ruck sitzt Stefanie aufrecht. »Mir kommt ein Gedanke, das heißt, du hast mich darauf gebracht. Fremde bewunderten oft die Landschaft und unser hineingebettetes Haus. Könnten wir – könnten wir nicht eine Fremdenpension daraus machen? Denk an das viele Land, das dabei ist. Wir könnten mehr Gemüse ziehen, Hühner anschaffen – ach –«
Vor Erregung verschlägt es ihr den Atem, und Milchen wiederholt leise:
»Eine Fremdenpension?«