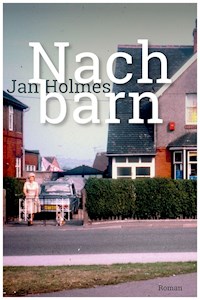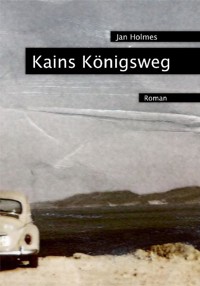Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Unmenschen" erzählt die Geschichte dreier Individuen, die aus unterschiedlichen Gründen am Rande der Gesellschaft stehen und deren Lebenswege sich auf verhängnisvolle Art und Weise kreuzen: Der menschenscheue Meier arbeitet als Hausmeister an einer Schule, die alternde Brigitte ist eine Prostituierte, die ihre Freier in einem Wohnwagen bedient, und der feige Sven verdient sich zur Zeit mit Erpressungen seinen Lebensunterhalt. Meier lernt Brigitte durch Zufall kennen und empfindet trotz ihres Berufs starke Zuneigung zu ihr. Während Sven eines Nachts seinen Geschäften nachgeht, trifft er auf Meier und vernachlässigt dadurch seine Sorgfalt. In Folge dieser Begegnungen gerät Meier zunehmend in Geldnöte, denkt Brigitte ans Aufhören, und Sven wiegt sich in falscher Sicherheit - ihr gemeinsames Schicksal steuert auf eine Katastrophe zu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Holmes - UnmenschenTexte, Umschlagfoto und -gestaltung:© Copyright 2016 by Jan HolmesVerlag: Jan [email protected] - www.janholmes.dec/o KJ Funke, Bechlenberg 61, 42799 LeichlingenDruck: epubli
Jan Holmes
Unmenschen
Meier
Montagmorgen, fünf Uhr. Der Wecker schrillte Meier aus seinem unsteten Schlaf, in dem er von beunruhigenden Träumen geplagt wurde. Es war zwar schon über drei Monate her, dass er seine neue Wohnung bezogen hatte, trotzdem wusste er öfters nicht, wo er war, wenn er erwachte. Diese Momente der Desorientierung zwischen Schlaf und Wachen wurden seltener, machten ihm deswegen aber nicht weniger Angst.
Es war Herbst und trotz des Vollmondes noch dunkel in seinem kleinen Zimmer. Fröstelnd steckte Meier seine Füße unter der Decke hervor, suchte seine Hausschuhe und fand sie nach kurzem Umhertasten. Er hätte schwören können, sie am Vorabend so platziert zu haben, dass er direkt hätte hineinsteigen können, und doch musste er suchen. Er ärgerte sich über seine Ungenauigkeit und tastete nach dem Lichtschalter. Er hatte bereits mehrfach versucht, sich in der neuen Wohnung auch im Dunkeln zurechtzufinden und ohne Licht ins Bad zu gehen, war aber kläglich gescheitert und hatte sich blaue Flecke an den Schienbeinen zugezogen, weil sein Geist noch immer „zu Hause“ war. Dieses „zu Hause“ war das Haus seiner Eltern, in dem er geboren und aufgewachsen war, und dort hätte er mit verbundenen Augen jeden einzelnen Raum schnellen Schrittes durchmessen können, ohne ein einziges Mal anzustoßen, so sehr war die Lage jedes Möbelstücks in sein Gehirn gebrannt.
Meier blinzelte im aufflammenden Licht und griff nach der Türklinke. Nein, falsch, das war die Küche, nicht das Bad, im Haus seiner Eltern existierte alles an einem anderen Ort. Er ermahnte sich zu Aufmerksamkeit und schüttelte ungläubig den Kopf über seine eigene Dummheit.
Im Badezimmer war alles vorbereitet, ein dickes Handtuch lag vor der Wanne, um seine nassen Füße nach der Dusche in Empfang zu nehmen, ein weiteres hing, sorgfältig ausgerichtet, mittig über der Stange des Vorhangs, beide Seiten exakt gleich lang herabhängend, dabei aber so platziert, dass es beim Duschen nicht nass werden würde.
Wie alles in Meiers Leben folgte auch seine morgendliche Reinigungsprozedur einem genau festgelegten Plan. Er entkleidete sich, faltete den Schlafanzug sorgfältig zusammen und legte ihn auf den Rand des Waschbeckens. Er klappte den Deckel der Toilette hoch, riss einige Blätter Papier ab und wischte damit über die Brille, obwohl niemand außer ihm jemals dieses Bad benutzte. Er setzte sich, stützte die Ellenbogen auf seine Oberschenkel und das Kinn auf seine Handballen. Zufrieden lauschte er dem Plätschern, wartete eine angemessene Zeit, erhob sich, betätigte die Spülung, wartete, wischte erneut über die Brille und klappte dann den Deckel wieder herunter.
Er stieg in die kleine Wanne, zog den Vorhang zu und drehte die Brause zur Wand, um nicht vom eiskalten Wasser getroffen zu werden. Äußerst vorsichtig öffnete er beide Hähne der alten Armatur gleichzeitig und stellte sich zitternd auf die Zehenspitzen, als die Flüssigkeit unter seinen Fußsohlen hindurchrann. Es dauerte eine ganze Weile, bis ihm die Temperatur angenehm war, jetzt drehte er die Brause in seine Richtung, stellte sich unter den Strahl und begann mit der Wäsche. Zuerst eine genau bemessene Menge Shampoo in die linke Hand, Haarwäsche, danach Seife für das Gesicht, den Hals, Brust und Bauch, dann die Arme, der Rücken. Es folgte der Intimbereich, die Beine, zuerst das linke, dann das rechte, danach die Füße in derselben Reihenfolge. Er spülte sich ab, krampfte sich innerlich zusammen und drehte den Heißwasserhahn zu. Zwei, drei arktische Sekunden verharrte er unter der Polarkälte des eisigen Wassers, erst dann schloss er auch den zweiten Hahn. Kneippbäder mit wechselnden Wassertemperaturen sollten sehr gesund sein, hatte er gelesen, und trotz der täglichen Überwindung, die es ihn kostete, hielt er sich eisern an diese Prozedur.
Er wischte sich mehrfach kräftig über den Kopf, um möglichst viel Wasser aus seinen Haaren zu wringen, zog den Vorhang zurück, nahm das Handtuch von der Stange und stieg aus der Wanne. Er rubbelte sich ab, zuerst die Haare, dann die Körperteile in einer festgelegten Reihenfolge, von der er niemals abwich. Das Handtuch war, wie immer, von seiner Mutter ohne Weichspüler gewaschen worden, hart wie ein Brett und rau wie ein Reibeisen. Er kannte und mochte es nicht anders und genoss das Kribbeln seiner geröteten Haut, die langsam erwachte.
Zurück im Zimmer zog er sich an, sämtliche Kleidungsstücke lagen auf einem alten Stuhl aus dunklem Holz bereit, den ihm sein Vater vermacht hatte, als er von zu Hause ausgezogen war. Es handelte sich um einen Schreibtischstuhl, den der Vater zu Hause zusammen mit einem alten Sekretär in einem Raum aufbewahrte, der das „Schreibzimmer“ genannt wurde, obwohl Meier noch nie gesehen hatte, dass irgendjemand dieses Zimmer genutzt, geschweige denn, darin etwas geschrieben hatte. Jetzt diente der schwere Stuhl mit den massiven Rollen und den vielen Macken nachts als Ablage für Meiers Kleider und tagsüber als einzige Sitzgelegenheit im Zimmer, in dem neben dem Bett, einem Tisch mit seinem Computer und ein paar Büchern sowie einer Kommode für seinen kleinen Fernseher kaum noch etwas Platz hatte. Aber wofür brauchte er schon Platz?
Meier zog sich an, die Unterhose und die Socken lagen zuoberst, danach ein weißes Unterhemd und ein warmer Pullover, zuletzt die blaue Latzhose. Seine graue Mütze mit den ausklappbaren Ohrenwärmern brauchte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sie hing deswegen an der Garderobe im Flur, darunter die schweren Stiefel, die er zu jeder Jahreszeit trug.
In der Küche setzte er Wasser auf, der Tisch war schon gedeckt, das hatte er am Abend zuvor erledigt. Holzbrett und Messer, der Eierbecher nebst Löffel und eine Tasse, in der ein Teebeutel wartete, standen bereit, dazu ein Glas für Saft und ein kleiner Esel aus Porzellan, der Pfeffer und Salz in zwei Körben trug.
Meier ging durch die Diele, griff nach dem Schlüssel, der im Schloss steckte, und entriegelte die Tür. Er öffnete sie und nahm einen tiefen Zug der frischen Morgenluft. Seine noch feuchten Haare durchfuhr eine kalte Brise, und er beeilte sich, die Zeitung von der Fußmatte zu nehmen und sich schnell wieder in die Wohnung zurückzuziehen. Auf dem Weg in die Küche zog er den widerspenstigen Rollladen an einem alten, abgegriffenen Riemen hoch und warf einen Blick auf die Schule gegenüber. Keine Regung durchfuhr sein Gesicht, aber innerlich freute er sich auf den Tag. Er mochte die Schüler, zumindest einige von ihnen, die freundlichen, die um Erlaubnis fragten, bevor sie in seinen Geräteraum kamen und sich Sachen ausborgten. Er mochte den Umgang mit den jungen Menschen, lächelte über ihre Lebensfreude, ihre Unbekümmertheit, ihr Spiel in den Pausen, und litt mit denen, die am Nachmittag die Schule mit schlechten Noten verließen und sich bange auf den Weg nach Hause machten.
Er legte die Zeitung auf den Küchentisch und goss das Wasser auf den Teebeutel. Sechs Minuten, Zeit, die er nutzte, um sich im Bad mit einem weiteren Erbstück seines Vaters, der schon vor Jahren auf ein modernes Gerät umgestiegen war, zu rasieren. Er zog das Messer ein paar Mal am Lederriemen ab, der neben dem Waschbecken hing, bereitete den Schaum, seifte sich ein und schabte sich behutsam die Stoppeln aus dem Gesicht.
Zurück in der Küche war das Fenster vom Wasserdampf beschlagen, er kippte es, goss den Tee auf, nahm ein Ei aus dem Kühlschrank, das er mit einer Nadel, die er mit einem Magneten an der Kühlschranktür befestigt hatte, einstach und dann in das restliche Wasser gab. Er sah auf die Uhr, genau drei Minuten und eine halbe, damit das Eiweiß schon geronnen und fest war, das Eigelb aber noch flüssig. Im Brotkasten bewahrte er Schwarzbrot auf, er aß zwei Scheiben, eine mit der Marmelade, die seine Mutter kochte, eine mit Fleischwurst, die Scheiben waren abgezählt für eine Woche, am Samstag wurde dann für die nächste Woche eingekauft. Hätte Meier jemals Besuch bekommen und ihn bewirten müssen, hätte das seine Vorratsplanung völlig durcheinandergebracht.
Nach dem Frühstück und dem anschließenden Putzen der Zähne, ging Meier in den Flur, schnürte seine Stiefel, setzte die Mütze auf, die Ohrenwärmer nach oben geklappt, so kalt war es noch nicht, nahm den Schlüssel und verließ die Wohnung. Er zog die Tür zu, kontrollierte, ob sie auch wirklich ins Schloss gefallen war, und drehte dann den Schlüssel zweimal.
Es war noch nicht einmal sechs Uhr, und es würde noch gute eineinhalb Stunden dauern, bis die ersten Schüler eintrafen, aber bis dahin hatte Meier noch einige Dinge zu tun, die er lieber jetzt als gleich erledigt wusste. Zuerst machte er eine Runde um das Schulgebäude und kontrollierte und leerte die Mülleimer. Das war gleichzeitig seine letzte Amtshandlung am Abend, und er wunderte sich jedes Mal, dass morgens trotzdem immer Abfall in den Behältern vorzufinden war. Er konnte sich nicht vorstellen, wer sich des Nachts in der Nähe der Schule aufhalten und Müll produzieren würde. Auch die Sporthalle wurde, bis auf einige wenige Ausnahmen am Wochenende, spätestens um acht Uhr geschlossen, und seinen letzten Rundgang unternahm er nicht vor neun Uhr. Er bewaffnete sich trotzdem mit Handschuhen und einer Müllzange und sammelte den Unrat auf, der sich zusätzlich neben den Eimern (wie konnte man die verfehlen?) und auf dem umliegenden Gelände fand. Mit Bedauern betrachtete er einen kurzen Moment den Schülergarten, der vor einigen Wochen im Rahmen einer Projektwoche angelegt, seitdem aber sträflich vernachlässigt worden war. Die kleine Grünfläche war zur Hälfte zertrampelt worden, auf dem Rest der Parzelle wuchs mehr Unkraut als irgendetwas anderes.
Als Hausmeister war Meier das Auge und die eintausend Ohren der Schule, und eigentlich hatte er die Idee begrüßt, den Schülern die Gartenpflege nahezubringen, ihnen zu zeigen, wie man Verantwortung übernimmt und Freude daran haben konnte, etwas wachsen und gedeihen zu sehen. Schnell wurde aber klar, dass das Projekt nur von den Schülern angenommen wurde, die sich schon vorher für Pflanzen interessiert hatten, und dass die große Mehrheit der anderen überhaupt nicht daran dachte, sich um etwas zu kümmern, was auf lange Sicht nur einem nützen konnte: der Schule. Aus der Sicht der Schüler galt es dem entgegenzuwirken, daher war es nicht verwunderlich, dass sich der „Garten“ in dem Zustand befand, den Meier jetzt gerade vor sich sah.
Er verstaute den prall gefüllten blauen Müllsack in einem der Container, den er zuvor von einem schweren Vorhängeschloss befreien musste. Die Experimente einiger Schüler mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten sowie Feuerwerkskörpern hatte die Schulleitung zu dieser Sicherheitsmaßnahme gezwungen. Meier ließ das Schloss nach getaner Arbeit einschnappen und zog zur Kontrolle noch ein paar Mal heftig daran, bevor er den schweren Schlüsselbund wieder an die Kette legte und in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Er hatte Wochen gebraucht, bis er die unzähligen Schlüssel den richtigen Türen zugeordnet hatte, und auch jetzt noch kam es vor, dass er manches Mal mehrere Minuten lang vor einem Raum stand, einen Schlüssel nach dem anderen ausprobierte und dabei nervöser und unruhiger wurde, vor allem, wenn sich bereits eine feixende Gruppe von Schülern um ihn versammelt hatte, die jeder seiner erfolglosen Versuche nur noch zu weiterer Häme anstachelte. Meier ließ das alles über sich ergehen. Seine stämmige Statur schützte ihn davor, dass die Schüler auch körperlich zudringlich wurden, und so ließ er sie einfach reden. Das meiste von dem, was sie sagten, verstand er ohnehin kaum.
Meier betrat das Schulgebäude durch einen Seiteneingang, verschloss die Tür wieder sorgfältig und stieg hinab in die Eingeweide der Schule, die die Schüler (und die meisten Lehrer) nie zu Gesicht bekamen. Er machte eine Runde durch die Keller- und Heizungsräume, die nur spärlich beleuchtet waren und immer ein wenig nach Desinfektionsmitteln rochen, obwohl hier nie geputzt wurde und die Reiniger in einem anderen Teil des Gebäudes untergebracht waren. Er überprüfte die Temperatur des Kessels und sah nach, ob es Lecks in den endlosen Rohrleitungen gab, denn das hatte ihm der Direktor eingeschärft: Im letzten Winter hatte jemand, der nicht näher genannt wurde, ein Fenster im Keller offenstehen lassen, und ein plötzlicher Frost Ende November ließ einen Großteil der Heizungsrohre zufrieren, was durch den Rückstau fast die gesamte Anlage zerstörte. Die Schüler hatte es zunächst gefreut, denn es sah so aus, als würden die Weihnachtsferien in diesem Jahr bereits Anfang Dezember starten, doch dann hatten ein Abkommen mit den Schulen der Nachbarorte und zusätzlich angemietete Räumlichkeiten dem verfrühten Fest ein jähes Ende bereitet. Für Meier bedeutete dies aber, jeden Abend noch einmal in den Keller zu steigen und sich doppelt zu vergewissern, dass kein Fenster offenstand. Zusätzlich leuchtete er den Boden der Kellergänge mit einer Taschenlampe ab, um Pfützen besser entdecken zu können. Die Heizung war ihm anvertraut, also kümmerte er sich darum.
Um sieben Uhr schaltete er das Licht ein, das sich flackernd zunächst ein wenig sträubte, dann die Eingangshalle aber schnell mit weißem Licht flutete, in die sich in einer halben Stunde die Masse der Schüler ergießen würde, der jüngeren zumeist. Warum es viele so eilig hatten, verstand Meier nicht. Wenn er die Unterhaltungen, die er oft mit anhörte, richtig interpretiert hatte, waren die meisten Schüler nicht gerade angetan von der Schule. Darüber hinaus hatte jeder Schüler einen bestimmten Platz, meist sogar denselben in jedem Raum, soweit er wusste, denn beim Unterricht war er natürlich nicht anwesend, aber so kannte er es aus seiner eigenen Schulzeit. Es bestand also kein Mangel an Stühlen oder Sitzplätzen. Vielleicht gab es einen Wettbewerb unter den Schülern, wer am schnellsten auf seinem Platz sein würde, aber auch das konnte nicht sein, denn die Klassenräume wurden vor der ersten Stunde erst von den Lehrern geöffnet, die sie benutzten, die Schüler mussten also noch eine Weile auf dem Gang warten, bevor sie ihre unruhigen und scheinbar erwartungsvollen Körper durch die enge Türöffnung pressen konnten. Das gegenteilige Verhalten war allerdings bei den älteren Schülern zu beobachten. Sie kamen erst in letzter Minute, manche zogen noch hastig an einer in der Faust verborgenen Zigarette, kurz bevor sie den Eingang passierten, und bliesen den Rauch rebellisch ins Schulgebäude – allerdings nur dann, wenn gerade kein Lehrer in Sicht war, das hatte Meier genau beobachtet. In jedem Fall aber landeten die Stummel der Zigaretten im Beet neben dem Eingangsbereich, wurden von der feuchten Erde im Laufe des Tages durchweicht und konnten mit der Müllzange abends kaum noch gegriffen werden, so dass er regelmäßig mit seinen Handschuhen im Dreck wühlte. Aber das gehörte zu seinen Aufgaben, also beschwerte er sich nicht. Auch hielt er nie einen Schüler an, seinen Abfall selbst wieder aufzuheben oder wies den täglichen Mülldienst an, die Beete ebenfalls zu säubern. Dieser Dienst rekrutierte sich aus einer Handvoll Schüler der Unterstufe und sollte den Schulhof nach der großen Pause von all dem Unrat befreien, den ihre Mitschüler achtlos hatten fallen lassen. Das meiste blieb allerdings an Meier hängen, da die Säuberungskräfte des Mülldienstes einen Großteil ihrer Zeit vor dem nahen Kiosk verbrachten, um ihr Taschengeld in Süßigkeiten umzusetzen, statt den Müll aufzusammeln, von dem sie wussten, dass er am nächsten Tag sowieso verschwunden sein würde.
Die letzten Momente, in denen Meier allein in der Schule war, genoss er am meisten. Er sah sich zufrieden um, atmete den immer noch wahrnehmbaren Geruch der Putzmittel ein, die die Reinigungskolonne am Vorabend verwendet hatte, und wünschte sich, dieser Zustand der Ordnung könnte über die Woche, den Tag oder auch nur die nächste Stunde gerettet werden. Aber er wusste nur zu genau, dass bald die ersten Lehrer kommen und die Ruhe stören würden, gefolgt von ein paar Schülern der Oberstufe, denen es erlaubt war, vor Beginn der Schulzeit die Eingangshalle zu betreten, um die Aushänge über anstehende Prüfungen oder Änderungen im Lehrplan zu betrachten. Es war offensichtlich, dass besonders in den kalten Monaten von diesem Vorrecht ausgiebig Gebrauch gemacht wurde, um nicht bei Schnee und Eis draußen warten zu müssen, aber immer war ein Lehrer mit der „Bewachung“ des Eingangsbereichs betraut, und so kümmerte sich Meier nicht weiter darum.
Sobald die Schulglocke, die eigentlich ein elektronisches Signal war und mit einer Glocke nicht das Mindeste zu tun hatte, aber so hatte man sie zu Meiers Schulzeit genannt, sobald also die Schulglocke erklungen war, würde die Hölle losbrechen, es würde laut werden und eng, es würde geschubst und geschrien, geschoben und geflucht werden, was Meier nicht gut ertragen konnte. Er war zufrieden, wenn er eine Aufgabe gut zu Ende bringen konnte, am besten allein, am allerbesten in einem eigenen Raum, in seiner Werkstatt. Man hätte nicht sagen können, dass er Angst vor Menschen hatte, aber ihm ging es besser, wenn möglichst wenige in der Nähe waren. Sprach man zu ihm, schlug er die Augen nieder, blickte fast nervös umher und bewegte seine Finger suchend in seinen Hosentaschen. Aber jede Aufgabe, die ihm übertragen wurde, nahm er gewissenhaft wahr, er fragte nach, wenn er etwas nicht verstand, und gab keine Ruhe, bis der Auftrag bis ins Detail zu seiner Zufriedenheit erledigt war. Diese Art konnte natürlich zu Problemen führen, denn nur weil Meier meinte, er habe eine Aufgabe begriffen, musste das noch nicht heißen, dass das, was er verstanden hatte, auch das war, was sein Gegenüber ihm hatte sagen wollen. So konnte es vorkommen, dass er einen Auftrag zwar in Perfektion erledigte, das Ergebnis aber etwas völlig anderes als das gewollte war. Nachdem es zu ein paar wenigen, unangenehmen Missverständnissen gekommen war, hatten sich der Schuldirektor und alle anderen, die Meier hin und wieder Aufgaben übertrugen, daran gewöhnt und bemühten sich stets, ihre Anforderungen möglichst klar und eindeutig zu formulieren. Ein Außenstehender hätte meinen können, dass die Ansprache in diesen Fällen an ein kleines Kind gerichtet war, aber Meier merkte nichts davon, und so waren alle zufrieden.
Noch bevor der Ansturm losbrach, war Meier in seiner Werkstatt verschwunden und machte sich daran, eine Reihe von Stühlen zu reparieren.
Brigitte
Wegen des Arzttermins war Brigitte an diesem Tag früher aufgestanden, normalerweise schlief sie um diese Zeit noch, aber sie wollte die Erste im Sprechzimmer sein, da sonst die Wartezeiten nicht auszuhalten waren. Daher war es draußen noch ein wenig dämmrig, als sie schon im Wartezimmer saß und sich in einem fort die Augen rieb. „Nehmen Sie noch einen Moment Platz“, hatte die Sprechstundenhilfe gesagt. Warum eigentlich? Sie war die Erste hier, worauf sollte sie denn warten? Bis die Ärztin sich ein Frühstück genehmigt hatte? Oder einen Schnaps, damit sie ihren Job ertragen konnte? „Das wäre nichts für mich“, dachte Brigitte und musste grinsen. Den ganzen Tag nur ekelhafte Krankheiten direkt vor der Nase, davon lag sie mit ihrem Beruf ja meilenweit entfernt. Gut, von einem anderen Standpunkt aus betrachtet, arbeitete sie auch nicht wirklich nah an der Grenze zur klinischen Reinheit, sonst wäre sie auch nicht regelmäßig hier. Aber dennoch: Müllmänner und Frauenärzte rangierten aus ihrer Sicht in Sachen Reinlichkeit noch deutlich unter ihr, und für sie zählte nun einmal nur ihre Sicht.
Sie schaute sich im Wartezimmer um und langweilte sich. Die abgegriffenen „Lesezirkel“ mit ihren Boulevard-Blättern sah sie sich schon lange nicht mehr an. Die Geschichten über die letzten Aktivitäten irgendwelcher Trottel aus irgendwelchen Königshäusern und die neuesten Mutmaßungen über andere Idioten, die die Zeitschriften unerklärlicherweise für erwähnenswert erachteten, ermüdeten sie noch mehr als alles andere. Da war stumpf vor sich hin zu starren noch besser, als sich diesen Unsinn durchzulesen. Sie ließ ihren Blick schweifen, der Raum war gänzlich in öden Pastelltönen gehalten, es gab fleischfarbene Schränke und Anrichten, darauf Vasen mit Plastikpflanzen, die Wände sahen nikotingelb aus, fast so wie die Vorhänge in ihrem Wohnwagen. Dazu schien irgendwo im Zimmer eines dieser Raumdeos versteckt zu sein, denn es roch auffällig nicht nach Arztpraxis, sondern irgendwie künstlich, nach Plastik-Pfirsich oder etwas Ähnlichem. Sie grinste und betrachtete die riesigen Bilder, die überall aufgehängt waren und ausnahmslos Blüten zeigten, die weiblichen Genitalien ähnelten. Ob es dafür wohl einen speziellen Beruf gab? „Guten Tag, darf ich mich vorstellen, ich bin Mösenblüten-Fotograf.“ Dafür musste eine spezielle Industrie existieren, mutmaßte sie, ein vollständiger Geschäftszweig, der weltweit diese lächerlichen Bilder produzierte. Und sobald die Neuigkeit die Runde machte, dass eine neue Blume, eine besonders schöne der Gattung Orchidaceae Vaginaris gesichtet worden war, machten sich Horden von Mösenblüten-Fotografen auf den Weg, um die neue Pflanzenmuschi zu fotografieren und Frauenärzte weltweit damit zu beglücken. Was sollte das überhaupt? Meinte jemand tatsächlich, dass Frauen nicht wüssten, wie sie unten herum aussahen und deshalb mit solchen Bildern aufgeklärt werden mussten? Sollten die Patientinnen schon einmal thematisch eingestimmt werden? Was für ein Unsinn.
Eine weitere Frau betrat das Wartezimmer und nickte Brigitte wohlwollend zu, so als wären sie beide Teil einer gemeinsamen aber hoch geheimen Verschwörung. Brigitte starrte unbeteiligt zurück, und ihr Blick fiel auf das Kind, das an der Hand der Frau lief. Der Junge hätte ein nettes Kerlchen sein können, aber seine Mutter hatte offensichtlich Komplexe und eine Mischung aus Dressman und Perückenständer aus ihm gemacht. Der Kleine konnte gerade eben allein laufen und trug eine für sein Alter völlig abwegige Frisur, die eine Hälfte hochgeföhnt, die andere mit Gel an den Kopf geklebt. Seine Klamotten waren noch grotesker, befand Brigitte nach einem kurzen Blick: Der Junge trug eine Lederhose, die wahrscheinlich ein Vermögen gekostet hatte und ihm in einem Monat nicht mehr passen würde, dazu Turnschuhe einer bekannten Marke und ähnlicher Halbwertzeit, ein Halstuch und einen Pullover mit der Aufschrift: „Minnesota Soccer 1972“. „Wer denkt sich so einen Blödsinn aus?“, dachte Brigitte. Es gab offensichtlich mehr Berufe, als man gemeinhin annahm. Hier war die Ausprägung eines weiteren zu sehen: Texter für schwachsinnige Sprüche auf Kinderpullovern. Sie ignorierte die offensichtlich viel zu stolze Mutter und starrte auf eine Mösenblüte, die ihr ihre Lippen auf unfassbaren drei Quadratmetern entgegenstreckte. In der Zwischenzeit hatte sich das zukünftige Laufstegwunder seiner Mutter entwunden und begann damit, die ausgelegten Zeitschriften in akkurate kleine Fetzen zu reißen und den ein oder anderen davon zu essen. Brigitte dachte sich, dass die Mutter offensichtlich noch schwerwiegendere Probleme hatte als ihren Modetick, denn diese machte keinerlei Anstalten, ihren Sprössling von seinem Tun abzuhalten. Modezombie-Attitüde gepaart mit antiautoritärer Erziehung, das könnte eine interessante Kombination werden, aber Brigitte würde es wahrscheinlich nie erfahren, denn zu ihrem Kundenkreis würde ein derart verzogenes Balg wohl niemals gehören, dem stand der Sinn nach Höherem, da ging unter ein paar richtig großen Scheinen für eine Nummer gar nichts.
Die Lippen verschwammen vor Brigittes Augen, als der Kurze gerade anfing, sein Werk der Zerstörung mit lautem Kreischen und Johlen zu begleiten, aber glücklicherweise wurde sie durch den Ruf der Ärztin erlöst, die ihren Kopf aus dem Behandlungszimmer streckte und sie zur Untersuchung hereinrief. Brigitte folgte nur zu gerne und drückte sich eilig an der Ärztin vorbei, die ihr die erste der Doppeltüren aufhielt.
Im Behandlungszimmer versuchte Brigitte erfolglos, ihre Nervosität zu überspielen. Nicht, dass sie Angst vor der Untersuchung gehabt hätte, es würde schon alles in Ordnung sein, sie hatte keinerlei Anzeichen einer Erkrankung, die letzte Infektion mit Tripper war Jahre her, an das letzte geplatzte Gummi konnte sie sich kaum noch erinnern. Und trotzdem war sie hier auf der Liege mit den Beinstützen nur eine schüchterne Frau, sie fühlte sich mehr als nackt und schämte sich beinahe für ihre Weiblichkeit. Vielleicht lag es daran, dass sie bei der Ausübung ihres Berufs immer die Zügel in der Hand behielt und sie es war, die bestimmen konnte, was passierte und was nicht. Hier war sie hilflos und ausgeliefert, fühlte sich klein und verletzbar und war jedes Mal heilfroh, wenn es vorüber war.
Die Ärztin war freundlich, aber nüchtern und professionell distanziert, Brigitte hatte nicht den Eindruck, dass sie wegen ihres Berufs Vorurteile hatte. Trotzdem wirkte sie ein wenig abwesend, so als wollte sie eher jetzt als gleich mit der Untersuchung fertig sein, und Brigitte fragte sich, ob die Ärztin die Frau mit den Komplexen und dem kleinen Kind genauso behandeln würde. Aber im Gegensatz zu dem, was Brigitte bei anderen Ärztinnen schon erlebt hatte, war das hier das reinste Paradies. Und bei einem Arzt war sie nur ein einziges Mal gewesen. Kälter als seine Hände war nur noch sein Blick, und als er sie fragte, ob sie Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Sexualpartnern betreibe, bildete sie sich ein, er würde sich nicht nur wünschen, dass sie zustimmte, sondern auch, dass sie ihn direkt in die Reihe dieser Partner aufnahm.
Zurück auf der Straße zündete sich Brigitte eine Zigarette an, inhalierte tief und schüttelte sich kurz. Sie zog die Augenbrauen hoch, seufzte und lächelte schon wieder beim Gedanken an die überdimensionalen Blüten im Wartezimmer. Es blieben ihr noch ein paar Stunden bis zum Beginn ihrer Schicht, aber es war noch zu früh, eine ihrer Kolleginnen anzurufen und zu einem gemeinsamen, späten Frühstück abzuholen, daher machte sie zunächst nur ein paar Besorgungen und fuhr dann zurück in ihre kleine Wohnung, um ein wenig aufzuräumen und ihre Katze zu versorgen.
Der Blick aus dem Fenster ihrer Küche ging in einen Innenhof und zeigte ihr täglich nichts anderes als Backsteinmauern und verzinkte Balkongeländer, die erst im letzten Jahr neu angebracht worden waren und im grotesken Gegensatz zur bröckelnden Fassade standen, die sie jetzt zierten. Wenn man den Hals verrenkte, konnte man ein Stück Himmel sehen, aber im Moment war das die Mühe nicht wert, es sei denn, man konnte einem einheitlich-schmierigen Grau etwas abgewinnen. Brigitte setzte eine zweite Kanne Kaffee auf, goss die Blumen und stellte der Katze eine große Portion Futter hin, die für den ganzen Tag reichen würde. Während der Kaffee durchlief, wechselte sie die Katzenstreu aus, wischte die Fensterbänke und brachte ihr Bett in Ordnung. Sie ordnete die Kissen auf dem Sofa neu und rückte an ein paar Bildern herum, die gar nicht schief hingen. In den Wechselrahmen gab es Aufnahmen ihrer Eltern und ihres Sohnes, ein Gruppenfoto mit ihren Kolleginnen und ein paar der Vorgängerinnen ihrer Katze.
Sie füllte die Thermoskanne mit dem Kaffee, kippte das Fenster und rauchte die nächste Zigarette. Durch ihren Kopf zogen Bilder, die sie aber nicht festhielt, sie blickte einfach ins Leere, durch die Mauern der Nachbarhäuser hindurch in eine unbestimmte Ferne. Auf die Frage, ob sie glücklich sei, hatte sie keine Antwort, aber sie stellte diese Frage auch nicht, für sie ging es darum, ob sie zufrieden war, und das war sie. Hätte ihr jemand einen Koffer Geld vor die Tür gestellt, hätte sie die Sachen sofort hingeschmissen, wäre in eine andere Stadt und in eine schönere Wohnung gezogen, aber was dann? Zufriedenheit war für sie nicht das Gefühl, versorgt zu sein, sich um nichts kümmern zu müssen, denn das war gleichbedeutend mit Langeweile. Zufrieden bedeutete, sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, ob man in der Lage sein würde, die Miete zu bezahlen, oder aus einem Fenster blicken zu können, das keine schöne Aussicht bot, und sich trotzdem wohlzufühlen. Glück war das nicht, aber was war es dann? Das, was die Plastikmenschen im Fernsehen, diese abgeleckten Arschlöcher, einem verkaufen wollten? Diese Märchen, die sie einem jeden Tag auftischten, in sogenannten Dokumentationen und in den angeblichen Nachrichten? Bestimmt nicht. Es war Jahre her, dass Brigitte eine Zeitung angefasst hatte, und den alten Fernseher hatte sie nicht ersetzt, als er endlich den Geist aufgab. Lediglich einen Film im Kino gönnte sie sich von Zeit zu Zeit, das aber auch nur dann, wenn die Kolleginnen sie mitschleppten.
Das erste Klingeln des Telefons drang nur schwerlich durch den Nebel ihres Tagtraums, sie brauchte eine kurze Weile, um zurückzukehren, drückte die Zigarette aus und nahm den Hörer. Tanja, eine ihrer jüngeren Kolleginnen, wollte sich mit ihr zum Frühstück treffen. Brigitte war plötzlich nicht nach Gesellschaft zumute, aber trotzdem sagte sie zu. Tanja war eine der angenehmeren Frauen, mit denen sie täglich zu tun hatte. Jung und knackig, noch am Anfang ihrer Karriere, trotzdem aber bei Weitem nicht so naiv und blauäugig wie viele, die sie schon hatte kommen und gehen sehen, die meinten, sie könnten das schnelle Geld machen und sich nach ein paar Jahren Arbeit zur Ruhe setzen und nur noch am Strand liegen. Dass sie einen Knochenjob verrichteten, merkten die Mädchen schnell genug, entsprechend hoch war der Durchsatz an neuen Gesichtern und Körpern, aber nur wer seinen Beruf liebte, ihn nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Herz ausführte, konnte so lange bestehen, wie Brigitte es getan hatte. Das erzählte sie zumindest jedem, den es etwas anging, aber wichtiger war, dass sie selbst daran glaubte.
„In einer halben Stunde im Mickys, bis dann.“
Sie legte auf und machte sich daran, die Tasche mit ihrer Arbeitskleidung und ein paar Utensilien zu füllen, die sie nach jeder Schicht mit nach Hause nahm, um sie zu reparieren, zu flicken oder einfach nur fachgerecht zu säubern und auszukochen.
Einige Zeit später war sie bereit und die Tasche gepackt, der Tag konnte zum zweiten Mal beginnen.
Sven
Eine harte, arbeitsame Nacht lag hinter ihm, als Sven an diesem Morgen endlich nach Hause kam und erschöpft ins Bett fiel. Zuvor jedoch nahm er seine Beute und befestigte sie mit einem Klebestreifen unter dem Küchentisch. In dem kleinen Tresor, den er sich im letzten Monat an die Wand in seinem Kleiderschrank geschraubt hatte und der durch einen Stapel Wäsche verborgen war, bewahrte er nur ein paar unwichtige Papiere auf. Der Tresor diente als reines Ablenkungsmanöver, aber Sven freute sich schon jetzt diebisch über die Augen, die jemand machen würde, wenn er das Ding öffnete. Nicht, dass er vorgehabt hätte, es jemals so weit kommen zu lassen, aber Vorsicht war schließlich immer noch besser als Nachsicht, und ein Joker in der Hinterhand hatte noch niemandem geschadet. Trotzdem war der kleine Metallschrank hinter seinen Hemden nur ein humoristischer Luxus, den er sich gönnte, denn Sven war wahrscheinlich einer der umsichtigsten Menschen, die es jemals gewagt hatten, ihr Geld auf unehrliche Weise zu verdienen. Er hatte immer mindestens zwei Fluchtwege offen, hielt sich ständig den Rücken frei und arbeitete ausschließlich mit Profis zusammen. Witterte er die geringste Möglichkeit eines Risikos, brach er einen aussichtsreichen Job lieber ab, als dass er seinen Arsch hingehalten hätte, wie er es gerne formulierte.
Svens Arbeitstage waren zurzeit eher Arbeitsnächte und begannen, wenn Normalsterbliche bereits den Schlaf der Gerechten schliefen. Üblicherweise stand er nicht vor dem frühen Nachmittag auf, widmete sich einem ausgiebigen, sehr späten Frühstück und einer fast krankhaften Körperpflege und sammelte dann Informationen. Gestern hatte er neues Material von einem seiner Spürhunde bekommen, und nach Sichtung der äußerst vielversprechenden Unterlagen hatte ein Lächeln der Vorfreude um seine Lippen gespielt: Verheiratet, drei Kinder, Beamter im gehobenen Dienst, wohnhaft in einer Kleinstadt, in der er einiges Ansehen genoss. Das machte es umso einfacher. Großstädter, die nicht gerade ein öffentliches Amt bekleideten, waren rücksichtsloser und weniger bedacht auf ihren Ruf. Sollte der Nachbar doch denken, was er wollte. In einer Kleinstadt wirkte das Netz aus sozialer Kontrolle noch besser und effektiver, dort hatte man oft einen Großteil seines Lebens verbracht, war vielleicht sogar dort aufgewachsen oder hatte sich den Ort für seinen Ruhestand ausgesucht, sich ein üppiges Anwesen bauen lassen und plante, sein Alter hier zu verleben. Aus so einem Ort zog man nicht so einfach weg, man würde alles tun, um Schaden von sich und seiner Familie abzuwenden. Kompromittierende Fotos im Schaukasten der katholischen Kirchengemeinde konnten einem angesehenen Polizeibeamten oder dem beliebten Leiter einer Jugendgruppe schon einmal eine Gänsehaut über den Körper jagen. Und natürlich half es nichts, die Fotos schnell verschwinden zu lassen, die Abzüge würden überall sein, in der Post, an öffentlichen Plätzen und Bushaltestellen, am Kiosk und überall sonst, wo sich viele Menschen aufhielten, die nichts Besseres zu tun hatten, als die Neuigkeit zu verbreiten.
Zu gern hätte Sven die Verzweiflung in den Augen seiner Opfer gesehen, hätte ihnen aufgelauert, sie aus dem Augenwinkel beobachtet, wie sie den Umschlag öffneten. Wie sie die Fotos betrachteten, sich dann verstohlen umblickten, ob sie niemand gesehen hatte. Wie sie den Brief überflogen und ihn dann schnell in der Tasche verschwinden ließen, bevor sie langsam die Panik ergriff, ihnen der kalte Schweiß ausbrach und sich die Zukunft vor ihrem inneren Auge in einen flammenden Pfad zur Hölle verwandelte. Sie würden nicht wissen, was sie zu tun hatten. Leugnen konnten sie nicht, die Beweise lagen klar auf der Hand, wegrennen würde auch nichts nützen, denn sie hatten Familie und berufliche Verpflichtungen. Sich der Sache zu stellen und ihre Verfehlung zuzugeben, oder sich ihr feige zu entziehen und das Land oder zumindest die Stadt für immer zu verlassen, waren ebenfalls keine Optionen, denn solchen Kandidaten hätte Sven niemals geschrieben. Seine Recherchen mussten einwandfrei ergeben, dass er es mit Angsthasen zu tun hatte, mit wehrlosen Arschlöchern, denen eine kleine Spende nicht wehtun würde, wenn man bedachte, was sie dafür bekamen: Ihren Frieden, die Rückkehr zur Normalität, die Möglichkeit, ruhig und nicht schweißgebadet aufzuwachen, die Chance, noch einmal neu anzufangen. Und so kam es, dass die einzigen Abzüge, die jemals von Svens Fotos gemacht worden waren, in die Hände seiner Opfer gespielt wurden. Bisher hatte jeder gezahlt, nie musste er einen weiteren Schritt tun und seinen stärksten Verbündeten, die Öffentlichkeit, hinzuziehen. So viel Spaß es ihm auch gemacht hätte, aber in dieser Sache war Sven Ehrenmann: Ein gegebenes Versprechen wurde eingehalten, niemals melkte er dieselbe Kuh ein zweites Mal. Zum einen, weil er es zugesagt hatte, zum anderen fürchtete er, ungeahnte Kräfte in seinen Sponsoren zu mobilisieren, wenn er sein Wort brach. Wenn man es nüchtern betrachtete, war Sven ein Feigling.
Aber selbst eine so unschöne Sache wie Erpressung konnte man sich schönreden, wenn man nicht vollständig auf den Kopf gefallen war. Und das war Sven beileibe nicht, denn sonst hätte ihn schon sein erster Kunde bei den Eiern gekriegt, da war er sich sicher. Natürlich konnte er mit seinem Geschäftsmodell nicht hausieren gehen, aber wenn er eines seiner zahlreichen Selbstgespräche führte, betrachtete er sich gern als eine Art moderner Wohltäter, ein Seelsorger, wenn man so wollte. Er brachte Menschen dazu, auf den rechten Weg zurückzukehren. Er erlegte ihnen eine Buße auf, gab ihnen einen Stoß in die richtige Richtung und trug so zu einer besseren Gesellschaft bei. Er musste selbst grinsen und fletschte die Zähne bei diesen Gedanken.
In der Nacht hatte er seine übliche Runde erledigt und war seinen momentanen Arbeitsplatz angefahren. Er wechselte die Plätze alle paar Monate, den aktuellen bearbeitete er erst seit knapp zwei Wochen, aber das Material, dass er bis jetzt zusammenbekommen hatte, sah schon sehr vielversprechend aus. Sobald er die Bestätigung von seinem ehemals ordnungshütenden Kontaktmann erhalten hatte, konnte die nächste Welle Rechnungen an seine Kunden geschrieben werden.
Wie üblich war er den Großteil der Strecke zu seinem „Einsatzort“ mit seinem Auto gefahren, einem sportlichen, aber dunklen und ansonsten eher unauffälligen Wagen. Ginge es nach ihm, würde er in einer weißen Limousine durch die Gegend kutschieren, aber hier siegte seine Vernunft über die Eitelkeit: Wenn man nicht auffallen wollte, konnte man unmöglich mit einer Maschine vorfahren, an die sich selbst noch ein absoluter Vollidiot mehrere Monate später ohne Mühe erinnern konnte. Er parkte in sicherer Distanz und ging den Rest der Strecke zu Fuß, immer auf den Hut, niemandem aufzufallen. Er tarnte sich als harmloser Spaziergänger, was nicht gerade die einfallsreichste Verkleidung war, aber für jemanden, der sich mitten in der Nacht allein im Wald herumtrieb, war das wahrscheinlich noch die beste Alternative. Er trug dunkle Kleidung, schwere Stiefel und einen Hut mit breiter Krempe, hinter der er seine Augen verstecken konnte. Zu seiner Ausrüstung gehörte neben dem Akku und der Speicherkarte, die er austauschen würde, noch eine technische Errungenschaft, die eher seinem Spieltrieb als wirklicher Notwendigkeit entsprungen war, die er jetzt aber nicht mehr missen wollte: Von einem Bekannten hatte er aus Armeebeständen für einen wahren Spottpreis ein Nachtsichtgerät erstanden, und es bereitete ihm eine diebische Freude, es zu benutzen. Hatte er zunächst daran gezweifelt, dass das Gerät überhaupt funktionierte, hatte er es nach einer Reihe erfolgreicher Tests, die einige verstörte bis zu Tode geängstigte Joggerinnen als Nebenwirkung zeigten, akzeptiert und in sein Arsenal aufgenommen.