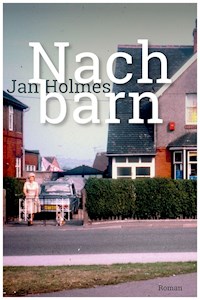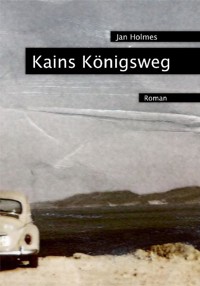Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hattest du eine glückliche Kindheit? Diese harmlose Frage in einem harmlosen Spiel unter Freunden schickt Bruno weit in seine Vergangenheit zurück. Er wächst nach dem Tod seines Vaters unter den strengen Augen seiner Mutter auf. Diese versucht beinahe fanatisch, ihre Kinder von der Außenwelt fernzuhalten, die sie als feindlich empfindet. Durch seine Großmutter lernt er jedoch eine andere Wirklichkeit kennen, die größer und freier ist als alles, was er sich jemals vorstellen konnte. Ein Roman über die Hoffnung und die Suche nach dem Glück in einer Welt voller Zweifel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Holmes
Ein Zimmerohne Aussicht
Jan Holmes – Ein Zimmer ohne AussichtTexte, Umschlagfoto und -gestaltung:© Copyright 2019 by Jan HolmesVerlag: Jan [email protected] – www.janholmes.dec/o KJ Funke, Bechlenberg 61, 42799 LeichlingenDruck: epubli
Heute
Die Sonne war längst untergegangen, es war stockdunkel, nur das Lagerfeuer erhellte die Runde der Freunde. Wir hatten uns sattgesehen an den Unmengen an Sternschnuppen, die über dem Atlantik ihre Bahnen zogen und hier sichtbar waren, abseits der Städte, die mit ihrem nebligen Schein den Himmel anstrahlten und alles unsichtbar machten, was sich dort bewegte. Es war kalt, wir hüllten uns in Decken, hielten uns aneinander fest, erzählten Geschichten, Anekdoten, Witze, bis uns nichts mehr einfiel. Fast alle Getränke waren geleert, wir sahen einander an, beinahe peinlich berührt angesichts der Stille, die von uns ausging, während die Wellen im Hintergrund rauschten, aber wir hörten sie nicht mehr. Irgendjemand spielte mit einer leeren Flasche, rollte sie vor sich hin und her, sah in die Runde, nahm eine Zigarette von seinem Nachbarn und starrte wieder auf das Glas, in dem die Flammen sich spiegelten. Er drehte die Flasche, die sich im Sand kaum bewegte, sodass der Hals direkt neben ihm zur Ruhe kam. Er blickte auf, sah seine Freundin an und fragte: »Wahrheit oder Pflicht?« Sie lachte, ließ ihren Blick durch die Runde schweifen und wusste, dass wir spielen würden. »Pflicht«, sagte sie und musste ihren Freund dafür küssen. Die anderen johlten, fanden die Aufgabe langweilig und forderten eine Wiederholung, was die beiden dazu animierte, sich noch einmal zu küssen. So ging es eine Weile weiter, wir waren müde, die Fragen und Aufgaben zunächst harmlos und erst im Laufe der Zeit anstrengender und schlüpfriger. »Was war dein aufregendstes Erlebnis?«, »Was war der außergewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest?«, »Was ist der außergewöhnlichste Ort, an dem du gerne einmal Sex hättest?«, waren Fragen, und kaum jemand nahm »Pflicht«, weil niemand Lust hatte, sich erheben zu müssen, um zum Beispiel Treibholz auf seiner Nase zu balancieren. Schließlich zeigte die Flasche auf mich, ich hatte meinen Nachbarn im Verdacht, dass er sie mit Absicht nicht richtig gedreht hatte, wusste aber, dass keine Chance bestand, gegen die Entscheidung zu protestieren, das Schicksal hatte entschieden, ich war fällig und wählte ebenfalls »Wahrheit«. Ich war auf vieles vorbereitet gewesen, auf das Aushorchen intimer Geständnisse, peinlicher Erlebnisse oder anzüglicher Erfahrungen, aber nicht auf das, was jetzt kam. »Hattest du eine glückliche Kindheit?«, fragte mich mein Nachbar, und die ganze Runde brach in tobendes Gelächter aus. »Was ist das denn für eine blöde Frage?«, rief jemand, Köpfe wurden geschüttelt, der Fragesteller geschubst und mit einem leeren Weinkanister beworfen, der aber ließ sich nicht beirren und beharrte auf einer Antwort.
Was gab es dazu zu sagen? Die Frage war für ein Spiel dieser Art gänzlich ungeeignet. Man konnte einfach mit »Ja« oder »Nein« antworten, niemand würde die Angabe überprüfen können, und der Nächste wäre an der Reihe. Es gab nichts zu gestehen, nichts zuzugeben, nichts war peinlich. Es sei denn, man antwortete mit »Nein«, aber das entspräche in meinem Fall nicht der Wahrheit. So einfach die Frage war, so wenig hatte ich jemals über sie nachgedacht. Über meine Kindheit selbst hatte ich mein halbes Leben lang gebrütet, aber eine einfache Aussage darüber, ob ich glücklich gewesen war, konnte ich nicht treffen. Die Aufregung ließ langsam nach, die ersten Augenpaare richteten sich auf mich, es wurde erwartet, dass ich antwortete und das Spiel weitergehen konnte.
»Natürlich«, sagte ich und blickte dabei zu Boden. Ich nahm die Flasche und drehte sie, so fest ich konnte.
Irgendwann begann das Spiel langweilig zu werden, Feuchtigkeit zog herauf, uns wurde zu kalt, und wir machten uns auf den Weg durch die Dünen, zurück zu unseren Betten. Die Nacht war wolkenlos, der Himmel glich einer perforierten Folie, unzählige Lichter blickten auf uns herab und schienen zu zwinkern. Wieder sahen wir fallende Sterne, aber niemand machte mehr ein Aufheben darum, der Reiz des Einmaligen war lange verflogen, niemand hatte noch Wünsche übrig, die er, verstohlen und heimlich, dem Schweif hinterherschicken wollte. So trotteten wir matt und sprachlos durch die Dünen, jeder beschäftigt mit seinen eigenen Gedanken oder auch nur mit der Leere in seinem Kopf, die in der Schwärze über uns ihre Fortsetzung nahm. Mir war nicht so leicht ums Herz, in meinem Inneren hallte immer noch die Frage nach, die mir gestellt worden war, und vielmehr noch meine Antwort. Niemand hatte später etwas dazu gesagt, es wurde sofort weitergespielt und kurze Zeit darauf war die Aufregung vergessen, so wie alles andere schon Momente später wieder vergessen sein würde, es war nur ein Zeitvertreib für die anderen. Das sollte es für mich auch sein, trotzdem nagte die Frage an meiner Seele, und ich war so in Gedanken versunken, dass ich zusammenzuckte, als mir jemand auf die Schulter schlug. Ich drehte mich um und konnte niemanden erkennen, bis ich meine Lampe hob und ihm ins Gesicht leuchtete. Es war der Fragesteller, und auch ihn schien die Situation weiter zu beschäftigen.
»Das hat dir was ausgemacht, oder?«, fragte er und sah mich dabei nicht an, so als hätte er etwas zu verbergen und dürfte niemanden wissen lassen, dass wir miteinander sprachen.
Ich stellte mich dumm. »Was meinst du?«
»Die Frage. Du hast lange gezögert.«
»Ich wollte ehrlich sein.«
»Und? Warst du es?«, wollte er wissen, es klang wirklich interessiert, aber ich hatte keine Lust, ihm zu antworten.
»Spielen wir immer noch?«
»Du musst nicht antworten, wenn du nicht willst.«
Aber ich wollte antworten und die Wahrheit sagen, nur vermochte ich es nicht.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich zögernd und meinte es auch so.
»Du hast ›Natürlich‹ gesagt.«
Ich blickte in seine Richtung, konnte aber wieder nichts erkennen, sodass ich nicht einzuschätzen vermochte, wie sein Drängen gemeint war. Wollte er mich herausfordern, mich zu einem Geständnis zwingen oder mich einer Lüge überführen? Oder war er tatsächlich an mir interessiert, wollte er wirklich wissen, wie es in meinem Inneren aussah? Ich hatte keine Lust, zu dieser Stunde und in diesem Zustand weiter darüber zu sprechen, und sagte es ihm. Ihm schien es nicht so zu gehen, er hob zu einer weitschweifigen Erklärung an und ließ sich umständlich darüber aus, dass er seine Frage gar nicht so lächerlich finde, wie die anderen es hatten aussehen lassen, schließlich umfasse die Kindheit eine lange Zeit, niemand könne doch mit Sicherheit sagen, dass ein derart umfangreicher Lebensabschnitt nur von einem Gefühl geprägt worden sei, Glück oder Unglück, das sei einfach nicht möglich. Je länger er redete, desto mehr musste ich ihm zustimmen und desto überzeugter war ich schließlich, dass wirkliches Interesse aus seiner Rückfrage sprach. Trotzdem verstand ich immer weniger, warum er überhaupt eine Frage dieser Art stellte, wenn er doch wusste, dass sie eigentlich nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnte. Aber vielleicht war das einfach seine Art von Humor, der allerdings in dieser Runde und bei diesem Spiel keinen Anklang gefunden hatte.
Wir erreichten unsere Zimmer, verabredeten eine Zeit für das gemeinsame Frühstück, das die Hälfte von uns, wie immer, verpassen und die andere Hälfte nur äußerst verkatert einnehmen würde, und verabschiedeten uns. Ich lag noch eine lange Zeit wach und betrachtete Szenen aus meiner Vergangenheit, aus meinem früheren Leben, in meinem Kopf. Ich konnte die Frage immer noch nicht beantworten, aber einer meiner letzten Gedanken vor dem Einschlafen war der, dass ich nicht unglücklich gewesen war.
Teil Eins
Vorwort
Ich kann mich bei meinen Erinnerungen nicht darauf verlassen, dass all das tatsächlich genau so passiert ist und in exakt dieser Anordnung. Alles, was ich erlebt habe, wurde gefiltert durch den Geist eines kleinen Kindes, das gewissen Umständen ausgesetzt war. Vielleicht hätte ein neutraler Beobachter ein ganz anderes Bild der Erlebnisse gezeichnet, die ich im Folgenden beschreibe. Auch habe ich den Ereignissen mit meinem heutigen Geist Worte verliehen, alles, was gesagt wurde, habe ich früher niemals so formuliert, wahrscheinlich noch nicht einmal gedacht, aber bestimmt so empfunden. Darüber hinaus bin ich mir über die Reihenfolge der Begebenheiten nicht im Klaren, ich habe jedoch versucht, alles in eine möglichst logische Abfolge zu bringen. Einige Lücken habe ich durch spätere Erzählungen anderer, durch Tagebücher und Briefe ergänzt, daher gibt es im ersten Teil immer wieder die Sprünge von »innen« nach »außen«, um die Erzählung mit dem zu vervollständigen, was ich selbst noch nicht bewusst wahrnehmen konnte. Wenn manches nicht ganz zusammenpasst oder meinem Alter unangemessen scheint, sei dies dem Umstand geschuldet, dass all das Jahrzehnte zurückliegt und begraben war unter allem, was die Zeit seitdem darüber aufgestapelt hatte. Wichtig ist mir, dass man einen Sinn erkennt, einen Zusammenhang und eine Linie, die man vielleicht nicht glauben mag, aber doch wenigstens nachvollziehen kann. Wem die Ereignisse allzu fantastisch erscheinen, der möge sie als Erfindung betrachten, als Märchen, das ein Korn Wahrheit enthält, aber vielleicht nie so passiert ist, wie es aufgeschrieben wurde. Ich hingegen verbürge mich für jedes einzelne Wort mit meiner ganzen Seele.
Kapitel Eins (außen)
Die Gebäude lagen in einem engen Tal, das sich vom Dorf in die Hügel schlängelte, windgeschützt und vor den Blicken Neugieriger verborgen. Ein schmaler, schlecht asphaltierter Weg führte durch die immergrünen Nadelwälder über mehrere Anhöhen bis zum Gehöft, wo er endete und weswegen er nur selten befahren wurde. Rund um das Wohnhaus, den großen, aber fast verfallenen Stall und die kleine Scheune, erhoben sich seit Langem ungenutzte Weiden, die auf den Kuppen der Hügel allmählich in Wald übergingen. Die Natur eroberte das einst bewirtschaftete Land langsam zurück, streckte ihre Finger nach den Gebäuden aus, säte Disteln und hohe Gräser, die keine Tiere mehr fraßen, und ließ die Zäune verrosten, die Pfähle, an denen der Stacheldraht hing, allmählich verrotten und einstürzen. Auf den ersten Blick bot das Gehöft ein malerisches Bild, zeigte Romantik des Landlebens und strahlte Behaglichkeit und Ruhe aus. Auf den zweiten Blick änderte sich nicht viel, die Ruhe blieb, aber die Behaglichkeit wich etwas zurück, wenn man die abblätternde Farbe am Wohnhaus entdeckte, die schiefen Läden, die träge im Wind quietschten und die Halme, die sich zwischen den Pflastersteinen der schmalen Auffahrt ausbreiteten. Trotz allem wäre es nicht übertrieben, diesen stillen Ort immer noch als »Idylle« zu bezeichnen, und Menschen, die geschäftstüchtiger waren als die momentanen Bewohner, hätten es sicherlich verstanden, diese Idylle zahlenden Urlaubern schmackhaft zu machen. Aber davon war dieser Fleck Erde weit entfernt, im Gegenteil, hier schien die Zeit stehengeblieben zu sein, nur das Nötigste wurde instand gehalten. So wurde das Dach erst dann geflickt, wenn es hereinregnete, ansonsten war das Werk der Jahre überall deutlich zu sehen.
Kam man auf den Hof, ging man zunächst eine kleine Steigung über aufgeworfenes Pflaster hinauf und gelangte dann zum Wohnhaus. Eine kleine Treppe führte seitlich zu beiden Seiten der Tür nach oben, der gegenüber eine Sitzbank am Geländer angebracht war, die aus grobem Holz bestand, das vor längerer Zeit einmal in einem dunklen Braun angestrichen worden sein mochte. Die schwere, massive Tür hatte kleine Fenster aus gelblichem Glas, geschützt durch schmiedeeiserne Gitter. Am Türrahmen darüber prangte eine aus einem Baumstamm gesägte Scheibe, durch Ketten gehalten und verziert mit dem Spruch »Lasset uns am Alten, so es gut ist halten, aber auf altem Grund, Neues wirken jede Stund«. Rechts und links der Tür standen zwei alte, mit vermooster Erde gefüllte Fässer, aus denen aber nur ein paar traurige Überreste der Pflanzen ragten, die hier vor langer Zeit eingesetzt worden waren. Mit der Tür im Rücken überblickte man den Hof, gegenüber lag der ächzende Stall, der nicht mehr genutzt wurde, das Dach war eingefallen, es würde nicht lange dauern, bis die Witterung das Gebäude zum Einsturz brachte. Zur Rechten lag die kleine Scheune, die als Garage und Lagerraum genutzt wurde, hier verstaubten alte und zum Teil schon lange vergessene Geräte, die keine Verwendung mehr fanden, darüber lag der Heuboden, der nicht mehr gefüllt wurde, Schwalben hatten die Dachbalken mit ihren Nestern verziert und teilten sich den Raum mit Spinnen und Mäusen. Hinter dem Stall erhob sich das weite Land, auf dem in früherer Zeit Kühe und Pferde gegrast hatten, vor mehreren Generationen hatte es Schafe und Ziegen gegeben sowie einige Hundert Hühner, aber jetzt war der Stall leer. Es gab nur noch ein paar streunende Katzen, die in der Scheune Jagd machten, und einen alten Hofhund, der an einer langen Kette im Hof lag, so als gäbe es noch etwas zu bewachen.
So trostlos sich die Beschreibung der Gebäude anhört, könnte man meinen, sie seien verlassen worden, aber das ist nicht die Wahrheit, hier wohnten Menschen, hier gab es Leben und die dazugehörigen Schicksale. Die Leute im Dorf wussten nicht viel zu berichten, außer der offensichtlichen Tatsache, dass hier eine Frau mit ihren Kindern und ihrer alten Schwiegermutter lebte. Darüber hinaus gab es einige Gerüchte, schlimme Dinge, die nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurden, deren Wahrheitsgehalt aber niemand mehr überprüfen konnte und die selbst von den klatschsüchtigen Bewohnern des Dorfes nur dann hervorgeholt wurden, wenn es sonst nichts mehr zu sagen gab. Aber damit tat man unrecht, so die offizielle Ansicht, es gab nichts Schlechtes, was man über die Frau oder ihre Kinder sagen konnte, auch wenn man sie wegen ihrer verschlossenen Art mied. Das Schicksal hatte es nicht gut mit ihnen gemeint, es galt, Rücksicht zu nehmen, niemand war verantwortlich für das geschehene Unglück. Auch wenn man die kleine Familie selten sah, meist nur sonntags in der Kirche, selten auf einem Dorffest oder dem Wochenmarkt, ließ man sie in Ruhe. Erst später, als die Kinder in die Schule mussten, wurde offensichtlich, wie schwer die Vergangenheit und die Gegenwart auf dem alten Hof und seinen Bewohnern lasteten, wie das Gewicht der Zeit sie gleichsam erdrückte und zersetzte, Spuren in den Gesichtern hinterließ, die man sonst erst bei älteren Menschen erkannte, viel zu früh eingebrannt in die jungen Augen. Aber umso mehr hätte man trotz aller Gerüchte die Mutter bewundern können, die sich die ganze Zeit allein durchschlug, sich mit kleineren Arbeiten ein Zubrot verdiente und erst viel später Hilfe in Anspruch nahm. Man hatte immerhin Respekt vor ihrer Leistung, vor ihrer Standhaftigkeit, und es gab nicht wenige, die sich niemals hätten vorstellen können, in ihrer Situation überlebt, die Kraft besessen zu haben, die Schläge auszuhalten, die ihr das Schicksal mitgegeben hatte. Jeder war sich sicher, ganz früh aufgegeben und die Gegend verlassen zu haben, in der die Geister der Vergangenheit umgingen. Warum war sie nicht mit ihren Kindern in die Stadt gegangen, hatte sich helfen lassen, die Kinder versorgt, fernab der Einsamkeit des Hofes? Aber die Leute verstanden auch, dass das einer Flucht gleichgekommen wäre, einem Aufgeben, Resignieren angesichts dessen, was passiert war. Man verließ seinen Hof nicht einfach so, man schnitt seine Wurzeln nicht ab, wenn es nicht irgendwie anders ging. Die jungen Leute hingegen waren nicht mehr so verbunden mit ihrer Herkunft, es gab viele Höfe, die nicht übernommen wurden, weil die Söhne und Töchter anderes im Sinn hatten, dem Dorf den Rücken kehrten, um sich in der Stadt niederzulassen und dort ihr Glück zu suchen. Einmal im Jahr kehrten sie zum Schützenfest zurück, betranken sich ohne Maß und erzählten von der alten Zeit und wie schön diese gewesen sei. Am nächsten Tag packten sie jedoch ernüchtert ihre Sachen, ließen sich von den Eltern nur wenig widerwillig etwas zustecken und verschwanden wieder in ihrem neuen Leben, Erinnerungen an eine Idee von Heimat im Gepäck, die ihnen ausreichte. Die Mutter auf dem abseits gelegenen Hof aber würde dort bleiben, wo sie ihr Leben lang gewohnt hatte. Die Gebäude hatten seit Generationen ihrer Familie gehört, sie war in dem Haus geboren und würde dort ihre letzten Tage verbringen. Ihre Eltern sowie der Schwiegervater waren schon vor langer Zeit gestorben, ihr waren keine Geschwister geschenkt, und nach dem Tod ihres Mannes, der auf den Hof eingeheiratet hatte, war es an ihr, mit ihren Kindern dafür zu sorgen, dass nicht alles vollständig zerfiel, doch ihre Kräfte reichten offenbar nicht aus. Die Leute aus dem Dorf kamen selten zum Hof herauf, aber diejenigen, die es bisweilen taten, alte Freunde der Familie, der Arzt oder der Pfarrer, berichteten nach ihrer Rückkehr vom fortschreitenden Verfall der Gebäude, was eine Schande sei, aber was solle man machen? Es hatte anfangs nicht wenige Angebote gegeben, ihr zu helfen, es wurde allgemein als Schande angesehen, das gute Land nicht weiter zu bewirtschaften, aber nachdem sie sich standhaft geweigert hatte, Hilfe anzunehmen oder auch nur irgendjemanden länger als nötig auf dem Hof zu haben, wurde ihr Wunsch respektiert, und man ließ sie in Ruhe. Hätte man gewusst, welche Tragödien sich hinter den Wänden und Bruchsteinmauern abspielten, man wäre vielleicht nicht so nachgiebig gewesen, aber das Schicksal spielt sich im Verborgenen ab und ist oft nicht als solches zu erkennen.
Kapitel Zwei (innen)
Meine erste Erinnerung reicht zurück in die Zeit, als mein Vater noch lebte. Ich habe kein klares Bild mehr von ihm, er ähnelt mehr einer Erscheinung, einer Person, die anwesend war, an die ich mich aber nicht im Detail erinnern kann. Später ist dieses Gefühl der Präsenz angereichert worden durch einige wenige alte Fotos, die von meinem Vater existierten, aber diese Fotos zeigen Momentaufnahmen von Situationen, es sind Ausschnitte aus einer vergangenen Zeit, von der ich kein Teil war. Außerdem sind es Standbilder, es wird nicht gesprochen, man hört niemandes Stimme, man fühlt nicht die Umgebung, das Wetter, die Sonne oder den Regen, die Bilder sind stumm und können nur denjenigen etwas bedeuten, die anwesend waren, da sie die fehlenden Details in ihrem Kopf aufzufüllen in der Lage sind und so das Foto lebendig machen. Diese Möglichkeit habe ich nicht, daher bin ich auf das angewiesen, was in meinem Kopf vorhanden ist, und das ist sehr wenig. Die einzige Situation, an die ich mich tatsächlich erinnere, war kurz und flüchtig, aber ich habe sie bewahrt wie einen Schatz, ich weiß nicht, warum. Heute kommt sie mir eher wie ein Traum vor, und ich habe keine Möglichkeit zu erkennen, ob ich wirklich träumte, es gibt niemanden, den ich fragen könnte, ob sich alles so abgespielt hat, aber das ist auch nicht mehr wichtig. Mein Vater weckte mich eines Nachts, er kam offenbar von der Arbeit auf dem Land spät ins Haus und zeigte mir irgendetwas. Ich kann nur noch dieses Gefühl zurückrufen, das ich damals hatte, ich weiß nicht, wo ich schlief und was in der Folge passierte, mir ist nur noch bewusst, dass er es war, der mich weckte, was sonst wahrscheinlich nicht vorkam. Oder es war der Umstand, der Grund, der ihn zu mir geführt hatte, denn in seiner Hand hielt er etwas, das ich nicht erkannte, es war klein und zitterte, und als er es mir in meine Hände gab, erschrak ich zunächst und wusste nichts damit anzufangen. Mit einer unendlichen Zärtlichkeit streichelte er das Knäuel und meine Hand und sagte mir, dass es sich um ein Kaninchen handele. Ich kann mich erst an eine Zeit sehr viel später erinnern und daran, wie wir Kaninchen in einem kleinen Stall neben der Scheune hielten, um die wir uns kümmerten, aber der Traum davon, wie mein Vater mir die Verantwortung für die kleinen Geschöpfe in dieser Nacht buchstäblich in die Hand legte, bleibt unauslöschlich. Diese erste ist leider auch meine letzte Erinnerung an meinen lebendigen Vater, denn nicht viel später ereignete sich der tragische Unfall, der ihn das Leben kostete, so erzählte man mir nach Jahren.
Mein Zuhause und meine Heimat waren immer unser Hof. Er und die Menschen, die dort lebten, bildeten meine ganze Welt, denn wir verließen das Gehöft fast nie. In der Nähe gab es ein kleines Dorf, das wir selten besuchten, unsere Mutter fuhr einmal in der Woche zum Markt, aber wir blieben in dieser Zeit zu Hause. Sonntags gingen wir in die Kirche und später wochentags in die Schule, aber bis dahin war der Hof alles, was wir kannten. Auch kam uns selten jemand besuchen. Ich lernte erst später, dass das früher anders gewesen war, dass unser Vater derjenige war, der Freunde und Bekannte hatte und diese nach Hause einlud, ich bekam aber auch mit, dass unsere Mutter nichts davon hielt, sodass die Besuche nach seinem Tod schnell aufhörten. Das war mehr darauf zurückzuführen, dass Mutter die Besucher vehement abwehrte, als dass niemand mehr hätte kommen mögen, aber auch das erfuhr ich erst sehr viel später. Von den Personen, die uns, wenn auch selten, weiterhin besuchten, kann ich mich an den Pfarrer erinnern und einen Arzt, der Tiere und Menschen gleichermaßen zu behandeln schien, ob mit denselben Geräten und Medikamenten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Zu unserer kleinen Welt gehörten außer mir und meiner Mutter noch zwei weitere Frauen, viel später sogar drei. In den ersten Jahren waren da noch meine ältere Schwester und meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, die in einer kleinen Wohnung mit eigenem Eingang lebte, die aber im Wohnhaus lag und durch eine Verbindungstür vom Hausflur aus erreicht werden konnte. Von diesem Flur führte auch eine Treppe nach oben, die mit einer Unzahl von Teppichen belegt war, die im Laufe der Zeit Farbe und Muster eingebüßt hatten, da es trotz aller Vorsicht nie möglich war, den Dreck des Hofes vollständig draußen zu lassen. Die Einrichtung des ganzen Hauses kann ich erst mit der Distanz meines heutigen Blickes beschreiben, denn damals war für mich alles ganz normal, da ich keine Möglichkeit hatte, Vergleiche zu ziehen. Ich hatte nie andere Häuser von innen gesehen, wusste nicht, wie es bei anderen Leuten aussah und wie man ein Haus anders hätte einrichten können, als es bei uns der Fall war. Heute würde ich die Einrichtung mit einem Wort zusammenfassen: staubig. Da der Hof seit Generationen von unserer Familie, die mit meinem Jahrgang auszusterben schien, bewohnt wurde, hatten sich auch die Geschichten und Geschicke dieser Generationen im Haus versammelt und wohnten dort gleichermaßen mit uns zusammen. Aus der Distanz betrachtet konnte man den Eindruck gewinnen, als hätte jede Person, die jemals in diesen Wänden gewohnt hatte, etwas hinterlassen, etwas hinzugefügt, aber nie etwas entfernt, aus Respekt vor denen, die vor ihr dasselbe getan hatten. So waren die Wände bedeckt mit Bildern von Gebirgsansichten in schweren Holzrahmen und Heiligenbildern, billigen Reproduktionen von Ikonen, oder kleinen Zetteln mit frommen Motiven. Mir wurde erst viel später klar, dass diese Zettel, die man auch in den Gesangbüchern fand, Totenzettel waren, die meine Mutter »Leitbilder« nannte. Ich nahm wahrscheinlich an, dass die Abbildungen uns zu einem rechten Lebenswandel anleiten sollten, und erst in meiner Schulzeit fand ich heraus, dass es sich um »Leidbilder« handelte. So bedeutete jeder dieser Zettel eine verstorbene Person, deren Totenmesse jemand aus der Familie besucht hatte und der jetzt neben gusseisernen Kerzenhaltern unsere Wände zierte. Abgesehen vom Wandschmuck stellten auch die Möbel eine Ansammlung der Anschaffungen mehrerer Generationen dar, alles wurde weitervererbt, ab und zu kam ein weiteres Stück dazu, das uns von jemandem hinterlassen wurde. Soweit ich weiß, wurden von meiner Mutter nie neue Möbel gekauft, sodass die gesamte Einrichtung des Hauses alt, dunkel und schwer in den Zimmern lastete wie düstere, unbewegliche Tiere, und eine Mode widerspiegelte, die seit Urzeiten nicht mehr aktuell war, außer bei uns. Was außerdem zu dem unreinlichen Eindruck beitrug, war die schiere Masse an Zimmern, die unser Haus aufwies und die nach und nach immer weniger genutzt wurden und hoffnungslos verstaubten. Solange meine Großmutter noch laufen konnte, machte sie es sich zur Aufgabe, alles in Ordnung zu halten, völlig egal, ob die Zimmer genutzt wurden oder nicht, wie in ständiger Erwartung unangekündigten Besuches. Aber seit sie die Treppen nicht mehr steigen konnte, war das obere Stockwerk dem Schmutz anheimgefallen, und je mehr sie sich in ihre kleine Wohnung zurückzog, desto mehr folgte ihr der Staub herunter in das Erdgeschoss, so als hätte er darauf gewartet, dass sich sein größter Widersacher geschlagen geben würde. Später würde jemand anderes den Kampf gegen den Dreck aufnehmen, dafür aber ganz andere Sachen ins Haus tragen.
Was ist eine »Heile Welt«? Eine Welt, in der alles heil ist oder geheilt? Eine Welt, in der es keine Schmerzen gibt, keine Widerstände, nur Glück und Wohlergehen? Eine Welt, in der es noch nicht einmal das Wissen um Schmerzen gibt? So etwas ist unmöglich, immer gibt es Schmerzen, Enttäuschungen, Verbote und, dadurch angeregt, dunkle Ahnungen. Gäbe es eine heile Welt, dürfte es keine Schmerzen geben, aber auch keine Verbote, denn diese regen die Fantasie an. Warum darf ich das nicht, warum ist das nicht gut, sondern böse, unrein oder sogar sündig? Und trotzdem gibt es die Illusion der heilen Welt, die sich in der Vorstellung zwangsläufig immer weiter zusammenzieht, um Bestand haben zu können. Sie schrumpft, verkleinert und reduziert sich auf immer weniger Menschen, die an ihr teilhaben dürfen. So sollte die Familie die kleinste, heile Welt sein, ein Schutz gegen dunkle Einflüsse von außen. Innerhalb dieser Welt, die alles Böse außen vor lässt, gäbe es dann keine Verfehlungen, keine Sünde mehr. Und tatsächlich ist es das, was wir auf unserem Hof erlebten, eine kleine, reine Welt in der großen, bösen Welt, die wir davon abhielten, zu uns einzudringen. Das ging natürlich nur so lange gut, wie wir der Kontrolle unserer Mutter unterstanden, die unser einziger Einfluss war, bis wir schließlich doch hinaus sollten und Kräften ausgesetzt waren, deren Auswirkungen sie später wieder richten musste, gegen die sie kämpfte, um den Schutz aufrechtzuerhalten, den sie uns bisher geboten hatte. Musste dieser Plan scheitern? Ist er überhaupt gescheitert? Oder tat sie recht daran, uns auf die Art zu schützen, wie sie es tat? Aber wenn eine heile Welt eine ist, in der man sich geborgen fühlt und in der man keine Angst zu haben braucht vor dem, was von außen auf uns hereinzustürmen droht, lebten wir in einer solchen Welt. Was innerhalb dieser Welt passierte, mag nach objektiven Maßstäben, juristischen wie moralischen, anders bewertet werden, aber ist etwas schlecht, wenn es nicht schadet, wenn alle Betroffenen gar nicht betroffen sind, sondern zufrieden in der Gewissheit, dass der beste Weg gefunden wurde, um heil zu bleiben und geheilt zu werden, wo man fehlging?
So gesehen lebten wir damals in einer heilen Welt. Das vollständige Bild aber sieht immer anders aus als die Innenansicht, ein Wechsel der Perspektive bringt zwangsläufig Dinge ans Licht, die anders sind, als es den Anschein hatte. Aber diese neue Perspektive würde lange auf sich warten lassen.
Kapitel Drei (außen)
Der Tod Jakob Schiefers war lange Gespräch im Ort, insbesondere in der Institution zur Vermittlung von Nachrichten, dem »Goldenen Löwen«, der einzigen Gaststätte im Dorf. Hier saß einige Monate nach dem Unfall eine Handvoll Bürger des Dorfes zur fortgeschrittenen Stunde zusammen und kam unweigerlich auf das Thema zu sprechen, das immer noch in aller Munde war. Es war mitten in der Woche, die Kneipe nicht gut besucht und die wenigen Gäste nicht leise, sodass der Wirt, der unbewegt hinter seiner Theke stand, jedes Wort verstehen konnte. Er mischte sich nicht ein, er kannte die Gäste und wusste, dass nicht jedes Wort so gemeint war, wie es ausgesprochen wurde. Andere Worte hingegen waren leider genau so gemeint, wurden aber außerhalb dieser Runde nicht zum Besten gegeben, doch der Alkohol hatte die Zungen gelöst und brachte zutage, was selbst hier sonst verborgen blieb. Der Wirt wusste, dass es nicht nur seine Aufgabe war, die Gäste mit Getränken und hausgemachten Frikadellen zu versorgen, er hatte auch den Mund zu halten. Was in diesem Raum gesprochen wurde, blieb auch in diesem Raum.
»Ich glaube die Geschichte so einfach nicht, Jakob war doch kein Idiot!«, rief Adi Reinbacher und schlug mit der flachen Hand lauter auf den Tisch, als er es eigentlich gewollt hatte. Er sah herausfordernd in die Runde.
»Aber ein Säufer war er«, antwortete Gustav Pesch, sein Nachbar, und stürzte sich ein Pinnchen mit der Hausmarke in den Hals.
»Das sagt der Richtige!« Adi grinste.
»Ich falle aber wenigstens nicht in meine Jauchegrube«, erwiderte Gustav, setzte seinen Bierkrug an und machte dem Wirt ein Zeichen für die nächste Runde. Die anderen Gäste, fast alle gestandene Landwirte, die sich mit Alkohol wie auch mit Jauchegruben gleichermaßen auskannten, nickten anerkennend und leerten ebenfalls ihre Gläser. Ein Wort gab das andere, aber auch, wenn sonst niemand den Zweifel offen äußern mochte, seltsam war es schon, dass jemand, der seinen Hof seit Jahren wie seine Westentasche kennen musste, in die Jauchegrube fiel und dort erstickte.
»Ich sag dir, da hat jemand nachgeholfen, so sehe ich das«, fing Adi wieder an.
»Und wer soll das gewesen sein?«, mischte sich Walter, sein Bruder, jetzt ein.
»Drei Mal darfst du raten. Wer war denn immer gegen einen Zaun um die Jauchegrube? Wer hat denn immer gesagt, dass es noch nie einen Zaun gab und noch nie ein Unglück? Und wer hat denn, kaum dass Jakob unter der Erde war, plötzlich einen Zaun um die Grube gezogen, der einen Panzer aufhalten könnte? Na? Wer?«
Er blickte von einem zum anderen.
»Mensch, Adi, hör auf mit dem Unsinn!«, versuchte Walter, Adi zu beschwichtigen und die Gerüchte vom Tisch zu fegen, aber Adi war in Fahrt und dachte gar nicht ans Aufhören.
»Gar kein Unsinn. Seine Frau war’s, die alte Hexe, und niemand sonst! Jakob war nicht blöd, der wäre nie in die Grube gefallen, seine Frau hat nachgeholfen, da kannst du mir erzählen, was du willst.«
Adi machte ein Gesicht, als hätte er gerade verkündet, dass Wasser nass sei und sein Gegenüber ein Idiot, der das nicht akzeptieren wollte.
»Ich will dir überhaupt nichts erzählen«, gab Walter zurück, »und du solltest den Mund halten, wenn du keine Beweise hast.«
»Habe ich keine?«
Adi grinste verschwörerisch und trank wieder von seinem Bier. Jeder wusste, dass er keine Beweise hatte, aber der Gedanke, dass Jakobs Tod kein Unfall gewesen sein sollte, erschien ihnen nicht neu, jedoch wäre niemand so weit gegangen, seine Frau offen zu beschuldigen, auch wenn der Gedanke nahegelegen hatte. Sie war tatsächlich vehement gegen den Zaun gewesen und hatte jetzt einen bauen lassen, der Kinder wegen, so sagte sie. Es war allgemein bekannt, dass es um die Ehe der Schiefers nicht zum Besten gestanden hatte, aber wer konnte das schon von seiner eigenen behaupten? Und nur, weil man nicht immer gut miteinander auskam, wurde noch niemand zum Mörder. Oder gab es andere Gründe, gab es einen schwelenden Brand unter der Fassade, den niemand entdecken konnte, der unsichtbar war für die anderen? Aber welche Gründe sollten das sein? Jeder wusste, dass Jakob nicht selten über die Stränge schlug, in diesem Zustand war er dann reizbar und man ging ihm dann besser aus dem Weg, aber keiner konnte sich vorstellen, dass irgendetwas geschehen sein sollte, was einen Mord rechtfertigte.
Walter wollte die Diskussion beenden: »Nein, du hast keine, sonst hättest du die schon längst auf den Tisch gelegt.« Adi schnaubte, aber Walter war noch nicht fertig: »Und hätte sie dir damals nicht den Laufpass gegeben und stattdessen Jakob geheiratet, würdest du jetzt nicht so auf ihr rumhacken.«
Die Runde hielt den Atem an, ihre Blicke gingen zwischen den Brüdern hin und her. Es hatte damals Gerüchte gegeben, dass Adi Eva nachgestiegen war, aber das war eben auch wieder nur Gerede, dem man Glauben schenken konnte, oder auch nicht, es taugte für eine kurze Zeit als Anlass zur Heiterkeit in der Runde am Stammtisch, dann war das Thema aber schnell vergessen und machte neuem Klatsch Platz. Jetzt wurde die Sache wieder aufgewärmt, die Streithähne standen in der Arena, aber Adi dachte gar nicht daran, auf die Stichelei seines Bruders zu antworten, er warf ihm nur einen giftigen Blick zu, murmelte, dass er wisse, was er wisse, trank sein Glas aus, stand auf und verschwand auf die Toilette. Die anderen sagten nichts weiter, sahen sich kurz an und ließen das Thema dann ruhen.
Es wurde nie eine offizielle Untersuchung angestrengt, Jakob Schiefers Tod wurde als tragischer Unfall verbucht, und auch im Dorf legten sich die Wogen des Entsetzens nach einiger Zeit. Trotz allem blieb der Schiefer-Hof unter Beobachtung, wurde so etwas wie eine Attraktion, entweder als Unglücksort des Unfalls oder vermuteter Tatort eines Verbrechens. Von nun an war der Hof und seine verbleibenden Bewohner nicht mehr dieselben, und Eva Schiefers Art, sich aus der Gemeinde zurückzuziehen, unterstützte diese Entwicklung nur noch, sie wurde nicht gemieden, aber es suchte auch niemand ihre Gesellschaft, vor allem, weil sie selbst den Eindruck machte, keinen Wert auf Besuch zu legen.
Kapitel Vier (innen)
Ich kann nicht behaupten, dass der Tod meines Vaters tatsächlich einen Verlust für mich bedeutet hat. Kann man etwas vermissen, was man nie gekannt oder gehabt hat? Mein Vater war nur eine flüchtige Erscheinung für mich, ein Geist, an den ich mich nicht wirklich erinnern kann, abgesehen von den Fotos, die ihn nicht darstellen, sondern nur abbilden, sie erzählen nichts von ihm, geben nur einen kurzen Moment wieder, nicht genug, um ihn vermissen zu können. Später in der Schule wurde mir aus den Erzählungen der anderen erst klar, was es bedeutete, einen Vater zu haben, jemanden, der die Kinder mitnahm auf Ausflüge, auf Abenteuer, der mit ihnen Baumhäuser baute oder Schiffe, die sie gemeinsam in den Bächen im Wald schwimmen ließen. Auch bei uns gab es Abenteuer, aber niemanden, der diese mit uns teilte, wir mussten uns unsere Umgebung selbst erobern, sofern es uns erlaubt war.
Für meine Schwester Frieda stellte sich die Sache etwas anders dar, sie ist etwas mehr als ein Jahr älter als ich und hatte unseren Vater trotz des geringen Altersunterschieds tatsächlich miterlebt. Wenn ich ihren Erzählungen Glauben schenken darf, kannte sie ihn, konnte sich in bewegten Bildern an ihn erinnern, und von dem, was sie mir erzählte, waren das nicht nur positive Erfahrungen. »Du weißt nicht, wie er war«, sagte sie manchmal, oder auch: »Du hast keine Ahnung, wie er sein konnte, wenn er getrunken hatte.« Das stimmte, ich hatte wirklich keine Ahnung, und da ich keinen Anlass hatte, meiner Schwester zu misstrauen, fehlte mir auch ein Grund, die Abwesenheit dieses Vaters zu bedauern. Was übrig blieb, war unser beider Einstellung, dass wir unseren Vater nicht vermissten, ich, weil ich ihn nie gekannt hatte und keine Lücke in meinem Leben füllen musste, meine Schwester, eben weil sie ihn gekannt hatte und lieber eine Lücke akzeptieren wollte als einen Vater, den sie nicht respektierte.
Was sich für mich nach dem Tod unseres Vaters änderte, war zunächst kaum zu merken, es wandelten sich kleine Dinge, die alle damit zu tun hatten, dass unser Leben sicherer werden sollte, behüteter und geschützt vor den Gefahren, die in der Welt lauerten. Als Erstes wurde ein Zaun um die Jauchegrube errichtet, in die unser Vater gestürzt war. Zuvor hatte es eine baufällige Mauer gegeben, die etwa einen Meter hoch und an den intakten Stellen für uns Kinder nicht ohne Weiteres zu überwinden war. Aber unsere Mutter wollte sichergehen, dass nie wieder etwas passierte, und ließ den Zaun bauen. Auch durften wir nicht mehr ohne Aufsicht den Hof betreten und in der Scheune spielen. Ich war zu klein, um zu wissen, wie es vorher gewesen war, aber meine Schwester erzählte mir mehr als einmal, dass sie »in Ketten gelegt« wurde. Jedoch schien sie diese Ketten im Laufe der Jahre nicht mehr zu bemerken, vielmehr hatte sie Gefallen daran gefunden und suchte, mir die Vorzüge der Regeln und Gesetze begreiflich zu machen, die fortan für uns gelten sollten. Es schien, als hätte der Tod unseres Vaters neue Gefahren heraufbeschworen, so als hätte sich der Hof mit einem Mal verwandelt, von einem großen Spielplatz mit unzähligen Möglichkeiten von Abenteuern und Entdeckungen zu einer Todesfalle, die nur darauf wartete, zuzuschnappen. An jeder Ecke gab es Gefahren, denen wir ausgesetzt waren, es gab Geräte, an denen man sich verletzen konnte, Gruben, die einen gleichsam lockten und in ihre Tiefe zu ziehen versuchten, morsche Balken auf dem Heuboden, die bei der kleinsten Berührung zerbrechen und uns in den Tod reißen würden. Von der näheren Umgebung gar nicht zu reden, es war uns untersagt, uns außer Sichtweite des Wohnhauses zu bewegen, und das bedeutete, dass wir den Hof nicht verlassen konnten, ohne uns über dieses Verbot hinwegzusetzen.
Direkt hinter den Gebäuden begannen die Wiesen, die von Bachläufen und Reihen von Bäumen durchzogen waren. Die gesamte Landschaft ist hügelig, sodass man schon nach mehreren Metern in einer Senke zu verschwinden vermag, ohne vom Haus aus gesehen werden zu können. Weiter draußen drohte dann der Wald, dessen unaussprechliche Gefahren eine weitere Zone des Verbots darstellten, sodass wir es niemals wagen sollten, ihn ohne Begleitung zu betreten. Das Problem war, dass wir niemanden hatten, der uns begleiten würde. Unsere Mutter und ihre Schwiegermutter waren nach dem Unfall vollauf damit beschäftigt, den Hof zu bewirtschaften, und sie vermochten trotzdem über die Jahre hinweg nicht, das Nötigste zu leisten, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Krankheiten dezimierten die Tiere, Kühe und Hühner fielen zum Teil Seuchen zum Opfer, die Einkünfte reichten nicht aus, um die verendeten Tiere zu ersetzen, das Geld blieb aus. In einem Jahr wurde der Zaun beschädigt, die Kühe brachen aus, manche wurden nicht wiedergefunden und verendeten wahrscheinlich irgendwo im Wald. Die Geräte wurden schlechter, fingen an zu rosten, verrotteten und waren nicht mehr zu reparieren. In späteren Jahren, als meine Großmutter nicht mehr helfen konnte, was meine Mutter ihr still zum Vorwurf machte, wurde der Betrieb völlig eingestellt, da meine Mutter es nicht mehr schaffte, für uns, ihre Schwiegermutter und den Hof zu sorgen. Sie machte ein wenig Geld damit, einige Gerätschaften, die noch zu benutzen waren, an andere Bauern aus dem Dorf zu verkaufen, aber dann war es an der Zeit, sich nach etwas anderem umzusehen. Sie hätte es nie übers Herz gebracht, den Hof oder die Ländereien zu veräußern, sie war hier geboren und wollte hier sterben, wir sollten den Hof übernehmen und später wieder zur alten Blüte führen. Das war zumindest, was sie sich für uns und unsere Zukunft vorstellte.
Aber es würde noch Jahre dauern, bis es so weit war, zunächst erfolgte der Rückzug meiner Mutter aus dem Leben im Dorf. Eine meiner frühesten Erinnerungen an mein Leben auf dem Hof ohne unseren Vater war das sonntägliche Ritual, wenn wir in die Kirche gingen. Schon lange vorher wurden wir angezogen und mussten darauf achten, die guten Sachen für den Sonntag nicht beim Frühstück zu beschmutzen. War alles im Haus erledigt, gingen wir gemeinsam den Weg entlang ins Dorf, der für uns Kinder jedes Mal eine Ewigkeit dauerte, an den leicht ansteigenden Rückweg wagten wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zu denken. Unser Hof lag so weit abseits, dass es lange dauerte, bis wir am nächsten Gehöft vorbeikamen. Auch hier machten sich die Bewohner auf den Weg ins Tal, wir grüßten kurz und gingen dann weiter, ich wusste nicht, warum wir die Nachbarn nicht abholten und mit ihnen gemeinsam weitergingen, manches Mal schien es mir sogar, als würden wir unseren Schritt absichtlich verändern, verlangsamen oder beschleunigen, wenn die Gefahr bestand, dass wir neben den anderen Familien hergehen müssten. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, warum das so sein sollte, und würde erst in den folgenden Jahren erfahren, was meine Mutter dazu trieb, die anderen zu meiden.
An der Kirche angekommen, setzten wir uns in eine der hinteren Reihen, und auch hier gewann ich mit der Zeit den Eindruck, dass wir zwar geduldet waren, aber nicht zu den anderen gehörten. Wir wurden gegrüßt, freundlich, wie es schien, aber auch zurückhaltend und mit einer gewissen Distanz, die man jemandem gegenüber zeigt, dem man meint, nicht vollständig vertrauen zu können. Es hatte den Anschein, als wären wir Fremde im Dorf, Zugezogene, die nicht wirklich dazugehörten, dabei war unsere Familie seit Generationen hier ansässig, länger als viele andere, und weit davon entfernt, nur so etwas wie Touristen zu sein oder Kirchgänger, die man lediglich zu Weihnachten in der Messe sah, die keine Lieder mitsingen und das Vaterunser nicht auswendig konnten und die wir deswegen immer etwas abfällig ansahen.
Wenn es darum ging, die heilige Kommunion zu empfangen, begann der Spießrutenlauf. Unsere Mutter und Großmutter nahmen uns bei der Hand, und jedes Mal gab es ein kleines Gedränge und Geschiebe, weil jeder lieber an der Hand der Großmutter laufen wollte. Später versuchten wir bereits vor Beginn der Messe dadurch, wie wir uns in die Bank setzten, zu beeinflussen, wer mit wem gehen durfte, aber meist war es meine Mutter, die meine Hand ergriff und durch den Mittelgang der Kirche nach vorne führte, während meine Schwester mit einem Lächeln die Hand der Großmutter nahm und uns folgte. Da wir in den hinteren Bänken saßen, gingen wir oft fast als Letzte durch den Gang und betrachteten die anderen Besucher der Messe. Ich weiß nicht, ob meine Mutter uns deswegen diesen Platz aussuchte, aber der Umstand, dass wir ganz hinten in der Schlange standen, bewirkte, dass uns kaum jemand beobachten konnte. In der Messe saßen wir hinter allen anderen, und es gab nur ein paar Kinder, die sich zu uns umdrehten, von ihren Eltern aber streng ermahnt wurden und nach ein paar Maßregelungen ruhig sitzen blieben und uns in Ruhe ließen. Während wir im Mittelgang standen und langsam voran trippelten, damit meine Mutter und Großmutter die Kommunion in Empfang nehmen konnten und wir vom Pfarrer einen Segen auf die Stirn erhielten, waren die meisten der anderen Gläubigen schon wieder auf ihre Plätze zurückgekehrt, knieten auf den Bänken und beteten. Zumindest war es das, wovon ich ausging, dass sie es taten, auf jeden Fall blickten alle angestrengt auf den Rücken ihres Vordermannes oder hatten sogar die Hände vor die Augen geschlagen, der Grund dafür war mir nicht bekannt, und ich wagte nicht, meine Mutter in der Kirche danach zu fragen. Nach der Messe war ich froh, mich endlich wieder bewegen zu können, auch wenn uns jetzt der Aufstieg bevorstand, aber an der frischen Luft hatte ich meine Frage schon wieder vergessen. Und so dauerte es bis zum nächsten Sonntag, bis ich mich erneut wunderte, warum man besser beten konnte, wenn man dabei nichts sah. Auf jeden Fall waren auf diese Weise die anderen mit sich selbst beschäftigt, und ich bemerkte nur selten einen verstohlenen Seitenblick auf uns, der schnell wieder abgewandt wurde, sobald ich ihn erwiderte. Ich konnte aber nicht deuten, ob dieses Verhalten damit zu tun hatte, dass man beim Beten eigentlich niemanden ansehen sollte, oder ob es an uns lag, dass diese Blicke so kurz und verstohlen schienen.
Diese Zeit, in der mein Bewusstsein erwachte und meine Erinnerung dauerhaft einsetzte, war eine seltsam prägende Phase für mich, die mir aber nie sonderbar vorkam, denn ich hatte es ja nie anders erfahren, zumindest nicht bewusst. Meine Schwester unterschied sich in dieser Hinsicht von mir, sie war mir ein gutes Jahr voraus und hatte Zeiten erlebt, in denen sie frei, ungebunden und ohne Kontrolle auf dem Hof herumlaufen konnte, Zeiten, in denen wir in der Kirche vorne saßen oder in denen uns Leute auf dem Hof, auf dem noch Tiere gehalten wurden, besuchen kamen. Ich bin mir heute sicher, dass der Umschwung, den der Tod unseres Vaters für uns alle bedeutete, sie am härtesten traf und in ihr eine Änderung hervorbrachte, die sie zu Anfang stärker rebellieren ließ als mich, der die Veränderung kaum mitbekommen hatte, in der späteren Zeit aber umso gefügiger machte, was die Wünsche unserer Mutter anging. Ich weiß nicht, wie es passierte, vermute aber, dass Frieda ihren Hass auf unseren Vater projizieren konnte, um ihn so zu kanalisieren und letztendlich loszuwerden. Ich glaube tatsächlich, dass sie davon überzeugt war und auch heute noch ist, dass sie richtig handelte und dass die Einflüsse und das Äußere, alles das, was nicht zur Familie gehört, tatsächlich das ist, was sich im Unrecht befindet. Ich glaube auch, dass sie erfolgreich gegen das ankämpfen konnte, was sie aus früheren Zeiten kannte, als Vater noch lebte. So wie sie ihn mir gegenüber dargestellt hat, war er für sie das Tor zu einer vergifteten Freiheit, zu Dingen, die Spaß machen konnten, die man aber früher oder später zu bereuen hatte und die deswegen nicht gut waren. Und er als der Versucher und Verführer, als derjenige, der diese Dinge möglich machte, war deswegen ein nur zu leichtes Ziel für ihren Hass und die Abscheu, die sie zeigte, wenn sie später von ihm sprach. Aber über das, was in meiner Schwester vorging, kann ich nur spekulieren, ich weiß lediglich, dass all das, woran ich mich bewusst erinnere, für mich eine gottgegebene Natürlichkeit besaß. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Anlass, an irgendetwas zu zweifeln, was in unserer Familie und darum herum vorging, es sollte noch Jahre dauern, bis die ersten Splitter in meinen Geist getrieben wurden, die ich nicht so einfach würde entfernen können.
Die Kirchenbesuche waren in dieser Zeit die einzigen Gelegenheiten, den Hof zu verlassen und andere Menschen zu treffen, wobei sich das Treffen darauf beschränkte, dass wir die anderen sahen und wahrnahmen, sie beobachteten, einschätzten und, basierend auf dem, was wir zu Hause praktizierten und lernten, auch bewerteten, aber ein wirklicher Kontakt fand nicht statt. Nach der Messe verließen wir aufgrund unseres Sitzplatzes oft als Erste die Kirche und machten uns sofort auf den Weg nach Hause, sodass wir keine Gelegenheit hatten, mit jemand anderem zu sprechen oder sogar zu spielen. Es gab einige Nachbarn mit älteren Kindern, die einen schnelleren Schritt hatten, und so kam es vor, dass uns ein paar Familien auf dem Weg zu unserem Hof überholten. Sie grüßten, wir grüßten zurück, man wünschte sich einen schönen Sonntag oder, je nach Anlass, schöne Feiertage, meine Großmutter wechselte vielleicht noch ein paar Worte über das Wetter oder die Ernte, aber damit war die Unterhaltung schon erschöpft, die anderen gingen weiter, wir sahen ihnen nach und dachten nicht weiter an sie. Zurück auf dem Hof war die größte Erleichterung, sich aus den sauberen Sonntagssachen herausschälen zu können. Mit ihnen wäre es unmöglich gewesen, zu spielen oder sogar auf dem Hof herumzulaufen, da immer peinlich darauf geachtet werden musste, dass sie schonend behandelt und niemals schmutzig wurden, damit sie möglichst lange hielten, was völlig unsinnig war, da wir ständig herauswuchsen. Aber vielleicht wurde so schon für kommende Generationen geplant, die die Kleidung erben und irgendwann auftragen würden. Wir wechselten also unsere Kleider, die Strenge und die Disziplin des gerade Erlebten fielen von uns ab, wir rannten herum und schrien so lange und so laut, bis uns unsere Mutter zurechtwies und anhielt, den heiligen Tag in Ehren zu halten.
Kapitel Fünf (außen)