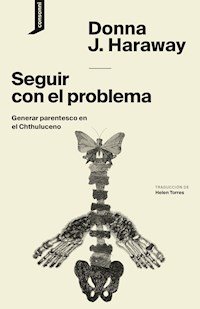Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Was kommt nach dem Menschen? In Donna Haraways Büchern wimmelt es von Cyborgs, Primaten, Hunden und Tauben. Die Grenze zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen Mensch und Tier verschwimmt. In ihrem neuen großen Buch ruft die feministische Theoretikerin das Zeitalter des Chthuluzän aus, das eben nicht - wie im Anthropozän - den Menschen ins Zentrum des Denkens und der Geschichte stellt, sondern das Leben anderer Arten und Kreaturen, seien es Oktopusse, Korallen oder Spinnen. Und nicht nur das: Es sollen neue Beziehungen entstehen, quer zu Vorstellungen biologischer Verwandtschaft. Im Zuge dessen setzt sich Haraway auch mit dem Klimawandel auseinander. Einmal mehr erweist sie sich als eine originelle und radikale Denkerin der Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Donna J. Haraway
Unruhig bleiben
Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän
Aus dem Englischen von Karin Harrasser
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Was kommt nach dem Menschen?
In Donna Haraways Büchern wimmelt es von Cyborgs, Primaten, Hunden und Tauben. Die Grenze zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen Mensch und Tier verschwimmt. In ihrem neuen großen Buch ruft die feministische Theoretikerin das Zeitalter des Chthuluzän aus, das eben nicht – wie im Anthropozän – den Menschen ins Zentrum des Denkens und der Geschichte stellt, sondern das Leben anderer Arten und Kreaturen, seien es Oktopusse, Korallen oder Spinnen. Und nicht nur das: Es sollen neue Beziehungen entstehen, quer zu Vorstellungen biologischer Verwandtschaft. Im Zuge dessen setzt sich Haraway auch mit dem Klimawandel auseinander. Einmal mehr erweist sie sich als eine originelle und radikale Denkerin der Gegenwart.
Vita
Donna J. Haraway ist emeritierte Professorin an der University of California, Santa Cruz. Sie ist Wissenschaftstheoretikerin, Biologin und Geschlechterforscherin. Im Campus Verlag erschien von ihr Die Neuerfindung der Natur (1995).
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1 Fadenspiele mit Art-GenossInnen
Vom Erzählen artenübergreifender Geschichten und über Praktiken für Gefährten
Kalifornische Wettkampftauben und ihre Leute: Kollaborative Künste für weltliches Gedeihen
Mit-Werden, einander befähigen
PigeonBlog
Verlässliche Reisende
Kapitel 2 Tentakulär denken. Anthropozän, Kapitalozän, Chthuluzän
Anthropozän
Kapitalozän
Chthuluzän
Kapitel 3 Sympoiesis. Symbiogenese und die dynamischen Künste, beunruhigt zu bleiben
Symbiogenese
Verwebungen von Wissenschaft und Kunst mit involutionärem Impuls
Wissenschaftlich-künstlerische Verweltlichungen, um unruhig zu bleiben
Vier kritische Zonen
Wiederaufleben in vier Teilen
Das gehäkelte Korallenriff
Das madagassische Ako-Projekt
Never Alone (Kisima Ingitchuna)
Navajo-Weberei: Kosmologische Performance, mathematischer Rhythmus, Navajo-Churro-Schafe, Hózhó
Ein Abschlussknoten
Kapitel 4 Sich verwandt machen. Anthropozän, Kapitalozän, Plantagozän, Chthuluzän
Kapitel 5 Überschwemmt von Urin. DES und Premarin in artenübergreifender Responsabilität
Cyborg-Wurfgeschwister
DES für Hot Pepper
Verwandtschaft konjugieren mit Premarin
Virale Responsabilität
Kapitel 6 Welten säen. Eine Tüte Samen für das Terraforming mit irdischen Anderen
Kapitel 7 Eine neugierige Praxis
Kapitel 8 Camilles Geschichten. Die Kinder der Kompostisten
Die Welt der Camilles imaginieren
Camilles Geschichten
Camille 1
Camille 2
Ich bin Mazahua
Camille 3
Camille 4
Camille 5
Starhawks Lied, wie es von den SprecherInnen für die Toten gelehrt wird
Anhang
Anmerkungen
Einleitung
Kapitel 1: Fadenspiele mit Art-GenossInnen
Kapitel 2: Tentakulär denken. Anthropozän, Kapitalozän, Chthuluzän
Kapitel 3: Sympoiesis. Symbiogenese und die dynamischen Künste, beunruhigt zu bleiben
Kapitel 4: Sich verwandt machen. Anthropozän, Kapitalozän, Plantagozän, Chthuluzän
Kapitel 5: Überschwemmt von Urin. DES und Premarin in artenübergreifender Responsabilität
Kapitel 6: Welten säen. Eine Tüte Samen für das Terraforming mit irdischen Anderen
Kapitel 7: Eine neugierige Praxis
Kapitel 8: Camilles Geschichten. Die Kinder der Kompostisten
Literatur
FOR KIN MAKERS OF ALL THE ODDKIN
Einleitung
Trouble1 ist ein interessantes Wort. Es lässt sich auf ein französisches Verb aus dem 13. Jahrhundert zurückführen, das »aufwirbeln«, »wolkig machen« oder »stören« bedeutet. Wir alle auf Terra leben in unruhigen Zeiten, in aufgewirbelten Zeiten, in trüben und verstörenden Zeiten. Die Aufgabe besteht nun darin, reagieren zu können, und zwar gemeinsam und in unserer je unbescheidenen Art. Aufgewirbelte Zeiten quellen über vor Schmerz und Freude, vor sehr ungerechten Mustern von Schmerz und Freude, vor sinnlosem Abtöten des Weiterbestehens (ongoingness)2, aber auch vor unerlässlicher Wiederbelebung. Die Aufgabe besteht darin, sich entlang erfinderischer Verbindungslinien verwandt zu machen und eine Praxis des Lernens zu entwickeln, die es uns ermöglicht, in einer dichten Gegenwart und miteinander gut zu leben und zu sterben. Es ist unsere Aufgabe, Unruhe zu stiften, zu wirkungsvollen Reaktionen auf zerstörerische Ereignisse aufzurütteln, aber auch die aufgewühlten Gewässer zu beruhigen, ruhige Orte wieder aufzubauen. In dringlichen Zeiten ist es für viele verlockend, der Unruhe zu begegnen, indem sie eine imaginierte Zukunft in Sicherheit bringen. Dafür versuchen sie, am Zukunftshorizont Drohendes zu verhindern, aber auch Gegenwart und Vergangenheit beiseitezuräumen, um so für kommende Generationen Zukunft zu ermöglichen. Unruhig zu bleiben erfordert aber gerade nicht eine Beziehung zu jenen Zeiten, die wir Zukunft nennen. Vielmehr erfordert es zu lernen, wirklich gegenwärtig zu sein. Gegenwärtigkeit meint hier nicht einen flüchtigen Punkt zwischen schrecklichen oder paradiesischen Vergangenheiten und apokalyptischen oder erlösenden Zukünften, sondern die Verflechtung von uns sterblichen Krittern3 mit unzähligen unfertigen Konfigurationen aus Orten, Zeiten, Materien, Bedeutungen.
Chthuluzän ist ein einfaches Wort.4 Es verbindet zwei griechische Wurzeln (khthôn und kainos) miteinander, die zusammen eine Art Zeitort benennen; einen Zeitort des Lernens, um die Idee eines responsablen (response-able)5 gemeinsamen Lebens und Sterbens auf einer beschädigten Erde nicht aufzugeben. Kainos heißt jetzt, eine Zeit des Anfangens, eine Zeit des Weitermachens, eine Zeit für Frische. Nichts in kainos muss gängige Auffassungen von Vergangenheiten, Gegenwarten und Zukünften bestätigen. Zeiten des Anfangens implizieren nicht, dass das, was war oder was kommen wird, ausgelöscht werden müsste. Kainos kann voller Erbschaften sein, voller Erinnerungen, aber auch voll mit Kommendem, mit der Förderung dessen, was noch sein könnte. Ich höre kainos als dichte und andauernde Gegenwart, mit Zellfäden durchzogen, die alle möglichen Zeitlichkeiten und Stofflichkeiten durchdringen.
Die Chthonischen sind Wesen der Erde, gleichzeitig alt und aktuell. Ich stelle mir die Chthonischen als reichlich mit Tentakeln, Fühlern, Fingern, Fäden, Geißeln, Spinnenbeinen und unbändigem Haar versehen vor. Die Chthonischen tummeln sich im Humus multipler Kritter, aber mit dem in den Himmel starrenden Homo wollen sie nichts zu tun haben. Die Chthonischen sind Monster im besten Sinn: Sie führen die materielle Bedeutungsfülle irdischer Prozesse und Kritter vor und auf. Sie führen auch Konsequenzen vor und auf. Die Chthonischen sind keine sichere Bank; sie haben mit IdeologInnen nichts zu schaffen; sie gehören zu niemandem; sie winden sich und luxurieren in vielfältigen Formen und tragen in all den Lüften, Wassern und Orten dieser Erde ebenso vielfältige Namen. Sie stellen her und lösen auf; sie werden hergestellt und aufgelöst. Sie sind, was existiert. Kein Wunder, dass die weltgrößten Monotheismen, sowohl in religiösem als auch in säkularem Gewand, die Chthonischen immer wieder vernichten wollten. Die Skandale jener Zeiten, die Anthropozän und Kapitalozän genannt werden, sind die jüngsten und gefährlichsten dieser Vernichtungskräfte. Miteinander zu leben und miteinander zu sterben haben im Chthuluzän das Potenzial einer Kampfansage an die Diktate des Anthropos und des Kapitals.
Kin (Verwandtschaft, Sippschaft) ist eine wilde Kategorie, die viele verschiedene Leute zu zähmen versuchen. Sich auf eigensinnige Art verwandt zu machen anstatt, oder zumindest zusätzlich, mit der göttlichen, genealogischen und biogenetischen Familie, rührt wichtige Dinge auf; zum Beispiel die Frage, wem gegenüber man eigentlich verantwortlich ist. Wer lebt und wer stirbt und auf welche Art und Weise in dieser Verwandtschaft und nicht in jener? Welche Gestalt hat diese Sippe, welche Orte und welche Kritter verbinden und trennen die Verwandtschaftslinien, und warum das Ganze? Was muss durchschnitten und was muss verknüpft werden, damit artenübergreifendes Gedeihen auf dieser Erde eine Chance hat; ein Gedeihen, das menschliche und anders-als-menschliche Wesen in die Verwandtschaft miteinschließt?
Eine allgegenwärtige Figur dieses Buches ist SF: Science-Fiction, spekulative Fabulation, Spiele mit Fadenfiguren (string figures), spekulativer Feminismus, science fact (wissenschaftliche Fakten), so far (bis jetzt). Diese Liste wirbelt und schlängelt sich immer wieder durch die kommenden Seiten; in Worten, aber auch in Bildern, die mich und meine LeserInnen in Wesen und Muster verflechten, die auf dem Spiel stehen. Wissenschaftliche Fakten und spekulative Fabulation brauchen einander und beide brauchen einen spekulativen Feminismus. SF und Fadenspiele denke ich im dreifachen Sinn als Figurationen. Erstens zupfe ich großzügig Fasern aus verklumpten und dichten Ereignissen und Praktiken heraus. Ich versuche, den Fäden zu folgen und die Spuren so zu lesen, dass ihre Verwicklungen und Muster entscheidend dafür werden, wie wir an wirklichen und spezifischen Orten, in wirklichen und spezifischen Zeiten unruhig bleiben können. So verstanden ist SF eine Methode des Nachzeichnens, des Verfolgens eines Fadens in die Dunkelheit, in eine gefährlich wahre Abenteuergeschichte hinein, in der vielleicht klarer wird, wer für die Kultivierung artenübergreifender Gerechtigkeit lebt oder stirbt und warum. Zweitens ist SF nicht nur die Methode des Nachverfolgens, sondern das Ding an sich: jenes Muster und jene Versammlung, die eine Antwort verlangen; das Ding, das man selbst nicht ist, aber mit dem man weitermachen muss. Drittens bedeutet SF weitergeben und entgegennehmen, herstellen und aufheben, Fäden aufnehmen und fallen lassen. SF ist eine Praxis und ein Prozess, ein Werden-mit-anderen in überraschender Aufeinanderfolge, eine Figur des Fortdauerns im Chthuluzän.
Das Buch und das Konzept des Unruhig-Bleibens sind unvereinbar mit zwei häufigen Reaktionen auf die Schrecken von Anthropozän und Kapitalozän. Die eine Reaktion ist einfach zu beschreiben und, so glaube ich, ebenso einfach zu verwerfen, nämlich der geradezu lächerliche Glaube an technische Lösungen, ob nun säkularer oder religiöser Art: Eine Technik wird auftauchen, um ihre schlimmen, aber sehr schlauen Kinder zu retten; oder, was auf dasselbe hinausläuft: Gott wird kommen, um seine ungehorsamen, aber hoffnungsvollen Kinder zu retten. Angesichts solch rührender Einfältigkeit, was technische Lösungen (oder Technikapokalypsen) betrifft, fällt es manchmal schwer, an technischen Projekten und ihren Leuten festzuhalten. Diese Projekte sind nicht feindlich. Sie können Wichtiges dazu beitragen, unruhig zu bleiben und produktive, eigensinnige Verwandtschaften (oddkin)6 einzugehen.
Die zweite häufige Reaktion lässt sich weniger schnell verwerfen und ist noch destruktiver. Es ist die Aussage: Das Spiel ist vorbei, es ist zu spät. Es ist sinnlos zu versuchen, irgendetwas besser zu machen oder zumindest einander wirksam zu vertrauen, um gemeinsam für eine wiederauflebende Welt zu arbeiten und zu spielen. Einige WissenschaftlerInnen aus meinem Bekanntenkreis sind voll von diesem bitteren Zynismus, obwohl sie eigentlich sehr hart dafür arbeiten, eine positive Veränderung für Leute und andere Kritter zu bewirken. Auch Leute, die sich als kritische KulturtheoretikerInnen oder als politisch progressiv verstehen, äußern sich so oder ähnlich. Ich denke, dass die seltsame Verbindung aus tatsächlichem Spielen und Arbeiten für eine aufblühende, artenübergreifende Welt und einer game-over-Haltung, die andere, einschließlich Studierende, entmutigt, durch verschiedene Formen des Futurismus gefördert wird. Eine Version des Futurismus besagt, dass nur funktionierende Dinge eine Veränderung herbeiführen können; oder noch schlimmer: Nur wenn das, was ich und meine ExpertenkollegInnen machen, das Problem lösen kann, ist es eines. Großzügiger gesprochen: Manchmal wissen WissenschaftlerInnen und andere, die denken, lesen, studieren, agitieren und sich sorgen, zu viel, und das wird ihnen dann zu schwer. Oder wir denken, wir wissen genug, um zu dem Schluss zu kommen, dass das Leben auf der Erde, das Menschen auf irgendeine erträgliche Art und Weise miteinschließt, wirklich vorbei ist, dass die Apokalypse wirklich naht.
Eine solche Haltung ist inmitten der sechsten großen Auslöschung auf dieser Erde recht plausibel, inmitten gefräßiger Kriege und Extraktivismus und angesichts der Verelendung von Milliarden Menschen und anderen Krittern für etwas, das »Profit« oder »Macht« genannt wird – oder auch »Gott«. Eine game-over-Haltung drängt sich auf, wenn man intensiv spürt, und nicht nur weiß, dass die Zahl der Menschen im Jahr 2100 vermutlich über 11 Milliarden betragen wird. Das heißt, dass sich zwischen 1950 und 2100, also in nur 150 Jahren, die menschliche Weltbevölkerung um 9 Milliarden vergrößert haben wird. Dies wird sich nicht nur auf Arme und Reiche sehr unterschiedlich auswirken – wobei die Reichen die Erde viel stärker belasten als die Armen –, sondern vor allem verheerende Folgen für beinahe alle nichtmenschlichen Wesen haben. Für solch düstere Realitäten lassen sich viele andere Beispiele finden; die Großen Beschleunigungen der Nachkriegsära meißeln ihre Spuren in die Steine, Gewässer und Kritter der Erde. Nur ein schmaler Grat trennt die Anerkennung des Ausmaßes und des Ernstes dieser Probleme von der Kapitulation vor einem abstrakten Futurismus mit seinen Gefühlen erhabener Verzweiflung und seiner Politik ebenso erhabener Indifferenz.
Dieses Buch führt aus und durch, dass das Bewahren von Unruhe unter Vermeidung von Futurismus ein ernsthafterer und produktiverer Zugang ist. Um unruhig zu bleiben, müssen wir uns auf eigensinnige Art verwandt machen. Das meint, dass wir einander in unerwarteten Kollaborationen und Kombinationen, in aktiven Kompostierungen brauchen. Wir werden miteinander oder wir werden gar nicht. Diese Art der materiellen Semiotik findet stets situiert, an einem bestimmten Ort, wo und nicht nirgendwo statt, sie ist verwoben und weltlich. Als Einzelne, mit unseren je eigenen Expertisen und Erfahrungen, wissen wir zu viel und zu wenig; also überlassen wir uns der Verzweiflung oder der Hoffnung, obwohl weder das eine noch das andere eine kluge Haltung ist. Weder Verzweiflung noch Hoffnung sind auf Sinnlichkeit, auf von Geist erfüllte Materie, auf materielle Semiotik oder auf sterbliche Erdlinge in dichter Kopräsenz gestimmt. Weder Verzweiflung noch Hoffnung sind gut darin, uns »Fadenspiele mit Art-GenossInnen«, so der Titel des ersten Kapitels, beizubringen.
Drei ausführliche Kapitel eröffnen Unruhig bleiben. Jedes Kapitel verfolgt Geschichten und Figuren des Sich-verwandt-Machens im Chthuluzän; Geschichten und Figuren, die es ermöglichen, die Fesseln des Anthropozäns und des Kapitalozäns zu zerschneiden. Tauben in all ihrer irdischen Vielfalt – als Geschöpfe des Imperiums, als Wettkampfvögel der Arbeiterklasse, als Kriegsspione, als wissenschaftliche ForschungspartnerInnen, als Kollaborateure im Kunstaktivismus auf drei Kontinenten, als städtische Begleiter und Ärgernisse – sind die Reiseführer des ersten Kapitels.
Mit ihrer häuslichen Geschichte führen die Tauben in eine Praxis des »tentakulären Denkens« hinein, die im zweiten Kapitel vorgestellt wird. Ich entwickle hier das Argument weiter, dass ein eingeschränkter Individualismus mit seinen vielen Schattierungen in Wissenschaft, Politik und Philosophie endlich nicht mehr für das Denken zur Verfügung steht, undenkbar geworden ist, weder technisch noch auf andere Art und Weise länger brauchbar ist. Sympoiesis – machen-mit – ist das Schlüsselwort dieses Kapitels, in dem ich Geschenken nachforsche, die TheoretikerInnen und GeschichtenerzählerInnen für das Denken bereithalten. Meine PartnerInnen in der Wissenschaftsforschung, in der Kulturanthropologie und im Geschichtenerzählen – Isabelle Stengers, Bruno Latour, Thom van Dooren, Anna Tsing, Marilyn Strathern, Hannah Arendt, Ursula K. Le Guin und andere – sind überall im tentakulären Denken meine GefährtInnen. Mit ihrer Unterstützung erläutere ich die drei Zeitsphären dieses Buches: das Anthropozän, das Kapitalozän und das Chthuluzän. Verbündet mit dem Großen Blauen Kraken beendet Medusa, diese einzige sterbliche Gorgone, die als Gebieterin der Tiere dargestellt wird, das Kapitel – und rettet die Lage.
»Sympoiesis. Symbiogenese und die dynamischen Künste, beunruhigt zu bleiben«, Kapitel 3, spinnt die Fäden des aus der ökologischen Evolutions- und Entwicklungsbiologie kommenden Konzepts der Sympoiesis weiter in den Kunst- und Wissenschaftsaktivismus hinein, in Praktiken, die vier ikonischen, beunruhigten Orten verpflichtet sind: dem Holobiom von Korallenriffen; dem Black Mesa-Kohlefeld auf Navajo- und Hopi-Territorium und anderen Abbaugebieten von fossilen Brennstoffen, deren grausame Auswirkungen besonders indigene Völker spüren; den komplexen Lemurenhabitaten Madagaskars und der nordamerikanischen Zirkumpolarregion, wo Land und Wasser von schnell schmelzendem Eis sowie von alten und neuen Kolonialismen bedroht sind. Das Kapitel lässt Spielfäden zwischen Biologie, Kunst und Aktivismus für eine wiederauflebende, artenübergreifende Welt hin- und hergehen. Navajo-Churro-Schafe, Orchideen, ausgestorbene Bienen, Lemuren, Quallen, Korallenpolypen, Seehunde und Mikroben spielen mit ihren KünstlerInnen, BiologInnen und AktivistInnen die Hauptrolle in diesem Kapitel. Hier wie auch sonst überall treibt die geduldige Kreativität von Menschen, die sich kümmern und die etwas tun, die Handlung voran. Und wenig überraschend sind es insbesondere heutige indigene Völker und Menschen, die in Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern etwas bewirken. BiologInnen, zuallererst die unvergleichliche Lynn Margulis, durchdringen das Denken und Spielen in diesem Kapitel.
»Sich verwandt machen«, das 4. Kapitel, kommt noch einmal auf die Zeitsphären Anthropozän, Kapitalozän und Chthuluzän zurück. Und es formuliert den Appell: »Macht euch verwandt, nicht Babys!« Antirassistische, antikoloniale, antikapitalistische, pro-queere FeministInnen unterschiedlichster Herkunft engagieren sich schon lange für sexuelle und reproduktive Freiheit und die damit verbundenen Rechte. Die Brutalität und Rücksichtslosigkeit reproduktiver und sexueller Gebote gegenüber armen und marginalisierten Menschen haben sie dabei besonders im Blick. FeministInnen beharren darauf, dass sexuelle und reproduktive Freiheit bedeutet, die eigenen oder auch die Kinder anderer innerhalb von intakten und sicheren Gemeinschaften zu robusten und gesunden Erwachsenen großzuziehen. FeministInnen waren auch historisch einzigartig klar darin, auf das Recht jeder Frau, ob jung oder alt, zu bestehen, kein Kind zu bekommen. Wohl wissend, wie leicht eine solche Position die Arroganz des Imperialismus wiederholen kann, halten FeministInnen meiner Prägung daran fest, dass Mutterschaft nicht das Schicksal der Frauen ist. Die reproduktive Freiheit einer Frau ist weitaus wichtiger als Anforderungen des Patriarchats oder jedes anderen Systems. Nahrung, Arbeit, Wohnen, Bildung, Reisemöglichkeit, Gemeinschaft, Frieden, Kontrolle über den eigenen Körper und die eigene Intimität, Gesundheitsvorsorge, brauchbare und frauenfreundliche Verhütung, das letzte Wort darüber, ob ein Kind geboren wird oder nicht, Freude: Diese und mehr sind sexuelle und reproduktive Rechte. Ihre weltweite Abwesenheit verschlägt einem den Atem. Aus guten Gründen lehnen mir bekannte FeministInnen die Sprache und Politik der Bevölkerungskontrolle ab, verfolgen diese doch nachweislich eher biopolitisch-staatliche Interessen und sorgen sich weniger um das Wohlergehen von Frauen und ihren Leuten, alten wie jungen. Hierdurch entstandene Skandale bei der Bevölkerungskontrolle sind folglich nicht schwer zu finden. Dennoch sind meiner Erfahrung nach FeministInnen, auch aus der Wissenschaftsforschung und der Kulturanthropologie, nicht ernsthaft gewillt, die Große Beschleunigung im Anwachsen der Weltbevölkerung gezielt anzusprechen. Sie fürchten, dass sie dadurch zurück in den Sumpf von Rassismus, Klassismus, Nationalismus, Modernismus und Imperialismus fallen.
Furcht allein reicht aber nicht. Wird die Brisanz des unglaublichen Bevölkerungswachstums seit 1950 weiter ausgeblendet, könnte dies in so etwas abgleiten wie die Ignoranz mancher Christen gegenüber dem Klimawandel, weil er ins Mark des eigenen Glaubens trifft. Wie wir uns mit dieser Brisanz und Dringlichkeit befassen, muss die brennende Frage sein, damit wir unruhig bleiben können. Was ist dekoloniale, feministische, reproduktive Freiheit in einer gefährlich aufgewühlten, artenübergreifenden Welt? Das kann keine rein humanistische Angelegenheit sein, ganz egal wie anti-imperalistisch, antirassistisch, antiklassistisch und pro-weiblich sie ausfällt. Es kann auch keine »futuristische« Angelegenheit sein, die sich hauptsächlich mit abstrakten Zahlen und Big Data beschäftigt und nicht mit den sehr unterschiedlichen, vielschichtigen Lebens- und Sterbeweisen von wirklichen Menschen. Dennoch ist ein Anwachsen der Bevölkerungszahl in 150 Jahren um 9 auf 11 Milliarden bis 2100 (wenn wir Glück haben) mehr als nur eine Zahl; und sie lässt sich nicht einfach wegerklären, indem die Sache auf den Kapitalismus oder einen anderen Ismus geschoben wird. Es ist dringend notwendig, gemeinsam und neu, quer zu historischen Differenzen und zwischen allen möglichen Wissensformen und Expertisen zu denken.
»Überschwemmt von Urin«, Kapitel 5, beginnt mit persönlichen und intimen Beziehungen, die, von Östrogen ausgelöst, eine alternde Frau und ihren betagten Hund verbanden und die anfingen, sich schwelgerisch in Konsequenzen auszubreiten. Im Speziellen geht es um mich und meine Gefährtin, meine Forschungspartnerin Cayenne. Ehe noch die Fäden dieses Spiels in Erinnerung an ihre Cyborg-Wurfgeschwister weit verfolgt wurden, finden sich Frau und Hündin in den Geschichten von Veterinärmedizin, Pharmazie, Pferdelandwirtschaft für Östrogen, Zoos, DES-Aktivismus,7 von miteinander zusammenhängenden Tierrechts- und Frauengesundheitsmaßnahmen und so manchem mehr wieder. Das Kernthema ist hier, wie spezifische Körper und Orte intensiv und so bewohnt werden können, dass die Fähigkeit, gemeinsam auf weltliche Dringlichkeiten zu reagieren, kultiviert werden kann.
Ursula K. Le Guin, Octavia Butler sowie Ameisen und Akaziensamen bewohnen das 6. Kapitel, »Welten säen«. Die Aufgabe war hier, eine SF-Abenteuerstory über Akazien und ihre MitarbeiterInnen zu erzählen. Uns zur Rettung kommen Le Guins Tragetaschentheorie der Fiktion und die Theorien der Biologin Deborah Gordon über die Interaktion von Ameisen und ihr Kolonieverhalten. Es geht darum, die Möglichkeiten einer ökologisch-evolutionär-entwicklungsgeschichtlichen Biologie und nicht-hierarchischer Systemtheorien für die Gestaltung der besten Geschichten auszuloten. Science-Fiction und science fact leben in dieser Fabel glücklich miteinander. In den letzten Abschnitten treten mit Le Guin als ihrer Schreiberin die Prosa der Akaziensamen und die Lyrik der Flechten zugunsten einer stummen Poesie der Steine zurück.
»Eine neugierige Praxis«, Kapitel 7, zoomt auf die Philosophin, Psychologin, Tier-Mensch-Forscherin und Kulturtheoretikerin Vinciane Despret. Sie besitzt die unvergleichliche Fähigkeit zum Denken-mit anderen Wesen, menschlichen und nicht-menschlichen. Desprets Arbeit über das Aufeinander-Einstimmen und über Kritter, die sich gegenseitig und in konkreten Situationen zu unerwarteten Leistungen befähigen, ist notwendig, um unruhig zu bleiben. Ihre Aufmerksamkeit gilt nicht dem, was Kritter »von Natur aus« oder durch Erlernen können, sondern dem, was sie untereinander und miteinander bewirken und was zuvor weder in Natur noch Kultur vorhanden war. Ihre Art zu denken erweitert die Fähigkeiten aller MitspielerInnen; das ist ihre Verweltlichungspraxis (worlding practice). Die Dringlichkeiten des Anthropozäns, des Kapitalozäns und des Chthuluzäns verlangen diese Art des Denkens, eines, das überlieferte Kategorien und Fähigkeiten überschreitet, und zwar auf häusliche und konkrete Art. Es ist ein Denken, wie es zum Beispiel Graudrosslinge und ihre ForscherInnen in der Negev-Wüste bewerkstelligen. Despret lehrt uns, wie man neugierig ist und wie man trauert. Nämlich indem man die Toten aktiv einbezieht. Und ich brauchte ihre Berührung, um die letzten Geschichten dieses Buches schreiben zu können. Ihre neugierige Praxis hat mich erst dazu bereit gemacht, über die Gemeinschaften der Kompostisten und über die Aufgabe der Sprecher für die Toten zu schreiben, die für das Zurückgewinnen und Wiederaufleben einer artenübergreifenden Welt arbeiten.
»Camilles Geschichten. Die Kinder der Kompostisten« beschließt das Buch. Diese Einladung zu einer kollektiven, spekulativen Fabulation verfolgt fünf Generationen einer symbiogenetischen Verbindung zwischen einem Menschenkind und Monarchfaltern entlang der vielen Linien und Knoten, die die Wanderungen dieses Insekts zwischen Mexiko, den USA und Kanada ergeben. Diese Linien zeichnen Spuren von Gemeinwesen und Stofflichkeiten nach, die wesentlich für ein Leben und Sterben mit vom Aussterben bedrohten Krittern sind – damit es sie vielleicht weiterhin geben kann. Die Gemeinschaften der Kompostisten entstanden im frühen 21. Jahrhundert überall auf der Welt, in und auf ruinierten Ländern und Gewässern. Sie gründeten sich in der Selbstverpflichtung, Responsabilität zu befördern und Praktiken der wechselseitigen Befähigung zu kultivieren. Die Gemeinschaften bekannten sich dazu, mitzuhelfen, die menschliche Weltbevölkerung über einige Hundert Jahre hinweg radikal zu verringern, und gleichzeitig unzählige Praktiken von artenübergreifender Umweltgerechtigkeit zu entwickeln. Jedes neue Kind hatte mindestens drei menschliche Eltern; für den schwangeren Elternteil bestand seine/ihre reproduktive Freiheit auch darin, einen Tiersymbionten für das Kind zu wählen, eine Wahl, die sich in die Generationenfolge aller Arten hinein verzweigte. Die Beziehungen zwischen symbiogenetischen Leuten und unverbundenen Menschen waren oft überraschend, manche von ihnen waren auch tödlich. Die größte Überraschung aber entsprang aus der neuen Beziehung der Lebenden und der Toten, eine Beziehung von großer symanimagenischer Komplexität quer durch die Holobiome der Erde.
Viel Unruhe, viel Verwandtschaft, um weiterzumachen.
Kapitel 1 Fadenspiele mit Art-GenossInnen
George Evelyn Hutchinson (1903–1991)und Beatriz da Costa (1974–2012) gewidmet.
Hutchinson, der meine Dissertation betreut hat, schrieb eine biografische Erinnerung, deren Titel The Kindly Fruits of the Earthall die »verlässlichen Reisenden« dieses Kapitels umfasst.
Abb. 1.1 Artenübergreifende Fadenspiele. Zeichnung von Nasser Mufti, 2011.
Kalifornische Wettkampftauben und ihre Leute: Kollaborative Künste für weltliches Gedeihen
Mit-Werden, einander befähigen
Die Fähigkeiten von Tauben überraschen und beeindrucken jene Menschen, die oft vergessen, wie sehr sie selbst von Dingen und Lebewesen befähigt werden. Für die Ausformung von Responsabilität können Dinge und Lebewesen innerhalb und außerhalb menschlicher Körper, in ganz verschiedenen räumlichen und zeitlichen Maßstäben relevant sein. Die SpielerInnen beschwören, lösen aus und rufen gemeinsam hervor, was und wer existieren wird. Im Mit-Werden und in gegenseitiger Befähigung erfinden sie n-dimensionale Nischenräume und deren BewohnerInnen. Das Ergebnis wird häufig Natur genannt. Taubennaturen, sofern sie als solche Koproduktionen aufgefasst werden, sind wichtig für meine SF-Geschichte.
Abb. 1.3Bird Man of the Mission; das Mauerbild zeigt einen obdachlosen, psychisch kranken Mann namens Lone Star Swan und manche seiner städtischen Tauben, die seine FreundInnen und GefährtInnen auf den Straßen des Mission-District in San Francisco waren. Gemalt wurde das Bild von Daniel Doherty 2006 als Teil des Clarion Alley Mural Project. Das Werk war schwer getagged und wurde 2013 übermalt. Jane Bregman hat für das Street Art SF-Team die Geschichte von Bird Man of the Mission aufgeschrieben und am 7. Oktober 2014 veröffentlicht. Auf der Webseite des Street Art SF-Teams ist sie zu finden. Foto: James Clifford. © Daniel Doherty, Clarion Alley Mural Project.
Tauben, die an ihnen unbekannten Orten freigelassen werden, finden auch an wolkigen Tagen über Tausende Kilometer den Weg zurück zu ihrem Taubenschlag.15 Tauben haben einen Karten-Sinn und einen Kompass-Sinn, beides hat sie sehr beliebt gemacht: bei TaubenzüchterInnen, die mit ihnen Wettrennen veranstalten; bei WissenschaftlerInnen, die sich für die Verhaltensbiologie der Orientierung und der Navigation interessieren; bei Spionen, die Nachrichten durch Feindeslandes schicken möchten, und bei VerfasserInnen von Kriminalromanen, die auf die guten Tauben vertrauen, um Geheimnisse zu transportieren.16 Taubenrennen-Enthusiasten gibt es rund um den Globus, doch die Hotspots des Sports sind wahrscheinlich die Dächer von Kairo und Istanbul oder auch die migrantischen, muslimischen Nachbarschaften in europäischen Städten wie Berlin. Dort züchten und füttern fast ausschließlich Männer und Jungen ihre talentierten Vögel sorgfältig und aufwändig, damit sie von den Freisetzungspunkten möglichst schnell und genau heimkehren. Ganz normale, »wilde« Tauben sind aber auch alles andere als schlecht darin, nach Hause zu finden.
Tauben orientieren sich an ihnen bekannten Punkten, um den Weg zu finden. Sie können Objekte und Gebäude während des Fluges sehr gut erkennen und unterscheiden. In den 1970er und 1980er Jahren führte die US-Küstenwache das Projekt Sea Hunt durch, bei dem Tauben im offenen Meer treibende Personen oder Ausrüstung viel besser ausmachten als die Menschen.17 Tatsächlich lagen Tauben in 93 Prozent aller Fälle richtig, Menschen nur in 38 Prozent. Die Tauben hockten in einer Beobachtungskugel an der Unterseite eines Helikopters und pickten auf Tasten, um ihre Beobachtungen mitzuteilen. Wenn sie mit ihren eigenen Leuten arbeiten durften statt isoliert, lagen sie sogar fast zu 100 Prozent richtig. Zweifellos mussten die Tauben und das Personal der Küstenwache lernen, miteinander zu kommunizieren, und die Tauben mussten lernen, wofür sich ihre Menschen interessierten. Menschen und Vögel mussten auf nichtmimetische Art und Weise pädagogische und technische Wege finden, sich wechselseitig für Probleme zu befähigen, die neu für sie alle waren. Die Tauben stiegen allerdings nie in Jobs auf, in denen sie tatsächliche Schiffbrüchige retten konnten. 1983 wurde das Projekt beendet, da nach zwei Helikopterabstürzen die Bundesfinanzierung eingestellt wurde.
Nur wenige anders-als-menschliche Kritter haben menschliche SkeptikerInnen davon überzeugt, dass Tiere sich selbst im Spiegel erkennen können – über dieses Talent erfahren WissenschaftlerInnen, wenn Tauben nach Farbklecksen oder anderen Markern auf ihrem Körper picken, die sie nur im Spiegel sehen können. Diese Fähigkeit teilen Tauben unter anderem mit menschlichen Kindern über zwei Jahren, Rhesus-Affen, Schimpansen, Elstern, Delfinen und Elefanten.18 Weil diese Forschungsrichtungen theoretisch und methodisch geradezu berauscht sind vom Individualismus, hat sogenannte Selbsterkenntnis in der westlich beeinflussten Psychologie und Philosophie großes Gewicht. Soll mit diesen Tests nachgewiesen werden, wer etwas kann und wer nicht, gleicht dies einem epistemologischen Wettkampf. Tauben haben ihren ersten Spiegeltest 1981 im Labor von B. F. Skinner bestanden.19Science News hat 2008 berichtet, dass ForscherInnen der Keio-Universität gezeigt hätten, dass sich Tauben selbst in fünf bis sieben Sekunden verzögerten Spiegel- oder Videobildern besser erkannt haben als drei Jahre alte Menschenkinder.20 Tauben können auch sehr gut verschiedene Menschen auf Fotos unterscheiden. In Professor Shigeru Watanabes Laboratory of Comparative Neuroscience an der Keio-Universität konnten sie Bilder von Monet und Picasso auseinanderhalten, sogar Generalisierungen treffen und ihnen unbekannte Bilder verschiedenen Stilen und Malschulen zuordnen.21 Es wäre allerdings ein Fehler, die Argumentation entlang der vorhersehbaren Linie von »meine Vogelhirnkognition ist besser als oder genauso gut wie deine Affenhirnkognition« zu bauen. Was hier passiert, scheint mir interessanter als dieser Wettbewerb zu sein und reicher an Konsequenzen für ein gutes Miteinanderauskommen, für Zuwendung in emergenter Ähnlichkeit und Differenz. Tauben, Leute und Apparate haben sich hier zusammengetan, um sich wechselseitig zu etwas Neuem in einer Welt artenübergreifender Beziehungen zu befähigen.
Es ist völlig in Ordnung, Beweise für eine Selbstwerdung im Sinne der Selbstwahrnehmung in bestimmten Laboranordnungen zu liefern. Ebenso entscheidend ist aber, einander und andere Wesen auf eine Art und Weise zu erkennen und anzuerkennen, die für die Lebensvollzüge der jeweiligen Kritter sinnvoll ist, egal ob sie in Brieftaubenschlägen oder an urbanen Orten leben. Über diese Themen gibt es interessante Forschung, aber ich möchte lieber die Online-Essays von Tanya Berokoff einblenden, die sie als Racing Pigeon Posts publiziert. Sie ist Sprachtrainerin und die lebenslange Begleiterin von anderen Tieren. Mit ihrem Ehemann, John Berokoff, ist sie Mitglied des Palomar Racing Pigeon-Clubs in Kalifornien; er ist für die Wettkämpfe zuständig, vorwiegend mit anderen Männern. Tanya Berokoff greift auf ihr sozialwissenschaftliches Wissen und die amerikanische Populärkultur zurück, wenn sie mithilfe von John Bowlbys psychologischer Bindungstheorie und Tina Turners Lied »What’s Love Got to Do with It?« darüber spricht, wie Taubenliebhaber die Taubeneltern dabei unterstützen, ihre Kleinen aufzuziehen, aber auch Sicherheit und Kompetenz vermitteln, während diese zu ruhigen, zuversichtlichen, verlässlichen, sozialkompetenten, heimsuchenden Renntauben werden.22 Sie beschreibt die Selbstverpflichtung der Tauben-Leute, sich an die Stelle ihrer Tauben zu versetzen, um deren Art und Weise des Wissens und deren soziale Praxis zu verstehen. Die Sprache, die Berokoff dafür verwendet, ist diejenige der Liebe, ein-, aber nicht ausschließlich einer instrumentellen Liebe. Ihre Akteure sind sowohl Tauben als auch Leute, die Inter- und Intraspezies-Beziehungen pflegen. Berokoff beschreibt Details von Gesten und Haltungen der Tauben mit- und zueinander, sie schildert die Zeit, die sie miteinander verbringen, und auch, wie sie diese Zeit füllen. Sie resümiert: »Es sieht so aus, als wären unsere Tauben ziemlich gut darin, eine Liebe nach Art der Agape füreinander zu zeigen […]. Unsere Tauben tun ein wirkliches Liebeswerk.« Im »Liebeswerk« geht es für sie nicht »um eine emotionale Notwendigkeit, sich zu verlieben, sondern darum, aufrichtig von jemandem geliebt zu werden«.23 Dieses Bedürfnis ihrer columbinischen SozialpartnerInnen scheinen die Tauben zu erfüllen, sagt sie, und das ist es auch, was ihre Leute ihnen schulden. Berokoff erläutert detailliert mithilfe von Bowlbys Bindungstheorie, was die jungen Tauben während ihres Aufwachsens brauchen. Ihre PartnerInnen sind sowohl Tauben als auch Menschen, die auf responsable Weise mit ihnen umgehen. In dieser Szene ist aber nicht alles durch und durch rosarot. Die gegenseitigen Schikanen der Tauben, die anstrengende Arbeit des Wettfliegens (für Vögel und Menschen), Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Liebe – und Kochrezepte für Taubengerichte – auch davon berichtet sie in ihren Posts. Ich will nicht darauf hinaus, dass dieser Diskurs oder dieser Sport unschuldig wäre. Vielmehr sehen wir hier eine große relationale Komplexität und eine kraftvolle artenübergreifende SF-Praxis.
PigeonBlog
Rückgewinnung und Unruhigbleiben sind die Leitmotive meiner SF-Praxis. Sie lassen sich nur zu gut anhand menschlicher Brutalität gegenüber Tauben oder auch anhand der von Tauben verursachten Schäden an anderen Spezies oder an von Menschen errichteten Gebäuden thematisieren. Ich möchte mich aber den Belastungen durch städtische Luftverschmutzung zuwenden. Luftverschmutzung wirkt sich unterschiedlich stark auf menschliche (und anders-als-menschliche, aber das wird nicht erhoben) Sterblichkeit und Krankheitsanfälligkeit aus, häufig verteilt sie sich nach Klasse und Ethnizität. Arbeitstauben werden unsere BegleiterInnen bei Projekten zur Umweltgerechtigkeit in Kalifornien sein. Mit diesen Projekten soll versucht werden, verseuchte Nachbarschaften und soziale Verhältnisse zu reparieren. Wir werden im Geflecht einer künstlerischen Aktion von Beatriz da Costa beunruhigt bleiben. Sie hat das Projekt namens PigeonBlog mit ihren StudentInnen Cina Hazegh und Kevin Ponto durchgeführt und dabei SF-Muster mit vielen menschlichen, tierlichen und cyborgartigen Ko-GestalterInnen geknüpft.
Im August 2006 nahmen Brieftauben an drei öffentlichen Experimenten teil, bei denen Stadtmenschen und städtische Wettkampfvögel durch Kommunikationstechnologien intim miteinander verbunden wurden. Die Tauben sind einmal für ein Seminar zu Experimental Critical Theory an der Universität von Kalifornien in Irvine geflogen und zweimal für das Festival Seven Days of Art and Interconnectivity bei der ISEA in San Jose, Kalifornien.24 Das Projekt PigeonBlog erforderte eine umfangreiche Zusammenarbeit zwischen »Brieftauben, KünstlerInnen, IngenieurInnen und Tauben-LiebhaberInnen, die sich in einer wissenschaftlichen Graswurzelinitiative engagierten, um Informationen über die Bedingungen von Luftqualität zu sammeln und zu veröffentlichen«.25 Global gesehen ist Brieftauben das Bündnis mit Leuten aus der Arbeiterklasse nicht fremd, etwa im Zusammenhang mit männlichem Wettkampfsport, in dem tiefe Gefühle zwischen den Arten eine wichtige Rolle spielen. Und ihre nachgewiesenen Fähigkeiten bei der Überwachung von und im Umgang mit Kommunikationstechnologien und -netzwerken sind sehr alt und sehr wichtig. Tauben sind seit vielen Jahrzehnten ArbeiterInnen und Forschungssubjekte der Ornithologie und der Psychologie. Aber vor dem Projekt PigeonBlog sind Wettkampftauben noch nie dazu eingeladen worden, all ihr Erbe einzubringen und sich mit einem Ensemble von KunstaktivistInnen zusammenzutun. Das Projekt hatte zum Ziel, »auf der Suche nach widerständiger Aktion«26 schlaue, billige DIY-Elektronik mit Citizen Science, artenübergreifend koproduzierter Kunst und ebensolchem Wissen zusammenzubringen. Die Daten sollten provozieren, motivieren, verstärken, inspirieren und illustrieren. Sie waren nicht als Ersatz für oder als Verbesserung von professioneller Forschung über Luftverschmutzung gedacht. Die Daten sollten einfallsreiches und wissendes Handeln in unterschiedlichen Bereichen und Praktiken befördern. Da Costa wollte keine Expertin für Luftverschmutzung werden, sondern ein Zusammenwirken bei etwas ganz anderem auslösen: in einer artenübergreifenden Kunstaktion, die sich für alltägliche Welten einsetzt, die Erholung benötigen (und zu ihr fähig sind), quer zu vorhandenen Differenzen.
Die Luftverschmutzung in Kalifornien, speziell im Los Angeles County, ist legendär. Sie beeinträchtigt die Gesundheit von Menschen und anderen Krittern besonders heftig in der Nähe von Autobahnen, Kraftwerken und Raffinerien. Diese wiederum befinden sich häufig in der Nähe von ArbeiterInnenvierteln und solchen, die von People of Color und MigrantInnen bewohnt werden, wobei sich diese Kategorien keineswegs wechselseitig ausschließen. In Südkalifornien sind die offiziellen Apparate zur Überwachung von Luftverschmutzung an Punkten fest installiert, und zwar weit weg von Gegenden mit hohem Verkehrsaufkommen und bekannten Verschmutzungsquellen. Sie sind meist in höheren Regionen aufgebaut als in jenen, in denen viele Leute, Pflanzen und Tiere atmen. Die einzelnen Überwachungsgeräte kosten viele Tausend Dollar und können nur die Gase in ihrer unmittelbaren Nähe messen. Die Werte werden dann nach verschiedenen Modellen für das gesamte Gebiet hochgerechnet. Richtig ausgerüstete Brieftauben können im Flug kontinuierlich und in Echtzeit Daten zur Luftverschmutzung sammeln, und zwar auch in jenen kritischen Höhen, die für die offiziellen Instrumente nicht zugänglich sind, oder nahe am Boden, wo die Tauben zu ihren Heimkehrflügen freigelassen werden. Die Daten können in Echtzeit via Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Frage war: Was ist nötig, um eine Kooperation mit den Vögeln und ihren Leuten herzustellen, und welche Art der Zuwendung und der Responsabilität kann eine solche Zusammenarbeit herbeiführen? Wer würde wen wozu befähigen?
Da Costa erklärte die Ausrüstung: »Der ›Rucksack‹ der Tauben, den wir für das Projekt entwickelt haben, bestand aus einem Kombinations-Element für GPS (Längen- und Breitengrade, Höhe) und GSM (Mobiltelefonkommunikation) und entsprechenden Antennen, einem dualen selbstbeweglichen CO/NOx-Verschmutzungssensor, einem Temperatursensor, einem SIM-Karten-Interface, einem Mikro-Controller und elektronischen Standardkomponenten zur Unterstützung. Weil sie so gebaut waren, haben wir im Grunde ein Mobiltelefon mit einer offenen Plattform für SMS-Dienste entworfen, das jeder, der daran interessiert ist, nachbauen oder umfunktionieren kann.«27 Die Künstler-Forscher-IngenieurInnen brauchten etwa drei Monate, um die Grundtechnologie zu entwickeln. Aber den Rucksack bequem und sicher genug für die Tauben zu machen, dauerte beinahe ein Jahr: Der Aufbau von praktischem und tatkräftigem, artenübergreifendem Vertrauen und Wissen, damit die Verbindung zwischen Vögeln, Technologien und Leuten auch wirklich hergestellt werden konnte, benötigt Zeit. Schließlich wollte niemand, dass eine überladene Brieftaube auf ihrem Rückflug von einem opportunistischen Falken, der nicht Teil des Teams war, aus der Luft gepflückt würde! Niemand, zuletzt die Männer, die die Wettkampftauben züchteten, aufzogen, liebten und mit ihnen arbeiteten, würden ängstliche und unglückliche Vögel, die unter Zwang nach Hause rumpelten, akzeptieren. Die Künstler-ForscherInnen und die Taubenliebhaber mussten sich gegenseitig zu Vertrauen ineinander befähigen, um die Vögel um ihr Selbstvertrauen und ihr Können bitten zu können. Das bedeutete: jede Menge Anproben und Balancetraining im Taubenschlag und jede Menge Lernen lernen mit einem großzügigen und kenntnisreichen Taubenliebhaber, Bob Matsuyama (der auch in einer Mittelschule Naturwissenschaften unterrichtete), und natürlich mit seinen talentierten und gut ausgebildeten FliegerInnen. Tauben sind keine SIM-Karten, sie sind lebendige Ko-ProduzentInnen. Unter Anleitung der Taubenliebhaber mussten die Künstler-ForscherInnen und die Tauben lernen, zusammen zu interagieren und zu trainieren. Alle MitspielerInnen befähigten einander wechselseitig, sie sind gemeinsam in einer spekulativen Fabel zu etwas geworden. Viele Testläufe und Testflüge später konnte das artenübergreifende Team die Luft mit Fadenfiguren elektronischer Spuren durchziehen.28
Es erschienen viele Pressemeldungen als Reaktion auf die Flüge im Jahr 2006 und auf PigeonBlog. Da Costa hat berichtet, dass ein texanischer Ingenieur sie kontaktierte, um gemeinsam einen Forschungsantrag an die Defense Advance Research Projects Agency (DARPA) zu verfassen, in dem es um kleine autonome Luftüberwachungsgeräte gehen sollte, die nach den Flugeigenschaften von Vögeln gestaltet sind. Wäre das nur ein Witz gewesen! Die schon lange andauernde militärische Nutzung anders-als-menschlicher Tiere als Waffen und Spionagesysteme ist im 21. Jahrhundert lediglich extravaganter und technikverliebter geworden.29
Abb. 1.4Das PigeonBlog-Team, bestehend aus menschlichen Wesen, Tauben und elektronischen Geräten. Foto: Deborah Foster für PigeonBlog. © Robert Niediffer für Beatriz da Costa.
Ein anderer Strang der Geschichte handelt davon, dass die PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) PigeonBlog wegen des Missbrauchs von Tieren schließen lassen wollte. Die PETA veröffentlichte ein Statement, in dem sie die Verwaltung der Universität von Kalifornien in Irvine, an der da Costa beschäftigt war, aufforderte, aktiv zu werden. Die Begründung war faszinierend: PigeonBlog hätte kein Recht, nicht-menschliche Tiere zu benutzen, weil das Projekt nicht einmal wissenschaftlich begründete Experimente vornähme. Die PETA wäre eventuell auch gegen solche Experimente, aber etwas weniger, weil damit wenigstens ein Ziel und ein sachlicher Anlass (Krankheiten heilen, das Genom kartieren) vorliegen würden. Kunst wurde als trivial, als »nur ein Spiel« aufgefasst, im Vergleich zur ernsthaften Arbeit an Themen wie Tierrechten oder wissenschaftlichem Fortschritt. Da Costa nahm Fragen zur Kosmopolitik und materiellen Semiotik der Kollaboration mit Tieren in Kunst, Politik und Wissenschaft sehr ernst. Wer befähigt wen zu was und zu welchem Preis, und wer zahlt ihn? Aber sie hat auch gefragt: »Ist menschlich-tierliche Arbeit als Teil einer politischen (und künstlerischen) Aktion weniger legitim als die gleiche Art Aktivität, wenn diese als Wissenschaft gerahmt ist?«30 Vielleicht werden gerade im Spiel, außerhalb der Diktate eines Telos, festgelegter Kategorien und Funktionen, ernsthafte Weltlichkeit und Formen der Rückgewinnung möglich. Jedenfalls ist das die Prämisse von SF.
Lange bevor die PETA auf da Costas künstlerische Forschung aufmerksam wurde, wäre PigeonBlog beinahe zu Ende gewesen, bevor es überhaupt losgegangen war. Der Grund war die Angst der Brieftauben-Männer vor jener Art von Kontroverse und Angriff, mit der Teile der Tierrechtsbewegung (nicht die ganze) auf organisierte, menschlich-tierliche Arbeits- und Spiel-Beziehungen, speziell solche des Wettkampfs, reagieren.31 In einer frühen Phase des Projekts hatte da Costa die American Racing Pigeon Union [die US-amerikanische Vereinigung für Taubenrennen, KH] kontaktiert, um Taubenliebhaber zu treffen und um herauszufinden, ob sie und ihre Tauben mitmachen würden. Die erste Kontaktperson war interessiert, hatte aber, frei heraus, Angst vor den Tierrechtsleuten und ihren Taktiken. Er empfahl Bob Matsuyama, der dann intensiv mit dem Projekt zusammenarbeitete und den künstlerisch Forschenden half, Taubenliebhaber in San José zu treffen – eine Weitergabe von erworbenem Vertrauen. Als PigeonBlog beendet wurde, überreichte die Vereinigung da Costa ein formales Anerkennungszertifikat: für die Arbeit mit den Vögeln und ihren Leuten und dafür, dass sie einer größeren Öffentlichkeit gezeigt hatte, was Brieftauben leisten können und wozu sie fähig sind.
PigeonBlog hat viele Fans, zu ihnen gehören auch Grüne und UmweltaktivistInnen, aber eine Reaktion gab da Costa ganz besonders das Gefühl, dass die kalifornischen Brieftauben gut geflogen waren und etwas Vielversprechendes in die artenübergreifende Welt hineingetragen hatten. Das ornithologische Laboratorium der Cornell Universität bat da Costa in den Beirat für ihr Projekt Urban Bird Gardens, das wiederum Teil ihrer Citizen-Science-Initiative war. In diesem Projekt gehen Daten, die von normalen Leuten, von älteren Menschen genauso wie von Schulkindern gesammelt wurden, in jene Datenbank des Labs ein, die universitäre Forschung mit Neigungen und Fragen von BürgerInnen verknüpft. Das Vorgehen ähnelt der mit Cornell eng verbundenen Citizen-Science-Initiative »Project PigeonWatch«, die regional unterschiedliche Farbgebungen in verschiedenen Populationen meist wild lebender Tauben erhebt. Eines der PigeonWatch-Projekte in Washington, D.C., wirbt SchülerInnen-Gruppen an, die Stadttauben beobachten und verzeichnen. Während dieser Arbeit passieren viele Dinge in Terrapolis. Stadtkinder, großteils aus »Minderheitengruppen«, lernen verachtete Vögel als wertvolle und interessante StadtbewohnerInnen kennen, die es zu beobachten lohnt. Weder die Kinder noch die Tauben gehören zu einer städtischen »Wildnis«; beide Gruppen von Wesen sind bürgerliche Subjekte und Objekte in Intra-Aktion. Dennoch will und kann ich nicht vergessen, dass sowohl die Tauben als auch die farbigen Kids in D.C. das Stigma einer typisch US-amerikanischen Ikonografie tragen: Sie gelten als widerspenstig, schmutzig, deplatziert, wild. Diese konkreten Kids verändern sich jedoch und nehmen die Tauben nicht mehr als »Luftratten« wahr, sondern als gesellige Tiere, die leben und sterben. Die Kinder mutieren von VogeltriezerInnen und manchmal auch VogelquälerInnen zu scharfsinnigen BeobachterInnen und AdvokatInnen jener Wesen, die sie zuvor nicht verstehen oder respektieren konnten. Die Schulkinder wurden responsabel. Weil Tauben eine so lange Geschichte affektiver und kognitiver Beziehungen zu Leuten haben, konnten sie eventuell die Blicke erwidern und wurden zumindest nicht länger getriezt. Ich weiß, dass mein Bericht eine Geschichte ist, eine Einladung ebenso sehr wie eine Würdigung, aber für alle verachteten StadtbewohnerInnen sollte unabhängig von ihrer Art der Raum für Erholung erweitert werden und nicht verengt.32
Vinciane Despret hat einen Text über ein anderes Kunstprojekt verfasst, das Brieftauben und ihre Leute in einer Kollaboration zusammenbringt, die sich der Gefahr des Verlusts ihrer ganzen Gemeinschaft (jener, der TaubenliebhaberInnen) ausgesetzt sieht. Sie fragt, was mit dem von der Künstlerin Matali Crasset gestalteten Taubenschlag in Chaudry, Frankreich, in gemeinsamer Erinnerung bleiben wird.
Aber ohne den Taubenliebhaber, ohne das Wissen, auch das praktische Wissen, von Männern und Vögeln, ohne Selektion und Lehrzeiten, ohne die Weitergabe von Praktiken würden einfach nur Tauben bleiben, keine Brieftauben, keine voyageurs. Hier wird weder allein an das Tier noch die Praxis erinnert, sondern an die Aktivierung von zwei verschiedenen Prozessen des »Mit-Werdens«, die explizit in die Entstehung des Projekts eingeschrieben sind. Anders gesagt, was hier hervorgebracht wird, sind die Beziehungen, durch die Tauben Männer in talentierte Taubenliebhaber verwandeln und durch die die Liebhaber die Tauben in verlässliche Brieftauben verwandeln. Dessen gedenkt dieses Werk. Es gibt sich den Auftrag, die Erinnerung so herzustellen, dass diese Leistung sich aktiv in die Gegenwart verlängert. Das ist eine Art von »Reprise«, eine »Wiederaufnahme«.33
Sich zu erinnern, zu kom-memorieren, bedeutet, etwas aktiv zurückzuholen, wiederzubeleben, wiederaufzunehmen, zurückzugewinnen. In ihrem Einsatz für artenübergreifende SF, für Fadenspiele der Verweltlichung eines Mit-Werdens sind da Costa und Despret Art-Genossinnen. Sie erinnern sich; sie locken und verlängern in eine fleischliche Gegenwart, was ohne die aktive Gegenseitigkeit von PartnerInnen verschwinden würde. Wettkampf- und Brieftauben, aber auch wild lebende Tauben rufen ihre neuen und ihre herkömmlichen Leute zu Responsabilität auf – und umgekehrt. Stadt- und LandbewohnerInnen verschiedener Spezies und mit unterschiedlichen Arten, zu leben und zu sterben, machen sich gegenseitig zu talentierten TaubenliebhaberInnen (colombophiles talentueux) in Gesellschaft verlässlicher Reisender (voyageurs fiables).
Despret und da Costa spielen Fadenspiele mit Matali Crasset und geben dabei Knotenmuster und Möglichkeiten in Terrapolis weiter. Crasset ist Industriedesignerin, ein Beruf, der verlangt, auf eine Weise auf PartnerInnen zu hören und mit ihnen zusammenzuarbeiten, die für bildende Künstler nicht unbedingt notwendig ist, die aber da Costa in ihrer Arbeit und ihrem Spiel als künstlerische Forscherin und artenübergreifende Kunstaktivistin ebenfalls praktizierte. Der von Crasset entworfene Taubenschlag wurde von La Défense, einem Taubenliebhaber-Verein in Beauvois en Cambresis, sowie vom Freizeitpark in Caudry (La Base de Loisirs) in Auftrag gegeben. Der Innenraum der Kapsel ist funktional organisiert wie ein Baum, eine Art Weltachse. Die äußere Form erinnert an altägyptische Taubenschläge. Historische, mythische und stoffliche Welten spielen hier miteinander, in diesem Vogelheim, das auf Initiative jener entstanden ist, die sie züchten, aufziehen, fliegen lassen und mit-ihnen-werden.
Abb. 1.5Capsule, gestaltet von Matali Crasset (2003) für ein Projekt von La fondation de France, Les nouveaux commanditaires. Mediation und Produktion: artconnexion, Lille, France. © André Morin.
Ein weiterer Taubenschlag in Form eines Turms drängt sich in meine Erinnerung; ein weiterer Entwurf für artenübergreifende Rückgewinnung, der sich an Geschöpfe des Imperiums richtet, welche Arten auch immer zugreifen möchten. Diesmal sind wir in Melbourne, Australien, im Batman Park, der sich entlang des Yarra erstreckt; vor der Ankunft der EuropäerInnen gehörte dieses Land den Wurundjeri. Das kolonisierte Gebiet entlang des Yarra wurde zur Brache, zur Müllhalde, zum Gelände für Güter- und Eisenbahntransport. All das zerstörte das Feuchtgebiet (anglowissenschaftlicher Ausdruck) und das Land (country, anglo-aborgine Ausdruck für einen multidimensionalen Ort voller Geschichten).34 Das Feuchtgebiet und das Land sind einander so ähnlich und so verschieden voneinander wie cat’s cradle, jeux de ficelle, na’atl’o’ und matjka-wuma; um unruhig zu bleiben, sind die Namen der Muster in ihrer Komplementarität notwendig, aber sie sind nicht isomorph.35 Sie bevölkern verbundene, getrennte und verwickelte Geschichten.
Der kleine Batman Park ist 1982 entlang eines stillgelegten Betriebshofs für Güterzüge gestaltet worden. Der Taubenschlag wurde 1990 gebaut, um Tauben zu ermuntern, in gewisser Entfernung von städtischen Bauwerken und Straßen zu schlafen. Der Taubenschlag hat die Form eines Turms und gehört zum Plan der Stadtverwaltung für wild lebende Tauben. Es geht hier nicht um die geliebten Brieftauben der Taubenliebhaber, sondern um die »Luftratten«, denen wir schon in den städtischen Parks von Washington, D.C., und in Verbindung mit dem international bekannten Ornithologie-Labor der Cornell Universität begegnet sind. Die Tauben von Melbourne sind mit den EuropäerInnen gekommen und gediehen in Ökosystemen und Welten, die die Feuchtgebiete des Yarra ersetzt haben. Die meisten Aborigines, die sich als ursprüngliche BesitzerInnen zuvor um das Land gekümmert hatten, wurden enteignet. 1985 wurden zwei Organisationen ins Leben gerufen, die Wurundjeri Tribe Land Compensation und das Cultural Heritage Council, auch um mehr Aufmerksamkeit für Kultur und Geschichte der Wurundjeri im heutigen Australien zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob das Cultural Heritage Council irgendeine Rolle bei der teilweisen Rückgewinnung des Landes am Batman Park gespielt hat. Aber ich weiß, dass Orte entlang des Yarra-Flußes für die Wurundjeri bedeutungsvoll waren. 1835 hatte der Geschäftsmann und Forscher John Batman mit einer Gruppe Wurundjeri-Älteren einen Kaufvertrag unterzeichnet; es ist der erste und der einzige dokumentierte Fall, bei dem die Europäer »ihre Anwesenheit und Besetzung von Aborigine-Land direkt mit den angestammten BesitzerInnen verhandelten […]. Für die 600.000 Morgen Melbourne, darin enthalten ist auch das Land, das inzwischen von Vorstädten eingenommen wird, bezahlte John Batman 40 Decken, 42 Äxte, 130 Messer, 62 Scheren, 40 Spiegel, 250 Taschentücher, 18 Hemden, 4 Flanelljacken, 4 Anzüge und 150 Pfund Mehl.«36 Der britische Gouverneur von New South Wales wies dieses dreiste Abkommen als einen Gesetzesbruch mit der Krone zurück. Die belastete Geschichte muss in diesem kleinen Parkstreifen zurückgewonnenen städtischen Territoriums mit seinem markanten Taubenturm irgendwie erinnert und beerbt werden.
Abb. 1.6 Taubenschlag im Batman Park. Foto: Nick Carson, 2008.