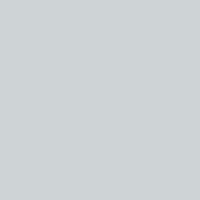16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Was haben die Globalisierungskritiker, die Ökologiebewegung mit ihrer Suche nach alternativen Lebensentwürfen, die Utopie von der Gleichheit der Menschen und die Dialektik der Aufklärung – die Verlustgeschichte des Fortschritts – mit dem berühmten Bürger von Genf zu tun? Er war ein maßgeblicher Stichwortgeber seiner Epoche, der Zivilisationskritiker seiner Tage. Bis heute treibt er uns um: Der Uhrmachersohn in den glänzenden Salons von Paris war vermutlich der Erste, der in kompromissloser Schärfe ein Unbehagen an der Aufklärungskultur artikulierte und sich der Gesellschaft verweigerte; der Erste, der darüber schrieb und damit den Zorn anderer Aufklärer wie Voltaire, Diderot und anderer Enzyklopädisten auf sich zog. Er erkannte, dass der Fortschritt einen enormen Preis hat, sprach von einer »Selbstentfremdung« des modernen Menschen und beklagte die Anmaßungen der Moderne und der Vernunft. Er war Aufklärer über die Aufklärung, der mit seinen Gedanken von der Rückbesinnung auf den »natürlichen Menschen« die Französische Revolution wie kaum ein anderer beeinflusst hat: modernes Demokratieverständnis, Staatstheorien und Verfassungsdebatten, die Berufung auf ein Naturrecht als Grundlage der Staatsgewalt und die Einforderung eines Gesellschaftsvertrages vor dem Hintergrund des französischen Feudalabsolutismus. Unser Rousseau ist das Porträt eines bahnbrechenden Repräsentanten der Spätaufklärung und dabei ein Epochenbild, in dem die europäischen Gesellschaftsverhältnisse, die Debatten seiner Zeit mit unserem heutigen Selbstverständnis in ein erhellendes Verhältnis gesetzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Was haben die Globalisierungskritiker, die Ökologiebewegung mit ihrer Suche nach alternativen Lebensentwürfen, die Utopie von der Gleichheit der Menschen und die Dialektik der Aufklärung – die Verlustgeschichte des Fortschritts – mit dem berühmten Bürger von Genf zu tun? Er war ein maßgeblicher Stichwortgeber seiner Epoche, der Zivilisationskritiker seiner Tage. Bis heute treibt er uns um: Der Uhrmachersohn in den glänzenden Salons von Paris war vermutlich der Erste, der in kompromissloser Schärfe ein Unbehagen an der Aufklärungskultur artikulierte und sich der Gesellschaft verweigerte; der Erste, der darüber schrieb und damit den Zorn anderer Aufklärer wie Voltaire, Diderot und anderer Enzyklopädisten auf sich zog. Er erkannte, dass der Fortschritt einen enormen Preis hat, sprach von einer »Selbstentfremdung« des modernen Menschen und beklagte die Anmaßungen der Moderne und der Vernunft. Er war Aufklärer über die Aufklärung, der mit seinen Gedanken von der Rückbesinnung auf den »natürlichen Menschen« die Französische Revolution wie kaum ein anderer beeinflusst hat: modernes Demokratieverständnis, Staatstheorien und Verfassungsdebatten, die Berufung auf ein Naturrecht als Grundlage der Staatsgewalt und die Einforderung eines Gesellschaftsvertrages vor dem Hintergrund des französischen Feudalabsolutismus. Unser Rousseau ist das Porträt eines bahnbrechenden Repräsentanten der Spätaufklärung und dabei ein Epochenbild, in dem die europäischen Gesellschaftsverhältnisse, die Debatten seiner Zeit mit unserem heutigen Selbstverständnis in ein erhellendes Verhältnis gesetzt werden.
Über Sabine Appel
Sabine Appel (1967 bei Gießen geboren), studierte Germanistik und Philosophie in Heidelberg, Mannheim, Paris und Cambridge. Sie verfasste zahlreiche geistesgeschichtliche Biographien, u.a. über Caroline Schlegel-Schelling, Madame de Stael, Katharina von Medici, Elisabeth I, Heinrich VIII, Schopenhauer, Goethe und Nietzsche (erschienen vornehmlich bei C.H. Beck und Klett-Cotta).
Unser Rousseau
Sabine Appel
Wie ein Genfer Uhrmachersohn die Aufklärung überwand und sie damit vollendete
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Unser Rousseau
Träumereien eines einsamen Spaziergängers
Vom Paradies und von den vielen Vertreibungen
Jean-Jacques Rousseau, Bürger von Genf
»Natur« gegen »Fortschritt«
Über die Ungleichheit
Natürliche Religion
Der Gesellschaftsvertrag
Dialektik der Aufklärung
Rousseau in Deutschland
Anhang
Zeittafel
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Die Andere Bibliothek
Impressum
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Cover
Informationen zum Buch
Unser Rousseau
Träumereien eines einsamen Spaziergängers
Vom Paradies und von den vielen Vertreibungen
Jean-Jacques Rousseau, Bürger von Genf
»Natur« gegen »Fortschritt«
Über die Ungleichheit
Natürliche Religion
Der Gesellschaftsvertrag
Dialektik der Aufklärung
Rousseau in Deutschland
Anhang
Zeittafel
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Die Andere Bibliothek
Impressum
Unser Rousseau
Wie ein Genfer Uhrmachersohn die Aufklärung überwand und sie damit vollendete
Was haben die Globalisierungskritiker und die Klimaaktivisten unserer Tage, die Ökologiebewegung des letzten Jahrhunderts, die große Utopie von der Gleichheit der Menschen in den Gesellschaften, die Dialektik der Aufklärung und die Suche nach alternativen Lebensmodellen mit Jean-Jacques Rousseau zu tun?
Viel, und die Entwicklung Europas wäre ohne diesen exzentrischen Denker ganz sicher eine andere gewesen, legte Rousseau doch den Finger in die Wunden der ins Große und Weite fortschreitenden, ihrer selbst gewissen und von daher immer auch von Hybris getragenen europäischen Zivilisation – und das eigentlich bis auf den heutigen Tag. Damit ist Rousseau so etwas wie eine permanente Korrektur unserer selbst, ein Alter Ego, eine Gewissensinstanz, eine Kontrolle von innen, selbstreferentiell, wenn man so will, und so ambivalent wie der Exzentriker selbst.
Er war der Erste, der ein Unbehagen an der Kultur konstatierte, der Erste, der feststellte, dass jeder Fortschritt seinen Preis hat, Opfer fordert und in gewissem Sinne auch Rückschritt bedeutet, derjenige, der die Selbstentfremdung des natürlichen Menschen beklagte und die Anmaßungen, mit denen die Zivilisation der Moderne einhergeht, derjenige, der mit seiner Kritik an der hypostasierten Vernunft die zweite »heilige Kuh« der Aufklärung schlachtete, der, der die Aufklärung überwand und sie damit vollendete.
Gegen seinen großen Kontrahenten Voltaire, der so viel glänzender und erfolgreicher in den Salons von Paris agierte und dabei sein Publikum fand, nimmt er sich blässlich aus, der ungelenke und schüchterne Genfer Uhrmachersohn, der seine Uhr wegwarf und damit eine eigene kleine Revolution initiierte. Er floh die Salons und die großen Gesellschaften, und er hauste mit seiner Lebensgefährtin in einem Gartenhaus im Park von Montmorency. Den Jahrmarkt der Eitelkeiten in dieser großen Welt wollte er – auch nachdem er berühmt geworden war – nicht bedienen, und stattdessen forderte er zur Rückkehr zur Einfachheit auf, was radikaler war, als es zunächst anmuten mag. Und doch hat er mehr bewegt als die meisten seiner splendideren Zeitgenossen in den Salons des Ancien Régime.
Ohne Rousseau und seine Besinnung auf den natürlichen Menschen ist die Französische Revolution gar nicht vorstellbar, obwohl er der Letzte war, der sie gewollt hätte – und er erlebte sie auch nicht mehr.
Rousseau hat das gelingende Staatswesen, das er in seinem »Gesellschaftsvertrag« skizzierte, nach dem Vorbild seiner Heimatstadt Genf, mit der Mechanik eines Uhrwerks verglichen. Den Philosophen der Aufklärung diente das Uhrwerk zugleich als Modell für den Menschen, und Voltaire schließlich sprach vom »göttlichen Uhrmacher« anstelle von Gott.
Bedeutsam für unser heutiges Selbstverständnis der Rousseau-Rezeption sind auch die Utopien, die Rousseau initiierte, ohne doch ahnen zu können, was die Nachwelt aus ihnen machen würde. So manche erwies sich historisch eventuell als Schimäre, so mancher Weg, der im Guten gedacht war, endete mit einigen Umwegen über Sinnsuche und Selbstfindung, Klagen über Verluste der Unschuld und das energische Trachten nach Gleichheit in der inneren Emigration im Nicht-Ort in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes U-topia, in der Weltlosigkeit, in der Entfremdung oder im Extremismus.
Warum schließlich und endlich stießen Rousseaus Werke und seine irdischen Paradiese gerade in Deutschland auf solche Begeisterung? Wenn man die Naturliebe und das Wandern, die Seelenlandschaften, den Kult des Gefühls, die Selbsterforschung, die Weltfrömmigkeit und die Gewissensethik auf ein tieferliegendes Prinzip zurückführen will, führt der Weg über die Innerlichkeit, aber nicht so, wie sie den Deutschen in einer Lesart, die sich energisch festgesetzt hat, attestiert wurde. Von denen, die sie erfanden – Klopstock und Hegel, wahrscheinlich inspiriert von Rousseau –, war sie nie weltlos gemeint, nie als Abspaltung, Ausblendung oder Wirklichkeitsflucht, sondern sie war ein Ausdruck von Besonnenheit und von geistiger Wachheit, die in keinerlei Gegensatz zur äußeren Wirklichkeit stand, sondern sie, gewissenhaft prüfend, stets integrierte.
So oder so steht Rousseau für die Selbsthinterfragung der westlichen Welt. Alles beginnt bei Rousseau. Eine selbstkritische Betrachtung Europas wäre in diesem Sinne Anfang und Ende einer Betrachtung dieser illustren Figur.
Träumereien eines einsamen Spaziergängers
Die Petersinsel im Bieler See im bernischen Drei-Seen-Land in der Schweiz ist eines von Rousseaus künstlichen Paradiesen. Er kultivierte sie, und er machte sie für die Nachwelt unsterblich; aber künstlich sind sie deshalb, weil zivilisatorisch kein Weg zurückführt. Das Paradies ist unwiederbringlich verloren. Das ist die Ausgangsthese seines wirkungsmächtigen Werkes – einer Verlustgeschichte, die ihresgleichen sucht in der Kulturgeschichte Europas.
Rousseau widmet dem Idyll dieser Insel in seinem letzten, postum erschienenen Werk »Träumereien eines einsamen Spaziergängers« ein ganzes Kapitel, und dieses steht weder am Anfang der Textsammlung noch am Ende – obgleich es ein Höhepunkt ist –, sondern genau in der Mitte. Der erzählende Autor, der in der Ich-Form schreibt, bezeichnet die zwei Monate, die er dort auf der Insel verbrachte (es waren sechs Wochen, um ganz genau zu sein), als die glücklichste Zeit seines Lebens. Er hätte, so schreibt er, ohne weiteres auch zwei Jahre, zwei Jahrhunderte oder eine ganze Ewigkeit dort verbringen können, ohne sich auch nur einen Augenblick zu langweilen. Der Augenblick wird hier zur Ewigkeit, die reine Gegenwart, die beschrieben wird im Zauber des vollkommenen Einklangs mit der Natur, wird zum »nunc stans«, zum stehenden Jetzt. Die Zeit scheint aufgehoben und das Ich mit der Welt versöhnt. Einen größeren Ausdruck von Harmonie kann es zum Lebensausklang nicht geben. Die Dissonanzen sind aufgelöst, das Ich ist heimgekehrt zu sich selbst. Da es eigentlich in der Entfremdung lebt, wie die Menschen aller Zeiten an allen Orten, mehr oder weniger, ist diese beschworene Harmonie eine Apotheose des authentisch gewordenen Ich, das sich sämtlicher Elemente gelebter Entfremdung durch verderbliche Einflüsse völlig entledigt hat. Das Ich jenseits der korrupten Gesellschaft, die es ja zugleich selbst ist, denn was sollte »die Gesellschaft« anderes sein als wir alle? Das Paradoxon, das daraus entsteht, kann offensichtlich nur in der Meditation aufgelöst werden, und das, aneinandergereihte Meditationen, sind diese Träumereien eines einsamen Spaziergängers, der dabei ist, sein Ich freizulegen von der Entfremdung, um eine letzte und gültige Heimkehr möglich zu machen, wie er sie sah.
Da der Aufenthalt eine Zuflucht war, hat es mit dem Inselidyll, topographisch gesehen, eine äußerst spezielle Bewandtnis. Um die schöne Insel herum ist gewissermaßen feindliches Land, und der glückliche Inselbewohner hegt überhaupt nicht die Absicht, von dieser schönen Insel jemals wieder zu weichen. Er hätte es damals vorgezogen, so seine Schilderungen im Rückblick, dass man ihm dieses Refugium als Gefängnis auf Lebenszeit bestimmt und zugleich jede Möglichkeit genommen hätte, sie jemals wieder verlassen zu können, indem ihm sogar jeglicher Kontakt mit dem Festland untersagt worden wäre. Was in der Welt geschah, wäre nicht mehr zu seiner Kenntnis gelangt, und nach einer Weile hätte er sie ebenso vergessen wie sie ihn. So beschreibt er es.
Weltflucht und kontemplative Betrachtung. Das Erdentreiben aus der Distanz, aber wie durch ein Vergrößerungsglas prismenartig gebrochen. Hier bewegt sich der Autor in einer langen Tradition, als er sich anschickt, seine »Träumereien« der Nachwelt zu übergeben, als letztes Vermächtnis vielleicht, in einer Schrift über die letzten Dinge. Der Römer Seneca schrieb über die Seelenruhe als Zeitgenosse und ehemaliger Erzieher des berüchtigten Kaisers Nero, auf dessen Befehl hin er schließlich seinem Leben ein Ende setzte. Petrarca, der Früh-Humanist, beschwor die produktive Einsamkeit in Verbindung mit einem intensiven Naturerleben, woraus er zugleich eine neue Rolle des Menschen entwarf, die Maßstäbe setzte. Montaigne floh vor der Pest und vor den Wirren der Religionskriege im Zeitalter der Katharina von Medici in seinen berühmten Turm, um Betrachtungen über die Unbeständigkeit des menschlichen Daseins anzustellen und damit aber zugleich jeden objektiven Wahrheitsanspruch zu relativieren. »La vida es sueño«, »Das Leben ein Traum«, würde ein spanischer Dichter einer ganz anderen Zeit, Calderón, diesen träumerischen Ich-Zustand einmal ins Wort fassen, in dem der Mensch auf nur halbbewusste Art zu Erkenntnissen über Welt und Leben gelangt. Auch Rousseau, der frühere Zeitgenosse, folgt dieser Spur.
Der Hintergrund für das sechswöchige Inseldasein auf der Petersinsel im Bieler See, das der Autor in der Erinnerung beschreibt, ist eine von vielen dramatischen Fluchtepisoden, zu denen Rousseau gezwungen war, um den Zensurbehörden und ihren Verfolgungen zu entkommen. Sowohl das katholische Frankreich als auch die Heimat des Autors, die calvinistische Schweiz, sahen in seinen Schriften eine Bedrohung der bestehenden Ordnung, die unterbunden werden musste, sodass ihm wiederholt nur die Flucht blieb. Es war die Zeit seiner berühmtesten Werke, die alle in schneller Folge und zum Teil parallel in den zurückliegenden Jahren entstanden waren. Anfang 1761 erschien der Briefroman »Julie oder: Die Neue Héloise«, im Folgejahr der Erziehungsroman »Émile« sowie die staatstheoretische Schrift »Der Gesellschaftsvertrag«. Mit Letzterem wird Rousseau bis heute identifiziert, aber der Liebes- und der Erziehungsroman bargen nicht weniger Zündstoff, und sie wurden auch nicht weniger zum Gegenstand von Zensur und Verfolgung. Von den diversen Revolutionen, die Rousseau auslöste, war der Sturm auf die Bastille elf Jahre nach seinem Tod wahrscheinlich die, die am wenigsten in seinem Sinne war und die er auch kaum gewollt hätte. Seine Umwälzungen reichten aber viel tiefer, und das zeigen auch die vermeintlich unpolitischen träumerischen Meditationen, in denen sich das Ich von der Welt emanzipiert.
»Julie oder: Die Neue Héloise« ist die unmögliche und tragische Liebesgeschichte der adeligen Julie d’Étange und ihres bürgerlichen Hauslehrers Saint-Preux. Der Roman hat die Herzen bewegt und unzählige literarische Nachahmungen ausgelöst. Goethes »Werther« war eine von ihnen, die aber weniger Standesdebatten und korrupte Gesellschaftsverhältnisse in den Mittelpunkt rückt als vielmehr die problematische Unbedingtheit des Individuums und seine am Ende fatalen psychologischen Grenzgängereien bis hin zum Selbstmord aus Liebe, denen das weibliche Gegenüber eine ordnungsstiftende Kraft gegenüberstellt, was diese Unbedingtheit des Protagonisten gleichsam delegitimiert. Doch wie auch immer: Das Thema – Individuum versus Gesellschaft – es bleibt, und es bleibt skandalös hier wie dort. Die Liebe der beiden Romanfiguren Julie und Saint-Preux bei Rousseau, die nicht zusammenkommen, weil Julie einen Adeligen heiraten und damit auch den Wünschen ihres Vaters entsprechen muss, steht für die Reinheit und Unverbrüchlichkeit eines Naturgesetzes, das seine Berechtigung einfordert gegenüber den Vorurteilen, falschen Werten und unnatürlichen Standesregeln der feudalen Gesellschaft. So ist die Tragik der Liebenden, die mit Julies Tod endet, die Anklage eines von Grund auf falschen Systems. In einer Welt, die den natürlichen Anlagen des Menschen Rechnung trüge, wäre alles ganz anders, und nicht nur würden sich diese Liebenden finden und glücklich werden, sondern das Leben der Menschen insgesamt würde sich anders gestalten. Es wäre von sozialer Gleichheit geprägt und von einer gerechten Verteilung der Güter und Aufgaben. Es gäbe keinen Überfluss und keinen Mangel, keine Besitzstreitigkeiten und keinen Neid, keinen Müßiggang auf der einen Seite und auf der anderen die erbärmliche Plackerei der untersten Volksschichten. Keine Herrscherwillkür hätte hier Raum und keine Unterdrückung des Volkes, aber auch keine Eitelkeiten, kein Sittenverfall, keine Künstlichkeiten und keine Verstellung, wie sie das Hofleben in Paris hervorbrachte – Rousseaus Anti-Welt, immerzu. Die ideale Welt, die Julie nach ihrer Heirat mit dem Baron von Wolmar auf ihrem idyllischen Schweizer Landgut errichtet, entspricht einigermaßen den Vorstellungen des Autors von einer intakten Sozialgemeinschaft, wie er sie gerne auch auf die ideale Republik übertragen sehen wollte, das Gemeinwesen auf der Basis eines Gesellschaftsvertrags. Aber das sind Kleinbürgeridyllen, die hier beschworen werden. Auf moderne Flächenstaaten übertragen, taugen die Vorstellungen letztendlich kaum.
»Émile«, der Erziehungsroman. Da geht es um einen Jungen, der so natürlich wie möglich erzogen werden soll, was bedeutet, dass seine Entwicklung nur behutsam gefördert, aber niemals in ihrem natürlichen Wachstum behindert wird. Auch diese Forderung richtet sich vornehmlich gegen den Status quo, gegen die aktuelle Gesellschaft mit ihren herkömmlichen Erziehungsmethoden in der Epoche des Autors, die in den Kindern eigentlich nur kleine Erwachsene sah, denen sie ihre in den Augen Rousseaus falschen Wertmaßstäbe und die Anpassung an ein falsches Kultursystem beibrachte. In einer natürlichen Umgebung – und das ist immer auf dem Land, nicht in den Städten mit ihren Versuchungen und naturfernen Lebensformen, aber auch ausdrücklich nicht in der Studierstube – lernt das Kind ganz von selbst durch Betrachtung und Anschauung seiner Umwelt und bildet allmählich die Fähigkeit aus, Schlussfolgerungen zu ziehen, die ihm seine Beobachtung eingibt. Von trockenem Bücherwissen bleibt es lange verschont, und auch die Grundanschauungen der Religion erfasst das Kind auf demselben Weg der Anschauung wie andere natürliche Gesetzmäßigkeiten, denn nach Rousseaus Auffassung ist die Religion von Geburt an in die Herzen der Menschen eingepflanzt. Sie braucht keine Dogmen, und die mit den religiösen Unterweisungen vielfach verbundenen Abstraktionen sind, wie er meint, nur allzu oft dazu angetan, die Vorstellungswelt der natürlichen Religion zu zerstören. Die ersten Jahre des Zöglings Émile sind nur auf die körperliche Entwicklung gerichtet, mit viel Bewegung in frischer Luft, einfach und gut ernährt. Dann erhält er allmählich ein wenig Unterricht, der die natürliche Anschauung ergänzen soll, aber sie nicht ersetzt. Niemals wird er zum mechanischen Lernen von Stoffen und Gegenständen gezwungen, zu denen er überhaupt keine Beziehung hat – etwa das Aneinanderreihen historischer Daten und Fakten, Moralunterweisungen aus der Erwachsenenwelt oder auch tote Sprachen. Das wissenschaftliche Studium der Mathematik oder Geographie – nie vor dem fünfzehnten Lebensjahr – wird später durch das Erlernen eines Handwerks ergänzt, was den privilegiert geborenen Zögling unter anderem tauglich machen soll für das Leben in einer freien und gleichen Gesellschaft, in der jeder sich seinen Lebensunterhalt auf ehrbare Weise selbst verdient. Eines der wenigen Bücher, die Émiles Erziehungsweg begleiten, ist bezeichnenderweise »Robinson Crusoe« von Daniel Defoe. Somit läuft diese Anti-Erziehung im Wesentlichen darauf hinaus, den Zögling gegen schädliche Einflüsse abzuschirmen, die nach Meinung des Autors immer nur von degenerierten Verhältnissen herrühren. Von Natur aus ist der Mensch gut. Wie eine Pflanze in guter Umgebung mit ausreichend Nahrung, guter, nährender Erde und Licht entwickelt er sich auf die wünschenswerteste Weise, sofern man ihn denn nur lässt. Verdorben wird er lediglich durch falsche Gesellschaftsverhältnisse. »Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut«, heißt es im »Émile«, aber »alles entartet unter den Händen der Menschen.« Diese fundamental kultur- und zivilisationskritische Aussage empfand die Obrigkeit als ungeheure Provokation und als mindestens so herausfordernd wie die konkreten politischen Forderungen Rousseaus in seinen politiktheoretischen Werken, sodass auch verständlich wird, warum dieser Erziehungsroman, im selben Jahr erschienen wie der »Gesellschaftsvertrag«, dem Autor umgehend die größten Schwierigkeiten bereitete.
Der »Contrat Social« wurde unmittelbar nach seinem Erscheinen im April 1762 in Frankreich verboten, ebenso »Émile«, der Ende Mai erschien: Anfang Juni wurde das Buch von der Sorbonne verurteilt und wenige Tage danach vom Parlement de Paris verboten, worauf Haftbefehl gegen den Autor erlassen wurde. Auch die Genfer Behörden verboten das Buch und erließen im Juli ebenfalls Haftbefehl gegen Rousseau. In Genf und in Paris wurden Exemplare des »Émile« öffentlich verbrannt, in Genf sogar Exemplare des »Contrat Social«. Rousseau hat die Genfer Republik wiederholt in seinen Schriften als historisches Beispiel für eine fortschrittliche und zukunftsgerichtete Regierung hervorgehoben, und er fügte seinem Autorennamen den stolzen Zusatz hinzu: »Citoyen de Genève«, »Bürger von Genf«. Die De-facto-Ausbürgerung durch die Genfer Behörden vollzog er im Folgejahr selbst, als er Zuflucht auf dem Territorium des Königs von Preußen gefunden hatte und im Zuge dessen auf sein Bürgerrecht der Republik Genf verzichtete, weil er zu seinem Schutz ein anderes Bürgerrecht annehmen musste. Nach einer Zwischenstation in Yverdon im schweizerischen Jura bei seinem Freund Daniel Roguin flüchtete er ins Neuenburgische, in die damalige preußische Enklave Neuchâtel in der Schweiz. Mit einem förmlichen Asylantrag hatte sich Rousseau direkt an Friedrich den Großen gewandt, und dieses Asyl wurde ihm durch den örtlichen Gouverneur, den gebürtigen Schotten Lord Keith, auch gewährt. Jahrelang lebte er dann »undercover« als preußischer Staatsbürger in dem Jura-Bergdorf Môtiers in dem zu Preußen gehörigen Fürstentum Neuenburg. Die Episode dokumentiert zugleich ein eigenartiges Kapitel in der europäischen Ereignis- und Geistesgeschichte: Preußen oder genauer die Persönlichkeit Friedrichs II. gewährte den aufmüpfigen Geistern der »Grande Nation« – die den Fehler begangen hatte, sich eine Denkerszene von großer Sprengkraft heranzuzüchten beziehungsweise sie gewähren zu lassen – auf seinem Territorium Zuflucht und beförderte damit den Kampf für Denkfreiheit und Toleranz, den das absolutistische Frankreich aus vitalem Interesse einschränken musste. Voltaire, Rousseaus Zeitgenosse und Kontrahent, hatte sogar gut zehn Jahre zuvor im Lustschloss des Preußenkönigs, in Sanssouci bei Potsdam, einen auf Dauer angelegten Wohnsitz bezogen, sich aber dann doch infolge diverser Querelen und Affären wieder davongemacht. Aufgrund seines enormen Vermögens, das zum Teil auf frühen Bucherfolgen, aber unter anderem auch auf windigen Spekulationsgeschäften aufgebaut war, hatte Voltaire grundsätzlich einen besseren Stand und weitergehende Möglichkeiten als der mittellose Rousseau, der immer auf einzelne Gönner und Gönnerinnen sowie Unterstützer angewiesen war, wenn er sich wieder einmal auf der Flucht befand oder nicht weiterwusste, während er zugleich diese Abhängigkeiten als zutiefst demütigend und kränkend empfand. Seine empfindsame und reizbare Natur hatte durch die Erschütterungen und Anfechtungen der vergangenen Jahre längst einigen Schaden genommen. Er versteckte seine Verwundungen hinter einer kauzigen Oberfläche, die er schon zu dieser Zeit zu kultivieren begann. So kleidete er sich in Môtiers als Armenier mit einer seltsamen Tracht und einer Pelzmütze anstelle der noch immer obligatorischen Puderperücke, mit der er sich sogar abbilden ließ, sodass wir ein entsprechendes Porträt von ihm mit dieser Armeniermütze besitzen. Die Bergbevölkerung hat den sonderbaren Bewohner, über dessen gefährliche Umtriebe und gottlose Schriften sie auch der ihm anfänglich wohlgesonnene Dorfpfarrer Montmollin ins Bild gesetzt hat, mit der Zeit argwöhnisch beäugt und irgendwann auch mit offenkundiger Ablehnung bedacht. Die Leute warfen eines Tages auf offener Straße Steine nach ihm, worauf er auch diesen Zufluchtsort jäh verlassen musste. Das war am 6. September 1765. Jean-Jacques Rousseau war 53 Jahre alt. Und hier beginnt das Idyll auf der Petersinsel im Bieler See.
Seine Lebensgefährtin Thérèse Lavasseur hat ihn in alle seine Exile begleitet. Nach den Haftbefehlen von Genf und Paris und seiner überstürzten Abreise in die Schweiz hatte er es ihr zwar erneut freigestellt, nachzukommen in all die Ungewissheiten, die ihn erwarteten, doch für Thérèse scheint das nie eine Frage gewesen zu sein. Er hatte sie im Frühjahr 1745 in einem Pariser Gasthof kennengelernt, wo sie unter anderem für die Wäsche zuständig war, weshalb man allgemein von der »Wäscherin Thérèse Lavasseur« sprach, wenn es um Rousseaus Lebensgefährtin ging, die er erst nach 24 Jahren des freien Zusammenlebens heiraten würde. Weder die Zeitgenossen noch die Biographen hatten großes Verständnis für diese Partnerinnenwahl des Denkers Rousseau im Blick auf diese Frau, über deren niedrigen Bildungsstand man sich mokierte – nicht zuletzt seine adeligen Gönnerinnen und die gebildeten Frauen der Pariser Gesellschaft. Deutlich unverständlicher als diese Wahl, für die Rousseau seine Gründe gehabt haben wird, bleibt indessen die Tatsache, dass er die fünf Kinder, die er mit Thérèse bekam, alle ins Findelhaus gab. Diesen dunklen Flecken in seiner Biographie wird der Verfasser des Erziehungsromans »Émile« mit all seinen idealen Ansätzen einer zwanglosen, natürlichen und vor allen Dingen liebevollen Erziehung wohl nicht mehr los. Er hat sich mehrfach veranlasst gesehen, sich dafür zu rechtfertigen, sowohl im autobiographischen Werk – und so auch hier, in den »Träumereien« – als auch gegenüber den Zeitgenossen, aber er muss gespürt haben, dass diese Rechtfertigungsversuche auf fruchtlosen Boden fielen. Es ist im Übrigen nirgends verzeichnet, was die Mutter der Kinder dabei empfand.
Irgendwann in diesen Tagen, als auch das Bergdorf im Jura als Aufenthaltsort unmöglich geworden war, erinnerte sich Rousseau an die Petersinsel im Bieler See, die er offenbar schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt aufgesucht hatte. Auf dieser Insel befand sich nur ein einziges Haus, und darin lebte ein Steuereinnehmer samt Familie und Gesinde – »brave Leute«, so schreibt Rousseau, und dieser Umgang war ihm nun gerade recht. Die Insel gehörte zum Gebiet der Berner Regierung, die ebenso wie die Genfer Stadtoberen seine Schriften verboten und den Verfasser zur unerwünschten Person erklärt hatte. Er hegte dennoch die vage Hoffnung, dass man ihn auf dieser Insel in Ruhe ließe und ihm somit ein auf die restliche Lebenszeit angelegtes Dauerexil gewährte, ohne ihn weiterhin zu bedrängen. Er konnte sie schließlich, erklärte er, nicht unbemerkt oder ohne fremde Hilfe verlassen, und ebenso wenig konnte er missliebigen Briefverkehr oder andere Verbindungen zur Außenwelt pflegen, es sei denn, der brave Steuereintreiber würde sich unwahrscheinlicherweise als Mittler betätigen, was der Obrigkeit doch eventuell hinreichen mochte, um ihn da einfach sein Dasein fristen zu lassen, samt seiner Träumereien. Das kann er eigentlich nicht ernsthaft geglaubt haben, zumal auch die »Träumereien« eines rebellischen Denkers nur so unpolitisch waren, wie sie es vorgaben zu sein. Dem Pfarrer von Môtiers, Montmollin, hatte er noch im Frühjahr versichert, er werde, solange er lebe, kein Werk mehr über religiöse Themen schreiben. Es waren schließlich seine Auffassungen zur natürlichen Religion, wie er sie in einem Teilabschnitt seines »Émile« zum Ausdruck gebracht hatte, die »Bekenntnisse eines savoyardischen Vikars«, die die Regierungen hier wie dort besonders aufbrachten, deutlich mehr zunächst als die Thesen und Forderungen seines »Gesellschaftsvertrags«. Der Erzbischof von Paris, Christophe de Beaumont, hatte in einem Schreiben geäußert, das Werk sei gotteslästerlich und geeignet, die Grundlagen der christlichen Religion zu zerstören. Weder in Genf noch in Bern, also konfessionsübergreifend, sah man das grundsätzlich anders. Das Gefühl aber, das sich in dieser Zeit zunehmend des bedrängten Denkers bemächtigte und das sich dann auch im Rückblick in den »Träumereien eines einsamen Spaziergängers« durchgehend niederschlägt, es sei eine große Verschwörung gegen ihn im Gange, mit dem Ziel, ihn endgültig zu vernichten, bezog sich nicht auf die Regierungen, Parlamente, Erzbischöfe und Stadtoberen, die ihn verfolgten – denn das waren (ja) nur äußere Bedrängnisse, bei allen Unbilden –, sondern auf die Intellektuellenzirkel von Paris, also seine früheren Freunde und Mitstreiter. Diese Überzeugung – nach allem, was man sagen kann, etwa zur Hälfte anlassbezogen, aber mindestens zur Hälfte psychologischen Ursprungs – dominierte ungefähr das letzte Lebensdrittel des Autors, und sie bildet auch ein durchgängiges Motiv in diesen träumerischen Betrachtungen, den Meditationen des Spaziergängers in freier Natur, der sich hier wiederfindet und wiederbegegnet, der sich von aller Bedrängnis befreit. Freiwillig ist er nicht in diese Einsamkeit hinabgestiegen, so bekundet er gleich zu Anfang der Textsammlung. Man hat ihn zurückgestoßen, ihn, den vertrauensseligsten aller Menschen, ihm Übles angetan und ihn in seiner Natur gänzlich verkannt. Da dies aber nun einmal nach seinem Empfinden so ist, hält er sich als Individuum schadlos und profitiert maximal von dieser Einsamkeit, und wer in der Natur lebt, so klingt es durch, völlig im Einklang mit ihr, kann ohnehin niemals einsam sein. Das betrachtende Ich kehrt zurück in den glücklichen Urzustand der durch die Gesellschaft verbildeten Menschheit und hat nun die einzigartige Chance, ein Glück zu erleben, das sonst niemand kennt.
Rousseaus Naturbetrachtungen haben Literaturgeschichte geschrieben. Besonders die deutsche Dichtung ist ohne sie gar nicht denkbar, denn hier hatte der Autor seine enthusiastischsten Jünger und Nachahmer, von den Dichtern des Göttinger Hains über die Empfindsamkeit bis zur Romantik. Aber seine Ideallandschaft ist nicht lieblich-arkadisch, also am antiken Ideal der Mittelmeerlandschaften orientiert. Sie nimmt ihre Inspiration aus den Landschaften seiner Schweizer Heimat und prägt damit auch eine neue Landschaftsästhetik, in der der Begriff des Erhabenen dominiert. Er brauche Sturzbäche, Felsen, Tannen und schwarze Wälder, schreibt er in seinen »Bekenntnissen«, Gebirge, mühsam zu ersteigende Wege und Abgründe neben sich, die ihm Furcht einjagen. Eine Flachlandschaft kann ihn gar nicht begeistern. Aber immer ist da auch die Urlandschaft seiner Kindheit und Jugend am Genfer See. Die Île de St. Pierre erinnerte ihn offensichtlich daran, heißt es doch: »Die Ufer des Bieler Sees wirken urwüchsiger und romantischer als die des Genfer Sees, denn Felsen und Wälder reichen näher ans Wasser; aber sie sind nicht minder einladend. Wenn es hier weniger Äcker und Weinberge gibt, weniger Städte und Häuser, so gibt es mehr natürliches Grün, mehr Wiesen, mehr schattige Haine, die Zuflucht gewähren; die Landschaft wechselt rascher, und die Höhenunterschiede liegen näher beieinander. Da an jenen glücklichen Gestaden fuhrwerktaugliche Straßen fehlen, kommen wenig Reisende in die Gegend. Das macht sie um so attraktiver für den einsamen Denker, der sich nach Herzenslust an den Reizen der Natur ergötzen und sich in ihrer Stille sammeln will.« Und er fügt hinzu: »Auf diese Insel bin ich nach der Steinigung von Môtiers geflohen.« Der Sache mit den Steine werfenden Bergdorfbewohnern wurde sogar juristisch nachgegangen, aber ohne nennenswertes Ergebnis im Blick auf die Frage, ob es sich wirklich um eine lebensbedrohliche Situation handelte, da man förmlich als Dorfgemeinschaft das Haus Rousseaus mit dicken Gesteinsbrocken bombardierte, oder lediglich um »ein paar Kieselsteine« ungezogener Buben. Das ist aber nicht ausschlaggebend für das Innenleben des Protagonisten. Der Rückzug in die stille Natur ist ein Refugium vor dem Unverständnis, dem Hass und den Zudringlichkeiten der Menschen, und all das hatte zu dieser Zeit bei Rousseau längst eine abstrakte Größe erreicht.
Wie so oft war er allein vorausgereist, und Thérèse kam später erst mit dem Hausrat nach. Das bedeutete, dass er zunächst einmal äußerst provisorisch eingerichtet war, und dieses Provisorium kostete er weidlich aus. Ein Provisorium, das man sich gleichzeitig zum immerwährenden Aufenthalt wünscht – diese Doppeldeutigkeit, die hier auch rhetorisch beschworen wird, ist nicht zuletzt auch mit der Verantwortungslosigkeit verbunden, die der Zustand gewährt. Das Individuum muss nichts tun, nichts entscheiden, es kann sich treiben lassen, die Dinge abwarten. Das scheint ein ausgesprochen wohltuender Zustand zu sein in der Epoche der Autonomie des Subjekts. Dass er die Bücher nicht auspackte, als sie dann endlich in der Kiste mitsamt seinen restlichen Habseligkeiten eingetroffen waren, zusammen mit seiner »Haushälterin« (er meinte Thérèse), beschreibt Rousseau als ein besonderes Glück. Keine Bücher und kein Schreibzeug zu haben, manifestierte den Zustand völliger Freiheit und des natürlichen Einklangs, was außerordentlich bemerkenswert ist. Statt mit »traurigem Papierkram und alten Schartesken« füllte er sein Zimmer, so schreibt er, mit Blumen und Heu, denn er hatte sich gerade für die Botanik zu begeistern begonnen. Wenn es doch einmal lästigerweise Briefe zu schreiben gab, lieh er sich »grollend« das Schreibzeug des Steuereinnehmers und gab es ihm auch so schnell wie möglich wieder zurück. Dass es ein Schriftsteller und Intellektueller als Befreiung empfindet, kein Schreibzeug und keine Bücher zu haben, spricht in diesem Fall Bände über sein sehr spezielles Kulturverständnis und seine Vision von einer wiederzuerlangenden Unschuld, die aber doch, wie er wusste, zum Scheitern verurteilt war. Das Glück dieses Inseldaseins (spezifizierte er) war das unschätzbare »far niente«, das er in seiner ganzen Süße auskosten wollte. Das süße Nichtstun, ebenso wie das Paradies ein großer abendländischer Traum. Der Genfer Aufklärer, der sich zugleich als Gegen-Aufklärer positionierte, schildert akribisch den Tagesablauf seines Aufenthalts im Hause des Steuereinnehmers und in der schönen Natur auf der Insel in den Spätsommertagen des Monats September: früh aufstehen und nach dem gemeinsamen Frühstück mit den anderen Hausbewohnern gleich hinaus in die Landschaft. Keine Arbeit, die anstrengte, sondern nur schöne Arbeit zum reinen Zeitvertreib. Botanisieren, Fauna und Flora betrachten, die Insel erkunden, dann mit dem Steuereinnehmer, seiner Frau und Thérèse hinaus aufs Feld, um den Arbeitern bei der Ernte zu helfen. Wenn Bekannte aus Bern kamen – Besucher, die er fast alle als lästig empfand –, fanden sie ihn häufig des Vormittags Obst pflückend im Geäst eines Baumes, mit einem um den Leib gebundenen Sack (in den er das Obst füllte), den er dann mit einem Strick zur Erde herabließ. Auf angenehme Weise ermüdet von dieser überaus sinnvollen Arbeit, konnte er dann nach dem gemeinsamen Mittagessen den Nachmittag in träumerischer Betrachtung im Freien verbringen – und hier entfaltet der Text seine brillantesten Passagen, indem er die träumerischen Betrachtungen wiedergibt.
Träumereien, »rêveries«. Rousseau vermeidet den Begriff »Meditationen«, die an Descartes erinnern, und er spricht auch nicht von »pensées« wie Pascal, also »Gedanken«. Gemeint ist ein zweckfreies Meditieren, in dem der Geist völlig sich selbst überlassen bleibt und nicht in die vorgegebenen Strukturen des Denkens gepresst wird. Im 17. Jahrhundert hatte »rêver« noch die Bedeutung von »tief nachdenken«, aber Rousseau beschwört einen Zustand vor jedem begrifflichen Denken, der eher einem diffusen Gefühl der Selbstwahrnehmung entspricht und in dem das Ich förmlich mit seiner Umgebung verschmilzt. Wie schwierig das besonders für Menschen des westlichen Kulturkreises ist, wird jedem bewusst sein, der schon einmal eine angeleitete Meditation mitgemacht hat, bei der man aufgefordert ist, seine Gedanken an sich vorbeiziehen zu lassen, sie nicht festzuhalten und nicht zu bewerten. Nicht denken, also Gedanken »loslassen«, wie sollte das gehen? René Descartes fordert das denkende Ich, dessen Denk- und Wahrnehmungsvorgänge die Gewissheit für seine Existenz darstellen, dazu auf, »klare und deutliche« Vorstellungen zu entwickeln (»clair et distincte«), um sie von den täuschenden Sinneswahrnehmungen in einem überwindenden Sinne zu trennen. Wahr ist nur, was zweifelsfrei klar und bewiesen ist, wie die logischen Sätze in der Mathematik. Rousseau hingegen beschwört hier geradezu eine diffuse Undeutlichkeit, die dem Menschen Gewissheiten verschafft, welche er über das diskursive Denken niemals erlangt. Das »Ich denke, also bin ich« Descartes’ wird bei Rousseau gewissermaßen durch den Satz ersetzt: »Ich fühle, also bin ich.« Es ist ein vor-cartesischer und vor-rationaler Blick auf die Welt, eine Welterfassung über die reine Wahrnehmung, so diffus sie auch sein mag. Er verzichtet auf jegliche Analyse, und das ist definitiv ein Schritt zurück, was die Errungenschaften und Forderungen des Zeitalters anbelangt, den Menschen und seine Erkenntniskräfte betreffend. Die traditionelle Gegenüberstellung indessen der vita activa und der vita contemplativa, der tätigen und der betrachtenden Lebensweise, wird hier nicht aufgehoben und auch nicht zugunsten der kontemplativen Lebensweise entschieden, da der Spaziergänger Rousseau, der den frühen Morgen mit Botanisieren verbracht hat, sich ja auch durchaus begeistert als Erntehelfer in einer nützlichen Arbeit ergeht und sich somit den nachmittäglichen Müßiggang gewissermaßen verdient. Doch es ist durchaus ein Plädoyer für das ungebundene Denken und den produktiven Müßiggang, wie es gerade Rousseaus Herkunftsmilieu der Kleinbürgerwelt in der calvinistischen Schweiz klar entgegensteht. Eine müßige Lebensweise, was immer dabei auch herauskam, war und ist diesem Milieu zutiefst suspekt. Nach der Aufwertung der Berufsarbeit im Protestantismus war es vor allem das leistungsbezogene, tätige Leben (und zwar als Selbstzweck), das eine gottgefällige Lebensweise verbriefte, und wenn man sich damit auch nicht die göttliche Gnade erringen konnte wie durch die »guten Taten« in der katholischen Lehre, so bewies man damit doch seine Menschenpflichten vor Gott im Hier und Jetzt. Ein Spaziergänger war ein Müßiggänger, nichts weiter, ein Faulenzer vor dem Herrn, der andere die Arbeit machen und den lieben Gott einen guten Mann sein ließ. Noch die literarischen Großstadtflaneure im nächsten Jahrhundert und darüber hinaus bekundeten in ihrem Selbstverständnis eine gewisse Anti-Bürgerlichkeit. Die Tatsache, dass Rousseaus Zögling Émile in seinem Erziehungsroman unbedingt ein Handwerk erlernen muss, unabhängig davon, ob er denn Lust und Talent dazu hat, ist vielleicht auch ein Ausdruck schlechten bürgerlichen Gewissens des »citoyen de Genève«, der es auch nie langfristig in einer normalen bürgerlichen Berufsarbeit aushielt. Der müßige Spaziergänger entspricht, so gesehen, eher der Lebensweise der Aristokraten. Mit gelegentlich ein paar Stunden Erntehilfe bei schönem Wetter, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, konnte jedenfalls noch nie jemand seinen Lebensunterhalt bestreiten, weder im 18. Jahrhundert noch heute.
Die Infragestellung des Bücherwissens, die der Autor in dem Triumphgefühl ausdrückt angesichts der Entscheidung, seine Bücherkiste in die Ecke zu stellen und sie nach Möglichkeit bis auf Weiteres auch nicht zu öffnen, ist klar ein antiaufklärerischer Impuls. Man musste nur das Buch der Natur lesen, alles andere war lediglich ein Wissen aus zweiter Hand, das dem identifizierenden Wissen niemals gerecht werden konnte. Abgesehen davon, dass damit implizit auch ein entschiedenes Selbstdenkertum propagiert wird, das sich von allen Vorgaben freimacht (und damit auch von der Übernahme der Vorurteile von anderen), hat der Gedanke aber auch viel vom heute wieder an Konjunktur gewinnenden Mythos des »edlen Wilden«, wie er nach den diversen Weltumsegelungen in Europa in Umlauf kam, dessen Apologeten aber ihre Beschreibungen der »Naturvölker« auch zum Anlass nahmen, die gesellschaftlichen Zustände im alten Europa zu kritisieren. Moderne Ethnologen würden diesen Mythos vermutlich mit wenigen Pinselstrichen zerstören, aber einen Autor, der die These vertrat, dass der Mensch von Natur aus gut sei und dass nur die Gesellschaftsverhältnisse ihn korrumpierten, musste die Vorstellung eines von der Zivilisation unverbildeten »Naturmenschen« faszinieren. Ihm so nahe wie möglich zu kommen, gewährte die stille Betrachtung in der Natur, wenn es schon sonst nicht möglich war, diesen lange überwundenen Naturzustand zu erfahren. Um hier einen Begriff aus der deutschen Klassik ins Spiel zu bringen, so ist dieser sentimentalische Blick zurück in ein vorzivilisatorisches Zeitalter, auf jeden Fall aber in eine Zeit, in der der Mensch sich noch »ganz« fühlte – im vollen Sinne der Wirklichkeit zugewandt und nicht durch abstrakte Ideen von ihr entfernt –, von jeher ein Teil des Geisteslebens im modernen Europa. Der Intellektuelle gibt gerne seinen Intellekt preis, insofern er ihm vor allem Unruhe brachte. Und letztlich bezeichnet dieser menschliche Intellekt in der Genese immer eine sträfliche Grenzüberschreitung: Er rebelliert gegen die Götter, er rebelliert gegen Gott, am Ende aber vornehmlich gegen den Menschen selbst, denn dass er damit seinen eigenen vermeintlichen Naturzustand überschreitet, liegt im System – und er bringt nicht nur Gutes, gewiss nicht. In seinem Essay »Über die Menschenfresser« schreibt Michel de Montaigne über die »Wilden« in Südamerika, also die Indigenen am Amazonas, diese hätten sich weniger als die Europäer vom Naturzustand entfernt, und sie lebten dadurch auch gleichsam in einem unverdorbeneren Verhältnis zur Schöpfung. Es ist bemerkenswert, was der Essayist damit alles zu rechtfertigen scheint, selbst den Kannibalismus, der auch nicht grausamer sei, meinte er, als die Folterungen Europas im Strafvollzug oder die Unterdrückung der Völker. Von erotisierenden Bildern ganztägig tanzender Menschen in spärlicher Kleidung in einem immer warmen, tropischen Klima und indogenen Frauen, die ihren Männern den nährenden Trank kochen (und vermutlich das Bett wärmen), während diese auf der Jagd sind, reicht die Schilderung bis zur Apotheose eines glücklichen vorzivilisatorischen Zustands. Darin gab es keinen Reichtum und keine Armut, keine Handelsgeschäfte und keine Schrift, keine Zähl- und Rechenkunst, keine staatliche Obrigkeit und keine Rangordnungen in der Familie, keine Begriffe für Würdenträger und keine Dienstbarkeit, keinen Beruf, der zur Arbeit zwingt, keine Verträge, keine Güterteilungen, keine Erbfolgen und keine Kriege um der puren Eroberung willen. »Plato müßte zugeben, daß der Idealstaat, den er sich ausgedacht hat, bei weitem nicht so vollkommen ist wie dieser.« Vielmehr sei es so, meint der Essayist, dass die Menschen dort so seien, »wie sie aus Gottes Hand hervorgehen«. Sie hätten, so schreibt er, die Begriffe Lüge, Verrat, Heuchelei, Geiz, Neid, Verleumdung oder Verzeihung überhaupt nicht gekannt. Wann also hätte der »Sündenfall« in Europa begonnen, der diesen schönen Naturzustand aufbrach (denn dass es auch bei uns einmal so etwas Ähnliches gab, bevor wir uns aufmachten, die Welt zu erobern, klingt in den Schilderungen stets mit)? Für Autoren wie Michel de Montaigne, der im Zeitalter der Religionskriege lebte, sind dies Gedankenspiele, die vor allem den Sinn haben, die derzeitigen kulturellen Wertmaßstäbe, die Hybris des europäischen Kontinents, der sich gerade aufmachte, die Neue Welt zu erobern, sowie die Doktrinen der Herrschenden zu relativieren. Rousseau aber meinte die Rückorientierungen ernst, und zumindest die Nostalgie danach prägte sein Weltbild.
Während die anderen beim Mittagessen noch zu Tisch saßen, schreibt der Spaziergänger, stahl er sich fort und lief allein zum See. »Bei stillem Wasser sprang ich in einen Kahn und ruderte bis zur Mitte. Dort streckte ich mich im Boot aus, den Blick zum Himmel gerichtet, und ließ mich von der Strömung treiben, nicht selten stundenlang, und versank dabei in tausend verworrene, aber herrliche Träumereien, die keinen eigentlichen Gegenstand hatten und mir doch hundertmal süßer waren als alles, was man gemeinhin die Freuden des Lebens nennt.« Aber auch an den sattgrünen Gestaden der Insel, mit Blick auf die nahen und fernen Berge und auf der anderen Seite reiche, fruchtbare Ebenen, wenn er nicht auf den See hinausfuhr, weil das Wasser zum Beispiel zu unruhig war für eine Kahnpartie, hat der Betrachter ganz ähnliche Eingebungen, die ihm sinnbildlich werden fürs Leben und für die menschliche Existenz. In etwas erhöhter Lage, da er einen Hügel erklommen hat oder eine Terrasse, um von hier aus das bezaubernde Panorama zu betrachten bis zu den blauen Bergen am Horizont, die seinen Blick begrenzen, gelangt er auch zu einer besonderen Höhe der Einsichten. Doch er verlässt das Plateau, wenn es kühl wird am Abend, und in der Ebene des Seeufers gelingt es dem Träumenden, die inneren und manchmal verworrenen oder verstörenden Regungen seiner Seele im Auf und Ab der Wellen und Fluten des Sees aufgehen zu lassen, was ihn von allen Verworrenheiten befreit. Das ist der Endzustand der gelungenen Meditation. »Wenn der Abend nahte und mich zwang, die Höhen der Insel zu verlassen, saß ich gern an irgendeinem lauschigen Plätzchen im Sand des Seeufers. Das Rauschen der Wellen und die Bewegung des Wassers waren Vorgänge, die meine Sinne bannten; sie verdrängten aus mir jede andere Bewegung und versenkten meine Seele in eine wonnige Träumerei. Oft bemerkte ich gar nicht, wie darüber die Nacht hereinbrach. An die Stelle der inneren Regungen, die meine Träumerei vertrieben hatte, trat, was ich hier wahrnahm: das Kommen und Gehen der Fluten, ihr Rauschen, das nie abbrach, freilich bald stärker, bald schwächer wurde; nur ein Wasserspiel, aber es genügte, um mir wieder Freude zum Dasein zu geben, und ich mußte dabei nicht einmal denken. Dann und wann war ich versucht, in der Oberfläche des Wassers ein Sinnbild für die Unbeständigkeit der Dinge dieser Welt zu sehen, doch schwanden jene kurzen, flüchtigen Eindrücke bald in der Gleichmäßigkeit der Bewegung, die mich fortdauernd wiegte und festzuhalten schien, denn ganz unwillkürlich blieb ich dort und konnte mich, wenn die Stunde der Rückkehr kam und das vereinbarte Signal ertönte, nur mit großer Mühe losreißen.« Der begnadete Zustand ist nicht von Dauer; das ist das Schicksal der menschlichen Existenz. Aber die Rückkehr in die Gemeinschaft der Menschen, die das vereinbarte Signal – vermutlich zum Abendessen – ankündigte, ist die Rückkehr in eine intakte und ungetrübte kleine Sozialgemeinschaft, die sich vor allem dadurch auszeichnet, weit weg von den Städten und ihren Verderbtheiten zu sein, von den Eitelkeiten der großen Welt, von den künstlichen Hierarchien der Stände in der feudalen Gesellschaft und auch von der oftmals vernichtenden Wortakrobatik in den gelehrten Salons in Paris. Das sind einfache Menschen, die hier zusammenkommen, abgesehen von dem keineswegs einfachen träumenden und betrachtenden Spaziergänger Jean-Jacques Rousseau, der dieses Inseldasein auflädt mit Träumen vom Paradies. Die Zusammenkunft ist gefüllt mit heiterer Konversation, abendlichen Spaziergängen auf der Terrasse, Musik, Humor und Gesang nach der gemeinsam eingenommenen Abendmahlzeit. »Wir ruhten uns in der Laube aus, lachten, plauderten, sangen gelegentlich auch ein altes Lied.« Bevor dann jeder schlafen geht, »zufrieden mit seinem Tag und sich nur wünschend, der morgige möge werden wie der heutige«, hat der Tag also noch einen harmonischen Ausklang in der Gemeinschaft, die das Individuum stärkt, nicht bedroht oder korrumpiert, und das mit sehr, sehr einfachen Mitteln. »Und ich mußte dabei nicht einmal denken.« Das ist die Kernbotschaft. Die beschworene Harmonie dieser Tage liegt in einer Selbstvergessenheit, die das moderne Subjekt nicht mehr kennt.
Der abgeklärte Blick des Spaziergängers in der schreibenden Retrospektive, der sich mit 64 Jahren bereits in der Endphase »eines langen Lebens« angekommen sieht, reicht dann auch in einem abschließenden und generierenden Sinn in die Höhen und Tiefen des Lebensgangs, die ein jeder Mensch in natürlichem Wechsel durchlebt. Es sind nicht die kurzen Momente des Taumels oder der Leidenschaft, resümiert er, nicht die süßesten Wonnen oder die ungestümsten Freuden, die bleiben, sondern der Gleichklang, die Aneinanderreihung schöner und ruhiger Augenblicke, und zwar solcher, die zur Verewigung einladen. Hier liegt das Glück, und es läuft auf den Gleichklang der Seele in der Betrachtung hinaus, auf Seelenruhe. Das ist ein unschätzbarer Zustand, zu dem es Weisheit braucht, vielleicht eine gewisse Lebenserfahrung, aber auch wiederkehrende Phasen der Abkehr vom Lebenstaumel, von den Verstrickungen der sozialen Verhältnisse und von den Zudringlichkeiten der anderen Menschen mit ihren jeweiligen Individualinteressen, Abkehr vor allem auch vom nicht authentischen Ich, das von den Verstrickungen und Verhältnissen deformiert wurde. Eine sonderbare Ambivalenz zeichnet zudem das menschliche Sinnen und Trachten ganz allgemein aus: Wir leben entweder in der Vergangenheit, indem wir Verlorenem nachtrauern und die Zeiten bedauern, die nicht mehr sind, oder wir projizieren uns in eine imaginäre Zukunft hinein. Nie aber lebt der Mensch in der Gegenwart, im Hier und Jetzt und im vollen Bewusstsein des Augenblicks. Die Sehnsucht nach reiner Gegenwart angesichts der Flüchtigkeit des menschlichen Lebens und seiner vielen Zerstreuungen kann, so wird es im Text beschworen, in solchen besonderen Momenten erfüllt werden, die man bis zu einem gewissen Grade auch willentlich hervorrufen kann, sofern man die geeignete Umgebung besitzt und eine entsprechende innere Einstimmung. »Das Herz muß ganz ruhig sein, und keine Leidenschaft darf seinen Frieden stören.« Wünschenswert wäre eine gleichförmige, durch nichts unterbrochene Bewegung im Umkreis des Menschen, der sich so sammeln kann. Vollkommene Stille macht traurig und bietet ein Bild des Todes, während zu viel Unruhe den Zauber der Ruhe und inneren Sammlung zerstört. Das Plätschern des Sees also oder die schaukelnden Wellen, die der Träumende spürt, der auf dem Kahn dahintreibt, wären ein solches geeignetes Setting. Im Idealfall erreicht man dann den vollkommenen Zustand, und der Träumende gelangt zu den existentiellen Einsichten, die man auch bei Heraklit findet, in der christlichen Mystik oder im Hinduismus. »Alles auf Erden ist in stetigem Fluß. Nichts behält eine feste, bleibende Gestalt, und unsere Emotionen, die sich an die Dinge in der Außenwelt heften, ändern sich und erlöschen notwendigerweise mit ihnen. Sie hinken uns entweder hinterher oder eilen uns voraus, rufen entweder das Vergangene wach, das nicht mehr ist, oder künden eine Zukunft, die oft genug nicht sein wird; im Jetzt aber findet das Herz nirgendwo einen Halt. Daher sind uns hienieden nur vergängliche Freuden beschieden; dauerhaftes Glück jedoch hat, so glaube ich, noch nie ein Mensch kennengelernt.« Das ist christlicher Platonismus, und er könnte so ähnlich auch in einem pietistischen Erbauungstext stehen, sofern die Ausrichtung dann auf die jenseitige Welt oder im mystischen Sinne auf die Begegnung mit Gott rekurriert. Aber die Forderung geht in eine andere Richtung, denn die reine Gegenwart, die das Ziel der Betrachtungen ist, steht nicht nur für authentisches Leben, in dem sich das Ich von allen fremden Elementen befreit hat, sondern sie ist auch ganz trans-mystisch ein Zweck an sich. »Angenommen […], unsere Seele erreichte eine solche Ruhelage, in der sie, ihr gesamtes Wesen konzentrierend, ganz zu sich käme, dann müßte sie Vergangenheit und Zukunft gar nicht bemühen. Zeit zählte für sie nicht, denn dauernd wäre Gegenwart.« Dieser begnadete Zustand hat nahezu etwas Göttliches – und der Autor geht in seinen Betrachtungen tatsächlich so weit, diese reine Gegenwart, das Sich-selbst-genug-Sein mit der Selbstgenügsamkeit Gottes in Verbindung zu bringen. Er hat diese Gottesnähe übrigens schon im ersten Spaziergang, also im ersten Kapitel zum Ausdruck gebracht. Unerschütterlich wie Gott stehe er hier, der Mensch mit dem Anspruch, ganz bei sich zu sein und sich selbst zu erkennen – denn das ist am Ende das Ziel des Betrachtenden, der quasi dabei ist, sein Testament zu verfassen. Die vollkommene Ruhelage der Seele schließlich, vorgeführt im Spiegel der Natur, generiert nicht nur Gottesnähe, sondern sogar Gottähnlichkeit. »Was eigentlich genießen wir in solch einer Stimmung? Nur uns selbst und unser eigenes Dasein, nichts jedenfalls, was außerhalb von uns selbst wäre. Solange dieser Zustand währt, sind wir, wie Gott, uns selbst genug.«
Aber die Meditation schafft auch noch einen anderen Mythos, der äußerst berühmte Nachahmer finden wird: Es ist der Mythos des hohen Augenblicks, der eine große Moment gesteigerter Lebensintensität. Goethe greift ihn im »Faust« auf und später Nietzsche in seinem Gedanken der ewigen Wiederkehr. Wenn Faust zum Augenblicke sagen kann: »Verweile doch, du bist so schön!« (so wird es in der Wette mit Mephisto vereinbart), dann hat der Teufel das Spiel gewonnen, es schallt die Totenglocke, die Zeiger fallen, »Es ist die Zeit für mich vorbei.« Der Unbedingte, der Tatmensch, geht an die Grenzen des Menschenmöglichen und lässt sich sogar mit dem Teufel ein, um seinen Wirkungskreis erweitern zu können, der Welt seinen Stempel aufzudrücken und sie in seinem Sinn zu gestalten. In der ihm eigenen Überheblichkeit vermag Faust zunächst nicht zu glauben, dass Mephisto ihn an einen Lebensmoment bannen kann, der ihn menschlich und endlich macht, der sein Streben aufhebt, der eine Seinsvergessenheit ausdrückt, die auch sein rastloses Streben zur Ruhe bringt. Erst spät, ganz spät, als alter Mann und nach einer Erdumrundung, bildlich gesprochen, erkennt der rastlos Strebende, der sich zwischenzeitlich als Unternehmer, Fürst und Großgrundbesitzer betätigt hat, mit allen Kollateralschäden, die dieses unbedingte Streben des Menschen verursacht, erkennt Faust die Begrenzung, die auch die Sorge ums Ganze umfasst – und damit den höchsten Augenblick. Leider ist es der Augenblick seines Todes.
Seinsfülle. Reine Gegenwart. Goethes Augenblick ist die Fülle aller Menschheitserfahrungen im Licht der begrenzten irdischen Existenz. Nietzsche wiederum griff den Rousseau-Satz über den Augenblick sogar wörtlich auf, und diese Vorstellung vom höchsten Augenblick stellte er in den Dienst seiner Lebensphilosophie und des Gedankens der ewigen Wiederkehr. Hier entwarf er einen Imperativ der Augenblicksfülle als Ausdruck höchster Lebensbejahung, der alles, was wir tun und entscheiden, und auch, was wir nicht tun, vermeiden und auslassen, vor die Frage stellt: Kann ich wollen, dass dies für alle Ewigkeit so geschieht – und das wird es ja, vor dem Hintergrund ewiger Wiederkehr. So zu leben, dass ich wollen kann, dieser und jener Augenblick währe ewig, läuft auf eine bewusste und willentliche Intensivierung des Lebens hinaus, in dem die Augenblicke eventuell aufgesucht, vor allem aber gewollt und bejaht werden, verewigt in reiner Diesseitigkeit. Bei Rousseau aber steht der Augenblick größter Selbstgewissheit und reiner Gegenwart gerade nicht im Dienste der flüchtigen Freuden und der Affektionen der Sinne auf die eine oder andere Art, sondern jenseits davon, frei von Leidenschaften, im seelischen Gleichklang interesseloser Betrachtung. »Selbst die ungestümsten Wonnen bescheren uns kaum einmal einen Augenblick, in dem unser Herz aufrichtig sagen kann:ICH WOLLTE, DIESER AUGENBLICK WÄHRTE EWIG.« Das Glück des Einklangs von Ich und Welt besteht in einer völligen Annahme des Gegebenen, was im Grunde genommen auch ein tiefes Gottvertrauen zur Grundlage hat, indem das Geschöpf auch die ihm unergründlichen Wege, auf die es geführt wird, vertrauensvoll annimmt. Die »Träumereien« sind voll von Bekundungen dieser Art, und da es wesentlich darum geht, die schweren Verwundungen dieses träumenden Individuums, das von der Gesellschaft verstoßen wurde und sich einem Komplott seiner Feinde ausgeliefert sieht, von einem göttlichen Plan gesteuert zu sehen, liegt sein übergeordneter Trost in der Vorsehung, der »providence«. Diese weiß, was sie ihm zumuten kann, und sie weiß vor allem, warum sie dies tut. »Gott ist gerecht; er will, daß ich leide, und er weiß, daß ich unschuldig bin.« Und so ist selbst der schlimmstmögliche Ausgang, also zu seinen Lebzeiten der nachhaltige Sieg seiner Feinde, der ihn in diese ausweglos scheinende Lage gebracht hat, auch deshalb der Fall, »weil es in den ewigen Ratsschlüssen so bestimmt war.« Der wahrhaft Glückliche nimmt dieses Los an, um daran zu wachsen, er bringt sich in diesen gesegneten Zustand des Augenblicks, der versinnbildlicht wird in der Insel, die sich ebenfalls selbst genug ist, und er wünscht in keinem Augenblick, dass es anders sei, als es ist.
Eines von Rousseaus Hauptanliegen ist es, das Ich freizulegen von allen fremden Einflüssen, die die Gesellschaft schuf samt ihren verderblichen Elementen, auf die er nie müde wird zu verweisen. Thema ist also immer das authentische Ich. Der Autor fasst das im zweiten Spaziergang in die Formel, in der fruchtbaren Einsamkeit, in der ihn nichts ablenkt und stört und in der er sich nur der Betrachtung ergeht, gelange er einzig zu diesem Punkt, »zu sein, wie die Natur mich wollte.« Das bleibt eine interessante Frage für die Erdenbürgerinnen und Erdenbürger jeglicher Zeitalter, und für manch eine und einen wird es nichts Geringeres sein als eine Lebensaufgabe: den eigenen Wesenskern zu ergründen, also das ganz authentische Ich, das völlig frei ist von gesellschaftlichen Bewertungen, von Prägungen durch Familie und Umfeld, von Lebenserfahrungen, Erfolgen, Zurückweisungen, den unerlässlichen sozialen Rollenspielen in den unterschiedlichen Lebensbereichen, den vielen Zerstreuungen, den Mechanismen des Alltags und seiner Monotonie. Nach den vielen Entfremdungsdebatten, die vor allem die politische Linke im Rahmen ihrer Gesellschafts- und Kapitalismuskritik entzündet hat, sind wir es mittlerweile gewohnt, den vermeintlichen Idealzustand »ex negativo« zu definieren, also als ein Freisein von … (von entfremdeter Arbeit und von entfremdeten Gesellschaftsverhältnissen, von Leistungsdruck, von einem eventuell falschen Wirtschaftssystem, von einer nicht mehr lebendigen Partnerbeziehung, schlechten Wohnorten oder einem falschen Milieu, einem von äußeren Kategorien wie Geld und Erfolg und sonstigen Scheinwerten getriebenen Lebensweg oder von krank machenden Lebensbedingungen). Bei Rousseau aber klingt immer dieser Sehnsuchtsort mit, der schöne Zustand, den es einmal gegeben haben muss, in der Selbstgenügsamkeit des Menschen vor den diversen Stufen seiner Vergesellschaftung und seines Verlusts der Unschuld, als das Ich noch intakt und autark war, so wie die Insel im Bieler See. Aber der Glaube daran gehört ins idealistische Zeitalter, und so auch Rousseaus Begriff der »Natur«.
Wie ambivalent es indessen um diese zweckfreie Selbstvergessenheit im Einklang von Ich und Natur bestellt ist, zeigt nicht zuletzt auch die Beschreibung Rousseaus im fünften Spaziergang, die sich auf seine botanischen Studien bezieht. In Môtiers bereits hatte Rousseau mit dem Botanisieren begonnen – er erwähnt es selbst in den »Träumereien«, dass der Arzt und Botaniker Jean-Antoine d’Ivernois ihn mit der Pflanzenkunde vertraut gemacht hat, unter anderem auch mit den Werken Linnés –, und er wird damit eine Modewelle in Westeuropa unter den Intellektuellen auslösen, schon in der nächsten Generation. Da zog er dann also los, der leidenschaftlich botanisierende Inselbewohner, gleich frühmorgens, direkt nach dem Frühstück. Er hatte sich vorgenommen, so schrieb er, dem süßen »far niente« zu frönen und keine andere Arbeit mehr zu verrichten als eine, die ihm Spaß machte, zum reinen Zeitvertreib. Aber das zweckfreie Botanisieren wuchs sich doch sehr bald aus zur akribischen Spezialistenarbeit mit einem offenkundigen Hang zum Perfektionismus. Nichts Geringeres als eine »flora petrinsularis« zu erstellen hat er sich vorgenommen, also ein Verzeichnis sämtlicher Pflanzen auf der Insel, ohne auch nur eine einzige auszulassen – ein Unterfangen, so weiß er selbst, das ihn wohl für den Rest seiner Tage beschäftigt halten würde, und das sicher ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Mit unüberhörbarer Ironie erwähnt er an dieser Stelle, dass ein Deutscher einmal ein ganzes Buch über die Zitronenschale verfasst habe. Man konnte sicher auch ein ganzes Buch über das Wiesengras schreiben, meint der Autor und Hobbybotaniker, über das Waldmoos, über die Flechte auf den Felsen, über das kleinste Grashälmchen oder über das winzigste Stäubchen im Pflanzenreich, und Jean-Jacques Rousseau würde sich gegebenenfalls mit Begeisterung dazu versehen. Und so zog er dann los, ein Exemplar des Linné unterm Arm und die Lupe in der Hand, auf ein vorab festgelegtes Revier der Insel, die er zuvor in kleine Quadrate eingeteilt hatte, welche er nun, eines nach dem anderen, von Jahreszeit zu Jahreszeit zum Gegenstand seiner Forschungen machen wollte. Da hatte er offenkundig schon einen längeren Aufenthalt eingeplant oder sogar sich in den schönen Gedanken hineingeträumt, auf der Petersinsel seine Tage beschließen zu können. Doch wie auch immer: Beschäftigung gab es hinreichend im Paradies, wer sie denn suchte und wollte. An sinnvollen Tätigkeiten war niemals Mangel. An dieser Stelle wird aber auch klar: Das geht nicht lange gut mit dem reinen Müßiggang und mit dem zweckfreien, selbstgenügsamen Leben. Da wird gleich geordnet und eingeteilt, kategorisiert, katalogisiert, analysiert und gemessen. So, wie der Mensch sich die Welt ordnete – oder sie sich nach der Schöpfungsgeschichte untertan machte –, ist sein Verhalten zu ihr offenbar auch ein Ausdruck seiner menschlichen Wesensnatur, die der träumende Flaneur nicht unterwandern kann, ob ihm das nun gefällt oder nicht. Freilich, da ist eine große Ehrfurcht vor der Natur, die der leidenschaftliche Botaniker in Gottes Garten in einem Gestus der Anverwandlung umfassen und auch begreifen will, was viel mit der Ehrfurcht vor Gottes Schöpfung zu tun hat, »Einsichten in den Bau« zu bekommen, und was zunächst wenig von dem Gestus erkennen lässt, sie sich untertan und nutzbar zu machen, wie etwa in den Landgewinnungsplänen von Goethes Faust, einschließlich aller Opfer und Kollateralschäden. Aber der Mensch stellt sich damit zugleich außerhalb dieses Kosmos, und er versucht, Gottes Handschrift zu lesen, was einem (sträflichen) imitierten Schöpfungsakt nicht mehr sehr fern ist. Seine Annäherung an die Natur hat somit immer ein äußerliches Moment. Ein »Zurück zur Natur!«, wie man es ihm in den Mund legte, kann es daher für Rousseau gar nicht geben.
In den aneinandergereihten Träumereien eines Spaziergängers, der sich ein letztes Mal, so scheint es, mit Hilfe der Naturszenerien im Spiegel betrachtet, um letzte Rückschlüsse über sich selbst zu gewinnen und alle wesentlichen offenen Fragen zu klären, die sein bisheriges Leben bestimmt haben, wird das intuitive Erfassen, werden Traum und Gefühl dem diskursiven Denken entgegengestellt. Ausdrücklich wird dieses Denken als Element der Entfremdung charakterisiert, und es bezeichnet einen bemerkenswerten Unschuldsverlust, sowohl zivilisationsgeschichtlich als auch in der persönlichen Biographie des Betrachtenden. Zu seiner literarischen Laufbahn, bekennt der Autor Rousseau im siebten Spaziergang, sei er mehr von außen geschoben und gedrängt worden, als dass sie seinem eigenen Wunsch entsprach, und mit den Strapazen der geistigen Arbeit, die damit begonnen hätten (zusammen mit der Last einer »unseligen Prominenz«), seien seine süßen Träumereien mit dem anders gearteten Erkenntnisgewinn zugleich schwach und matt geworden. Und dann äußert dieser zur Ikone gewordene europäische Aufklärer: »Denken war mir immer eine mühsame und reizlose Beschäftigung.« Diese geradezu provokante Aussage transportiert zweierlei: Sie distanziert sich zum einen von der rationalistisch geprägten Einseitigkeit im Selbstverständnis der Aufklärung, wie Rousseau sie auch in den diversen zeitgenössischen Debatten erlebt hatte. Mit der Aufwertung der intuitiven Erkenntnis über die träumerische Betrachtung im Blick auf eine erlebte Ganzheitlichkeit dokumentiert und verteidigt er aber zugleich sein religiöses Weltverhältnis, und das ist ein Schlag gegen die »eifrigen Missionare des Atheismus« in den Salons von Paris. Diese Sehnsucht nach den intakten Ursprüngen, die diesen Autor erfüllt, die Utopie, die aus den vermeintlich harmonischen Anfangsgründen hervorgeht, die quasi-Vergöttlichung der Natur, die eine flächendeckende Wirkung auf das Lebensgefühl und auf die Literatur der kommenden Generationen entfaltete, ist genuin religiös, samt ihren damit verbundenen Erlösungsvisionen. Das muss uns völlig klar sein, den Adepten und vielfach unbewussten Spurengängern Rousseaus, sei es im Zuge der Fortschritts- und Globalisierungskritik, der Ökologiebewegung, der alternativen Lebensmodelle oder der Visionen von einer wirklich gerechten, von »Gleichheit« geprägten Gesellschaft: Der Mainstream der Aufklärung in den berühmt-berüchtigten Salons von Paris war ein anderer. Aber die Denkrichtung von Rousseau hat sich allgemein durchgesetzt, nicht zuletzt wohl wegen dieser unglaublich berückenden Bilder. Sie haben das Potential, uns doch wieder, auch in der säkularisierten Moderne und Spätmoderne, den Glauben schmackhaft zu machen, denn wir sehen und erleben ein Paradies, wenn auch vielleicht nur ein imaginiertes, begrenzt auf die Dauer der Meditation. »Je empfindsamer der Betrachter ist, desto mehr gibt er sich dem Entzücken hin, das dieser Einklang in ihm erzeugt. Eine süße, innige Träumerei bemächtigt sich dann seiner Sinne, und selig trunken verliert er sich in der Unermeßlichkeit dieses schönen großen Zusammenhangs, mit dem er sich eins fühlt. Einzelheiten verschwinden vor seinem Blick, er sieht und empfindet nur noch ein Ganzes. Da muß erst ein besonderer Umstand seinen Vorstellungskreis einschränken und seine Phantasie begrenzen, bevor er dieses Weltgebäude, das er zu umspannen suchte, wieder in Teilen beobachten kann.« Keine New-Age-Literatur, kein Angebot aus dem Bereich Esoterik und erst recht kein materialistisches Welterklärungsmodell kann mit dieser Verführungskraft mithalten.
Da die »Träumereien« zum autobiographischen Werk Jean-Jacques Rousseaus gehören, sind darin nicht nur Selbstrechtfertigung und die implizite Abrechnung mit den Feinden des erzählenden Ich und nötigenfalls auch mit der richtenden Nachwelt enthalten, sondern auch der Gang zurück zu den Ursprüngen – der ersten entscheidenden Lektüre (der von Plutarch), frühen Initialzündungen, der Rückkehr zu einem ursprünglichen Lebensgefühl sowie der Erkenntnis, dass wir alleine kommen und alleine gehen. Geburt und Tod, also der Lebensbeginn und in diesem Fall das vermeintliche Ende des Lebens, finden wieder in einem Zirkel zusammen.
»So bin ich nun allein auf dieser Welt«, lautet der erste Satz im ersten Spaziergang. Die existentielle Einsamkeit des Individuums (damals noch eine Größe) ist so etwas wie das Grundgefühl der Moderne und die unmittelbare Folge des immer größer werdenden Ich-Bewusstseins im Zuge von Humanismus und Aufklärung. Dabei wird in den Texten auch – wie im fünften Spaziergang mit dem Schauplatz der Petersinsel im Bieler See – eine intakte Sozialgemeinschaft beschworen, wie sie geradezu ein Gegenmodell bildet zu den Deformationen und krank machenden Eigenschaften der zivilisatorisch überlebten Gesellschaft, deren Dekadenz aber doch im System liegt. Es gehört gar nicht viel dazu, um glücklich zu sein: ein kleiner Kreis von Menschen, die einander zugetan sind, ein naturnahes Leben mit einem natürlichen Rhythmus und in anspruchsloser Verfassung, sodass sich all die Entartungen, die die fortgeschrittenen Gesellschaften durch Konkurrenzdenken, Ehrgeiz, Besitzstreben, Geltungssucht, Wettbewerb, kulturelle Überformungen, Eitelkeiten und gesellschaftliche Ungleichheit entfalten, gar nicht erst einstellen können. Ob diese Setzungen den Anspruch auf Allgemeingültigkeit beanspruchen können, möge dahingestellt sein. Aber dass es so etwas gibt und dass man dies auch erleben kann, will man dem Autor nicht streitig machen. Allein ist das Individuum aber grundsätzlich mit seinem In-die-Welt-gestellt-Sein, und dieses Thema wird zentral bleiben für mindestens die nächsten zweihundert Jahre. Der Autor, der in den »Träumereien« bekundet, im Gegensatz zu Montaigne, der seine »Essais« nur für die anderen schrieb, schreibe er seine »Träumereien« nur für sich selbst, ist zugleich davon überzeugt, das gewaltige Unternehmen, sein Ich zu erschließen, gewähre Aufschlüsse über die Menschheit im Ganzen. Dieses große Projekt einer zu konstituierenden Menschheitsrepräsentannz bildet das Motto seines autobiographischen Hauptwerks, der »Bekenntnisse« (»Confessions«). Wahrhaftigkeit ist der Leitbegriff dieser Bekenntnisse, die nichts auslassen, die in den kleinsten Winkel der Seele hineinleuchten sollen, und sei das zutage Geförderte auch missliebig, dunkel, moralisch zweifelhaft oder gar peinlich. Das fast schon wahnhafte Streben nach unbedingter Wahrhaftigkeit, dem Rousseau nicht nur in diesen, sondern fast noch mehr in den »Träumereien« Ausdruck verleiht, íst hier auch offenbar an die Grenzen des Menschenmöglichen und der psychischen Gesundheit gestoßen. Es hat nicht zuletzt deshalb eine so große Bedeutung in diesen letzten, natürlich auch für die Nachwelt verfassten Schriften, sosehr der Autor auch immer wieder betont, er schreibe die »Träumereien« nur für sich selbst, weil Rousseau – er sagt es ausdrücklich im zweiten Spaziergang – befürchtet, dass seine Feinde noch zu seinen Lebzeiten seine Schriften verfälschen und etwas kompilieren, was seinen Ruf als Schriftsteller endgültig zerstören wird, indem man ihm Gedanken in den Mund legen will, die er nie hatte. »Ich sehe mich genötigt, möglichst wenig zu denken«, schreibt er auch, »weil ich sonst befürchten muß, ich dächte zwangsläufig wieder an mein Unglück.« Mutter Natur, die Heilerin, wird heraufbeschworen. »Ich flüchtete zur gemeinsamen Mutter, um Schutz zu finden vor den Übergriffen ihrer Kinder.«
Die Mutter. Das ist eines (und zwar das erste) der Paradiese, die der Ich-Erzähler verloren hat und die er aber alle zumindest zeitweilig wiederfindet. Die Spaziergänge enden mit dem zehnten, dem letzten Spaziergang, und dieser sehr kurze Text von lediglich zweieinhalb Seiten beginnt mit dem Satz: »Heute, am Palmsonntag, ist es genau fünfzig Jahre her, daß ich Madame de Warens kennenlernte.«