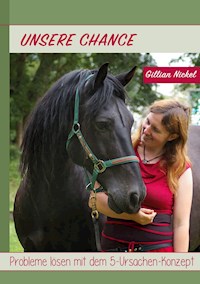
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kennst Du die 5 Bereiche, in denen es in der Beziehung zwischen Mensch und Pferd zu den meisten Problemen kommt? Warum gelingt es nicht, mit dem Pferd glücklich zu sein, obwohl wir es uns doch so sehr wünschen? Warum macht mein Pferd nicht das, was ich von ihm möchte? Dieses Buch zeigt die 5 häufigsten Ursachen auf: - Die Grundbedürfnisse des Pferdes werden nicht erfüllt - Angst bei Pferd und Mensch - Kommunikationsproblemen - Beziehungsprobleme aufgrund von fehlendem Respekt - Schmerzen und gibt wertvolle Hilfestellungen zur Lösung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Warum dieses Buch?
Grundbedürfnisse
Sinne des Pferdes
Die typische Pferdehaltung
Angst/ Vertrauen
Angst beim Pferd
Angst beim Reiter
Beziehungsprobleme durch Respektmangel
Eigenschaften eines guten Horsemans
Fühlübungen
Verständnis/ Sprache
Körpersprache des Pferdes
Charaktere von Pferd und Mensch
Wie lernt ein Pferd?
Entscheidend ist die Motivation
Hilfsmittel
Die Kommunikation:
Verladetraining
Körperliche Probleme/ Schmerzen
Analyse des Pferdes
Anatomie
Massage und Bewegungsübungen
Bodenarbeit zur Gesunderhaltung
Praxis: Seitengänge
Wie bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt mache?
Warum dieses Buch?
„Dieser blöde Gaul! Jetzt zickt der schon wieder rum. Dabei mach ich doch alles für Ihn! Ich gehe ja fast nur noch für seinen Stall und die Tierarztkosten arbeiten! Warum macht der das nur? Weiß der denn nicht, dass ich ihn lieb habe?“
Diesen Ausspruch habe ich vor kurzem in einem Reitstall gehört. Es macht mich traurig, so etwas immer wieder zu hören. In der Beziehung zwischen den Beiden scheint einiges nicht zu stimmen. Das Pferd macht nicht das, was der Mensch erwartet, obwohl der Mensch der Meinung ist, doch alles für sein Pferd zu tun. Und das Pferd dankt es ihm nicht einmal!
Sehr häufig sehe ich Situationen, in denen der Mensch mit einem Pferd nicht klarkommt. Beide streiten miteinander und keiner ist glücklich. Weder der Mensch, der das Pferd doch eigentlich als Freizeitbeschäftigung hat, es liebt und Reiten sein Hobby ist, noch das Pferd.
Pferde versuchen als Herdentiere immer mit dem anderen aus zu kommen. Es gibt in meinen Augen 5 verschiedenen Ursachen, warum Pferde häufig nicht das tun, was wir Menschen gern von ihnen hätten.
Eine häufige Ursache, gerade im Winterhalbjahr: Seine Grundbedürfnisse werden so grundlegend missachtet, dass das Pferd sich so schlecht fühlt, dass es gar nicht anders kann!
Die häufigste Ursache jedoch dürfte sein: Sie haben Angst! Pferde sind Fluchttiere und wir Menschen Raubtiere. Wir bringen Sie in Situationen, die sie nicht verstehen können und bekommen dadurch Angst. Anders ausgedrückt: Es fehlt an Vertrauen.
Die dritte Ursache sind Beziehungsprobleme durch mangelnden Respekt. Respekt ist allerdings etwas, dass man sich als Mensch verdienen muss! Ein Pferd als Herdentier braucht immer einen Anführer. Wenn sein Gegenüber nicht als Chef geeignet ist, muss das Pferd selbst Chef sein. Pferde wollen in Hierarchien leben. Nur dann fühlen sie sich sicher, wenn sie wissen, wer aufpasst und wem sie ausweichen sollten. Manche Tiere wollen aufgrund ihres Charakters Anführer sein, die meisten allerdings nicht, da es sehr anstrengend ist, auf die Herde aufzupassen. Der Mensch muss lernen, die Rolle des Anführers zu übernehmen, um dem Pferd Sicherheit in unserer Welt zu geben.
Die vierte Ursache: es versteht uns einfach nicht. Es hat die Anfrage nicht verstanden, weil wir sie dem Pferd nicht in seiner Sprache präsentiert haben. Wir müssen also lernen, wie Pferde untereinander kommunizieren und wie sie lernen. Wir müssen eine gemeinsame Sprache entwickeln. Da wir etwas von ihnen wollen, kann es nur richtig sein, dass wir auch diejenigen sind, die eine andere Sprache erlernen müssen. Oder besser- wieder erlernen müssen. Körpersprache und der Gebrauch von Energie sind eigentlich Dinge, die wir alle konnten, wir haben sie nur in unserer Gesellschaft häufig verlernt, da wir sie nicht brauchen. Gefühle zeigt man nicht offen. Außerdem findet Kommunikation immer häufiger über Medien jedweder Art statt. Nicht mehr in der Face-to-face- Interaktion.
Die fünfte Ursache wird noch immer häufig übersehen: Das Pferd kann die Anfrage nicht ausführen, da es ein körperliches Problem oder sogar Schmerzen hat. Die Muskulatur kann verkrampft sein oder ist gar nicht erst vorhanden. Probleme an den Beinen, Hufen, der Wirbelsäule oder den Zähnen können schuld sein an den Widersetzlichkeit des Pferdes. Das Anlegen der Ohren oder gar Schnappen beim Satteln und Gurten hat nahezu nie etwas damit zu tun, dass das Pferd kitzelig ist oder einfach ungezogen. Es hat Schmerzen oder erwartet Schmerzen beim Reiten. Wir müssen lernen zu sehen, wann sein Verhalten durch Schmerzen bestimmt ist, anstatt es mit verschiedensten Hilfsmitteln zu zwingen, unsere „Anfragen“ auszuführen.
Ich schrieb dieses Buch also, um Reitern zu mehr Verständnis zu ihrem Pferd zu verhelfen. Ich möchte, dass Pferd und Mensch eine harmonische Beziehung führen können und beide Spaß miteinander haben. Wir hatten doch alle einmal den Traum von der Harmonie mit dem Pferd- ich kann diesen Traum mittlerweile leben und bin sehr glücklich, wenn ich Dir auch helfen kann, deinen Traum mit Pferden zu leben!
Das Buch ist also in fünf Bereiche eingeteilt: Ich werde mich zunächst dem Thema Grundbedürfnisse zuwenden, damit wir sicherstellen, dass du weißt, was dein Pferd braucht, um glücklich zu sein. Erst dann können wir ja mit irgendeiner Art von Beschäftigung oder Ausbildung beginnen. Zuvor macht dies keinen Sinn.
Im zweiten Teil werde ich das Thema Angst ansprechen. Angst beim Pferd und Angst beim Reiter. Wie die Angst entstehen kann und wie man mit ihr umgehen kann. Mensch und Pferd sind sich in diesem Punkt gar nicht so unähnlich.
Im dritten Teil geht es um das Thema Respekt. Wann hat ein Pferd Respekt, wann ist es Angst? Wie muss der Mensch sich verhalten, damit das Pferd ihn respektieren kann. Wie wird ein Mensch zum „Horseman“ und welche Verhaltensweisen und Eigenschaften sollte man dafür entwickeln?
Im vierten Teil geht es um das Thema Verständnis und Sprache. Wie verständigen sich Pferde untereinander, wie subtil kann die Körpersprache sein? Wie können wir unsere Körpersprache bewusst benutzen, um das Pferd zu bewegen und so sein Vertrauen und seinen Respekt zu erlangen? Wie können wir unsere Stimme in der Pferdeausbildung einsetzen? Hier erläutere ich sinnvoller Übungen, die dir helfen, die Pferdesprache zu erlernen.
Im letzten Teil geht es um das Thema Schmerzen. Wie sieht ein Pferd aus, das Schmerzen hat? Es hat ja schließlich keinen Schmerzlaut. Häufig werden diese Anzeichen übersehen und dem Pferd werden menschliche Eigenheiten unterstellt, wenn das Pferd sich komisch verhält. Dabei stecken häufig Schmerzen dahinter. Ich werde einige Massagetechniken sowie Bewegungsübungen erläutern, mit denen auch der Laie seinem Pferd etwas helfen und erkennen kann, wann ein Profi hinzugezogen werden sollte.
Ich wünsche Dir nun viel Spaß beim Lesen und hoffe, dass ich dir einige neue Erkenntnisse liefern kann, mit deren Hilfe du deine Beziehung zu deinem Pferd verbessern kannst.
Grundbedürfnisse
Unsere Hauspferde sind zwar schon seit Jahrtausenden domestiziert, aber die Jahrmillionen der Entwicklungsgeschichte bekommen wir nicht aus den Pferden heraus gezüchtet. Auch das Sportpferd, Rennpferd oder Freizeitpony ist von seinen Instinkten her ein Wildpferd. Das sollten wir im Umgang mit Ihnen nie vergessen. Beginnen wir also mit dem Wildpferd. Wie lebt ein Pferd in der freien Natur?
In einer natürlichen Herde lebt ein Familienverbund in kleinen Gruppen, die sich teilweise bzw. zeitweise zu größeren und großen Herden zusammenschließen. Der einzelne Familienverbund besteht aus einer Handvoll Stuten, Ihren Fohlen bei Fuß, den Jährlingen und einem Hengst.
Die geschlechtsreifen Hengste werden von Deckhengst der Herde verjagt und schließen sich in Junggesellengruppen zusammen. Kein Pferd bleibt freiwillig allein! Jedes Pferd weiß, dass dies seinen sicheren Tod bedeutet, wenn es in der Wildnis allein schlafen muss. Junge Hengste versuchen im Laufe der Zeit, sich eine oder mehrere Stuten aus anderen Gruppen zu stehlen. Dafür kämpfen Sie mit dem Deckhengst. Um Futter oder Wasser kämpfen Wildpferde nahezu nie, solange genug da ist.
Ein Familienverband bleibt also über Jahre relativ stabil in der Zusammensetzung. Fohlen bleiben bis kurz vor der Geburt des neuen Fohlens bei der Mutter. Der Jährling wird immer selbstständiger und dann kurz vor der Geburt des neuen Fohlens „verjagt“, aber es darf in der Herde bleiben.
Wie sieht ein Tag bei einem Wildpferd aus? Eine Herde läuft 10-50km pro Tag, meist im Schritt, auf der Suche nach Futter. Allerdings rennt es durchschnittlich 5-mal im Renngalopp, auf der Flucht vor Fressfeinden. Pferde spielen miteinander, dösen und schlafen über den Tag verteilt insgesamt nur 4 Stunden. Im Stehen schlafen sie im Tiefschlaf, im Liegen träumen sie. Wahrscheinlich, weil im Liegen sozusagen der Körper ausgeschaltet ist, dann darf das Gehirn nicht auch völlig abschalten und im Stehen ist der Körper startklar für eine Flucht, da kann das Gehirn tiefer ausruhen.
Ein Pferd frisst ca. 16h am Tag. Allerdings nicht unbedingt nur Gras! Sie fressen Blätter, Rinde, Moose, Flechten, Holz, Obst, Beeren... und KEIN Getreide! Nur im Spätsommer finden Sie Samen der Gräser, Büsche und Sträucher. Genau in der Zeit, wo die Fohlen am meisten Milch brauchen und selbst beginnen zu fressen.
Pferde sind also:
Herdentiere
Fluchttiere
Langstreckenläufer
Dauerfresser
Frischluftfanatiker, keine Höhlenbewohner
Ihre Grundbedürfnisse sind:
Futter, Wasser, Schutz vor Witterung
Mitgliedschaft in einer Herde, egal in welcher Rangposition als Garant fürs Überleben und soziale Stabilität
Erfolgreiche Fortpflanzung
Sinne des Pferdes
Unsere Pferde sind uns ja in vielerlei Hinsicht recht ähnlich. Sie haben Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut genau wie wir. Die grundsätzliche Funktionsweise der Sinne ist auch dieselbe. Es gibt allerdings auch markante Unterschiede, die wir uns im Folgenden einmal anschauen, um zu verstehen, warum sich unser Pferd manchmal aus menschlicher Sicht sehr komisch verhält.
Sehsinn:
Ein Pferd hat, wie alle Fluchttiere, seine Augen seitlich am Kopf, im Gegensatz zu uns Raubtieren, die die Augen vorne haben. (Genau wie der Hund, die Katze und z.B. die Eule), um mit beiden Augen gut Dinge fokussieren zu können. Ein Räuber muss Entfernungen abschätzen können, um zu wissen, ob sich eine Jagd lohnt. Anhand der Augenposition kann ein Fluchttier also auf den ersten Blick erkennen, ob sein Gegenüber ein Freund oder Feind ist. Ein Pferd sieht Dinge nicht unbedingt scharf, muss es auch nicht, weil es ja schlussendlich egal ist, ob man von einem Bären oder Wolf gefressen wird.
Die seitliche Lage der Augen beim Fluchttier bedeutet: Pferde haben wenig binokulare Sicht, das heißt, nur direkt vor sich können Pferde mit beiden Augen gleichzeitig sehen. Nur so kann man allerdings Entfernungen abschätzen. Dafür sind, wie du vielleicht noch aus der Geometrie weißt, drei Punkte notwendig. (2 Augen und der Gegenstand). Das bedeutet, das Pferd kann nur direkt geradeaus Entfernungen abschätzen. Seitlich kann das Pferd mit je einem Auge- viel besser als wir- jede noch so kleine Bewegung wahrnehmen. Ihr Gesichtsfeld umfasst 320 Grad. Die fehlenden 40 Grad können Sie aber auch sehen, indem Sie ihren Hals etwas zur Seite drehen.
Pferde haben trifokale Augen. Das bedeutet, das Auge funktioniert ähnlich wie eine Gleitsichtbrille: Nimmt das Pferd den Kopf hoch, sieht es Dinge in großer Entfernung scharf, senkt es den Kopf, sind Objekte in der Nähe scharf.
Im Pferdeauge passiert beim Sehen –vereinfacht- folgendes: Die Iris steuert ein Bündel Lichtstrahlen das auf die Linse fällt und so ein Abbild der Umwelt auf der Netzhaut erzeugt. Der Sehnerv nimmt diese Information auf und leitet sie ans Gehirn zur weiteren Verarbeitung.
Pferde haben im Vergleich zu anderen Tieren sehr große Augen. Ein größeres Auge kann wesentlich mehr Licht einfangen. Auf diese Weise sehen Pferde auch bei einsetzender Dämmerung und in der Nacht sehr gut. Zusätzlich verfügt die Netzhaut des Pferdes im Gegensatz zur menschlichen Netzhaut über eine große Anzahl lichtempfindlicher Stäbchen, die in ihrer Wirkungsweise Spiegeln ähneln und zu einer Verdopplung der ins Auge einfallenden Lichtmenge führen. Deshalb sieht das Pferd in der Dunkelheit erheblich besser als der Mensch und die Pferdeaugen leuchten, wenn man sie nachts anstrahlt.
Pferde sind nicht farbenblind. Sie nehmen lediglich die Farben nicht ganz so kräftig wahr wie wir und können blau und gelb am besten unterscheiden.
Den Gemütszustand eines Pferdes kann man auch gut über seine Augen und Augenliedern ablesen. Erstaunen und Argwohn, Angst und Aggression bis hin zu Mut, Zufriedenheit und Freude kann man mit etwas Übung darin ablesen. Anhand der Augen und Augenlider des Pferdes lässt sich auch einiges zum Gesundheitszustand des Tieres ableiten. Bei kranken Pferden sind die Augen beispielsweise häufig halb geschlossen und getrübt.
Für die Praxis: Das Pferd kann mit beiden Augen unabhängig voneinander Dinge und Bewegungen wahrnehmen. Es hat fast einen Rundumblick. Es kann außer den Teil direkt vor seiner Nase und direkt hinter sich alles sehen. Somit erschrickt ein Pferd leicht, wenn man plötzlich die Hand direkt vor seiner Nase hebt und es am Kopf berührt. Daher sollte man das Pferd immer langsam berühren und sicherstellen, dass es mitbekommt, wenn man es anfassen möchte. Man kann zum Beispiel erst die Hand vor seine Nüstern halten, um es daran schnuppern zu lassen.
Das Pferd sieht die Dinge an den Seiten nur mit einem Auge! Die fehlende Tiefenwahrnehmung sorgt dafür, dass das Pferd auf dem Ausritt vor dem von schräg hinten kommendem das Auto scheut, weil es nicht weiß, wie weit dieses entfernt ist. Es kann auch nicht sehen, wie tief die Pfütze vor ihm ist! Also wird es sich wahrscheinlich erschrecken, oder weigern durch die Pfütze zu gehen. Nicht aus Ungehorsam, sondern weil sein Instinkt sagt, dass das Loch auch 5m tief sein könnte.
Pferde haben trifokale Augen. Wenn man ein Pferd also mittels Handeinwirkung oder Hilfszügel dazu zwingt, den Kopf unten zu halten, wird es zu den körperlichen Problemen auch noch Angst bekommen, da es Gefahren aus größerer Entfernung nicht mehr wahrnehmen kann. Somit würde sich die mögliche Fluchtchance verringern. Ein Pferd mit tiefem Kopf im Springparcours zu reiten ist daher Blödsinn, es kann den nächsten Sprung nicht antaxieren. Ebenso sind Hilfszügel beim Überreiten von Cavaletti nicht sinnvoll, weil auch sie die Sicht einschränken. (Von der Stolper- und Sturzgefahr mal ganz abgesehen…)
Das Pferdeauge kann sich nur langsam an Helligkeitsunterschiede anpassen. Wenn man mit dem Pferd aus dem Wald auf eine sonnenbeschienene Wiese reitet, sieht es im ersten Moment nichts. Auf einem langsamen Ausritt stellt das sicher kein Problem dar, wenn man allerdings einen Geländeparcours im Galopp reitet, sollte man das beachten. Auch der Pferdeanhänger kann im ersten Moment einfach „nur“ zu dunkel sein, um hinein zu gehen. Hier sollte der Mensch dem Pferd die entsprechende Zeit geben.
Gehörsinn
Das Hören an sich funktioniert wie bei uns Menschen: Die Ohrmuschel fängt die Schallwellen ein, diese werden im Mittelohr verstärkt und im Innenohr durch die Hörzellen über den Hörnerv ins Gehirn weitergeleitet. Aber gegen das Pferdegehör sind wir nahezu taub. Pferde können deutlich besser hören als Menschen. Pferde können beinahe eine Oktave höher wahrnehmen als Menschen (25kHz). Bei Pferden lässt das Hörvermögen ebenso wie bei uns Menschen mit zunehmendem Alter nach.
Das Pferd nimmt sogar Schwingungen von Tönen mit seinem ganzen Körper wahr. Schwingungen des Erdbodens werden über die Nerven der Hufe erfasst und zum Gehirn geleitet.
Die Pferdeohren sind durch 16 Muskeln in nahezu alle Richtungen unabhängig voneinander beweglich und um 180 Grad drehbar. Das Pferd kann ein Ohr zur Geräuschquelle drehen oder es dreht beide Ohren samt Kopf dorthin. Wenn das Pferd seine Ohren ganz flach anlegt, kann es sie auch verschließen.
Durch die drehbaren Ohren kann das Pferd die Richtung des Geräuschs genau lokalisieren. Die Fähigkeit, mit beiden Ohren sich auf unterschiedliche Geräusche konzentrieren zu können ermöglicht es, ganz genau beurteilen zu können, mit welchem zeitlichen Abstand das Geräusch wahrgenommen wird und das Gehirn kann beurteilen, ob eine Flucht notwendig ist. Auf welche Geräusche das Pferd reagiert, ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Dazu gehören Erfahrung, biologische Relevanz und Motivation. So zeigen Pferde eine instinktive Reaktion auf Lautäußerungen von Artgenossen. Natürlich verfügen Pferde auch über ein Erinnerungsvermögen über Geräusche. Sie können Menschen und andere Tiere am Geräusch ihrer Schritte unterscheiden und Stimmkommandos erlernen. (Dazu später mehr).
Die Ohren des Pferdes dienen nicht nur zum Hören, sondern bekanntermaßen auch zur Kommunikation. Darauf gehe ich im Kapitel zur Körpersprache und Mimik noch näher ein.
Für die Praxis: Wenn unser Pferd bei Wind häufiger scheut und nervös ist, kann einer der Gründe sein, dass es Geräusche hört, die sonst nicht da sind, oder die üblichen Geräusche werden von denen des Windes in den Blättern überdeckt und das Pferd fürchtet, Gefahren nicht mehr rechtzeitig wahrnehmen zu können.
Geruchssinn
Der Geruchssinn beim Pferd ist fast so gut ausgebildet, wie der des Hundes, also ebenfalls um Welten besser als der unsere… Wenn ein Pferd im Gelände plötzlich an einer Stelle nicht mehr weiter gehen mag und du kannst nicht erkennen warum, kann es durchaus auch an einem unbekannten Geruch liegen!
Jedes Lebewesen hat seinen individuellen Geruch. Pferde können diesen wahrnehmen, unterscheiden und abspeichern zur Wiedererkennung. Pferde riechen sie an Urin, Pferdeäpfeln oder auch an Stellen, wo sich z.B. eine rossige Stute gewälzt hat. Sie können Hormone riechen, die etwas über die Fortpflanzungswilligkeit aussagen, oder auch über Angst.
Natürlich dient der Geruchssinn auch bei der Auswahl geeigneter Futtermittel.
Wie funktioniert riechen? Die Luft wird über die Nase eingesaugt, gelangt auf die vielschichtige, große Riechschleimhaut und wird dort gefiltert. Wenn genügend Partikel eines Geruchs dort ankommen, leiten sensible Geruchsnerven diese Informationen ans Gehirn weiter.
Wenn ein Pferd einen ungewöhnlichen oder interessanten Geruch wahrnimmt, beginnt es zu flehmen. Dazu streckt das Pferd Kopf und Hals, zieht die Oberlippe hoch und atmet tief ein. Dabei gelangt die Luft an das hintere Gaumenende, zum Jackobschen Organ, was die Gerüche noch besser filtern kann. Dieses Riechorgan hat der Mensch nicht zur Verfügung.
Für die Praxis: Da ein Pferd viel mehr Gerüche wahrnimmt, erkennt es auch den Geruch von verwesendem Fleisch. Wenn man also an im Gebüsch liegenden toten Tieren vorbeireitet, kann es sein, dass das Pferd scheut. Auch andere unbekannte Gerüche können bei dem Fluchttier Angst auslösen. Es kann also scheuen, und wir Menschen bekommen den Grund dafür niemals mit.
Wenn ein Pferd also im Gelände plötzlich an einer Stelle nicht mehr weiter gehen mag und man kann nichts erkennen, kann es durchaus auch an einem unbekannten Geruch liegen!
Pferde setzten Duftmarken mit Kot oder Urin, genau wie Hunde und Katzen. Wenn das Pferd äppelt und bei der nächsten Gelegenheit daran schnuppert, ist es nicht vergesslich, dass dies sein Haufen ist. Es möchte nur feststellen, was die anderen Pferde über es herausfinden können, wenn sie daran riechen.
Geschmackssinn
Der Geschmackssinn ist scheinbar mit unserem vergleichbar, allerdings fressen Pferde lieber bittere Sachen. (Aufbau und Anzahl der Geschmacksknospen ähneln sich sehr).
Die Geschmacksnerven des Pferdes liegen auf der Zunge, auf der Mundschleimhaut und vor dem Rachen. Bei der Nahrungssuche sind Schmecken und Riechen zwei entscheidende Faktoren.
Ein Fohlen lernt von seiner Mutter, was man fressen kann und was nicht. (Das geht natürlich nur, wenn die Mutter es von ihrer Mutter noch gelernt hat. Das klappt auf vielen unserer Weiden heute leider nicht mehr, weil es zu wenige Pflanzenarten gibt und die Pferde die verschiedenen Kräuter gar nicht mehr erkennen. Oder sie kommen nur mit einem solchen Heißhunger auf die Weide, dass sie einfach alles fressen, was ihnen vors Maul kommt.) Wenn es aber auf einer artenreichen Wiese groß geworden ist, weiß ein Pferd, welche Pflanzen es braucht, um gesund zu bleiben. Man sollte sich allerdings nie darauf verlassen, dass das Pferd die Giftpflanzen schon nicht frisst. Vielleicht kennt es sie nicht oder es hat zu großen Hunger. Giftpflanzen müssen immer entfernt werden.
Für die Praxis: Pferde fressen meist gern Dinge mit unterschiedlichen Geschmäckern! Sie mögen Obst wie Erdbeeren, Kirschen, Nektarinen, Bananen (bitte ohne Schale), oder auch gekochte, geschälte Kartoffeln und Sellerie. Man kann diese Dinge immer mal dazu füttern, aber nur in Maßen, nicht in Massen!!!
Tastsinn
Trotz dessen, dass dem Pferd Hände fehlen, ist ihr Tastsinn mindestens so gut wie unserer. Durch ihre Hufe können Sie feine Vibrationen spüren und ihre Haut ist wenigstens so empfindlich wie unsere!
Das Pferd fühlt über seine Haut, seine Hufe und über die Tasthaare am Kopf. Die Tasthaare sind stabile, lange Haare, die über Nerven mit dem Gehirn verbunden sind. Sie schützen das Pferd davor, mit dem Kopf irgendwo anzuschlagen. Die Tasthaare dürfen daher niemals abrasiert werden!
Die Pferdehaut ist genauso empfindlich wie unsere. Das Pferd empfindet Wärme, Kälte, Schmerz und Berührung/Druck genau wie wir. Es befinden sich verschiedene Rezeptoren in der Haut, die diese Reize an das Gehirn weiter leiten.
Das Pferd kann seine Haare aufstellen (an jedem einzelnen Haar befindet sich ein kleiner Muskel, der anspannen kann und das Haar aufstellt- eigentlich wie die „Gänsehaut“ beim Menschen). Das aufgestellte Fell speichert Luft, die vom Körper erwärmt wird und dient so der Isolation. Wenn das Pferd in kaltem Wind stehen muss, funktioniert das Prinzip natürlich nicht mehr, da die angewärmte Luft immer weggeblasen wird. Also brauch das Pferd, wenn es im Durchzug steht, mehr Energie, um seine Körperwärme zu halten. Von daher sieht man Offenstallherden bei eisigem Wind oft eng zusammen stehen, damit nicht alle im Wind stehen müssen.
Die Pferdehaut ist so druckempfindlich, dass ein Pferd jede Fliege auf einem Fell spüren kann. Ein Pferd kann dann, im Gegensatz zu uns, mit bestimmten Hautpartien zittern, um das Insekt zu verscheuchen.
Für die Praxis: Pferde zeigen ihre Zuneigung untereinander auch durch Berührung. Sei es der Nasenkontakt oder das Fellkraulen. Letzteres können wir durch das Putzen des Pferdes gut imitieren. So dient dieses dann nicht nur der Säuberung, sondern auch der Beziehungspflege.
Kurzer Hinweis zum Thema Putzen aus Sicht des Pferdes:
Sie mögen sich schlammig, wir sie sauber Bitte immer draußen putzen! Die Staubbelastung durch den Dreck im Fell und die herumfliegenden Haare ist sonst zu groß! Der Staub bleibt lange in der Luft. Bei Sonneneinstrahlung kann man das immer sehr gut erkennen, wie staubig die Luft ist. Das Putzen sollte nicht nur dazu genutzt werden, den Dreck vom Pferd zu bekommen, um es satteln zu können. Man sollte immer ganz bewusst das Pferd auf Verletzungen absuchen und kleinste Veränderungen registrieren. Das Putzen kann als Warm-up Massage genutzt werden, um die Muskulatur auf die Arbeit vorzubereiten. Für Pferde ist Putzen immer ein Zeichen von Zuneigung. Sie kraulen sich gegenseitig, um Freundschaften zu pflegen. Vielleicht kennen Sie selbst das ja auch? Eine Massage für den müden Partner, wenn er gestresst von der Arbeit kommt, um ihm etwas Gutes zu tun? Ein willkommenes Zeichen der Zuneigung…
Apropos: Pferde nutzen zur Partnerschaftspflege nicht nur kratzen, sondern auch Spielen, zusammen fressen oder Dösen. Aber nie wurden Pferdefreunde dabei beobachtet, dass sie sich gegenseitig irgendwie am Hals klopfen. Genauer gesagt, sind klopfende Bewegungen immer Tritte nach dem anderen.
Vielleicht sollten wir unser Lob für das Pferd beim Pferdeverhalten abschauen- würde doch Sinn machen, oder?
Auf den gesundheitsfördernden Aspekt beim Putzen und Massieren gehe ich im letzten Teil des Buches noch genauer ein.
Die Empfindsamkeit der Pferdehaut sollte man sich immer bewusst machen, wenn man das Pferd berührt. Sei es zum Loben (ist ein am Hals klopfen also sinnvoll als Lob?), oder der Schenkel-/Sporendruck zum Antreiben.
„Wenn ich mehr Druck brauche, als eine Fliege wiegt, ist das Pferd noch gegen mich!“
Allgemein:
Die Sinne des Pferdes arbeiten immer zusammen. Alle Sinne teilen ihm mit, wann es besser ist, zu fliehen. Wir konnten sehen, dass dies nicht unbedingt für uns Menschen voraussehbar sein muss, was einem Pferd Angst macht, da es vieles ganz anders wahr nimmt als wir.
Das Phänomen Wind: Ein eigentlich entspanntes, ruhiges Pferd ist an windigen Tagen schreckhafter. Warum? Es nimmt plötzlich Gerüche wahr, die sonst nicht da sind, Gerüche verschwinden aber auch schneller. Das Pferd hört plötzlich Geräusche, die aus der Ferne heran getragen werden. Außerdem überdeckt das Rascheln der Blätter eventuell das Geräusch eines heranschleichenden Raubtieres. Außerdem sieht das Pferd viel mehr Bewegungen, die es nicht einschätzen kann. Blätter bewegen sich, es fliegen Dinge herum, auf das Pferd zu. Und zu guter Letzt kühlt der Wind das Pferd aus, was im Winter nicht gut ist und gegebenenfalls durch mehr Bewegung wieder ausgeglichen werden muss.
Aus Sicht eines Pferdes müssen wir Menschen völlig unterentwickelt sein! Wir sind schwach, langsam, klein, können hinter uns nicht sehen, sind im Dunkeln nahezu blind, können nicht riechen, haben eine schlechte Körpersprache und sind quasi taub...
Pferde arbeiten nur aus Mitleid mit uns zusammen!
Die typische Pferdehaltung
So, nun, wo wir jetzt wissen, wie ein Pferd eigentlich ohne uns Menschen leben würde und was sein Leben eigentlich ganz grob von unseren Sinneseindrücken unterscheidet, wenden wir uns mal der Situation zu, wie ich sie in den 7 Monaten „Winter“ schon häufig erfahren habe:
Ich werde von einem ratsuchenden Pferdebesitzer angerufen, der mir ein Problem mit seinem Pferd schildert. Auf meine Rückfrage: „Wie wird das Pferd gehalten?“ bekomme ich häufig die Antwort:
„Mein Pferd steht den ganzen Tag draußen. Es kommt gegen 9h raus und wird erst um 17:30 wieder rein geholt.“ Dann frage ich (mich) immer: „Und was macht es die restlichen 15,5h???“ (Das ist wirklich schon lange, ich kenne auch Ställe, an denen die Pferde nur eine Stunde auf einen Einzelpaddock kommen und dann geht’s zurück in die Innenbox, ohne Paddock oder auch nur Fenster.)
Das ist KEIN KOMPLETTER TAG! Pferde schlafen noch nicht einmal 8h in der Nacht. Sie sind wach. Fast die ganze Zeit dann in der Box von vielleicht 12m2plus Paddock von 20m2. Dort sollen Sie sich dann ca. 30km bewegen können, wie ihr Körper es braucht, um gesund zu bleiben?
Der Paddock, auf dem sie tagsüber stehen, ist selten befestigt. Sie stehen also in der Matsche oder rutschen und bei Frost können sie nahezu nicht drauf laufen, ohne sich eine Bänder- oder Sehnenzerrung zu holen. Oder der Boden ist betoniert, was leider auch nicht zum Rennen animiert.
Dazu kommt, dass die wenigsten Pferde auf dem Paddock Heu bekommen, manchmal noch nicht einmal Wasser.
Diese Art der Pferdehaltung muss überdacht werden. Ein Pferd aus solcher Haltung macht häufig Schwierigkeiten im Umgang, da es dafür gemacht ist:
problemlos 50km am Tag zu laufen (dabei 5x Renngalopp, also von 0 auf 55km/ ohne sich 20 Minuten warm laufen zu müssen),
16-18 Stunden lang kleine Mengen zu fressen und
nur max. 30 Min am Stück insgesamt 4h pro 24h schläft. Und das auch nur, wenn ein anderes Herdenmitglied aufpasst.
Ein Pferd, dass immer in den Stall will, hat einfach gelernt, dass es dort etwas zu fressen bekommt und eventuell auch, dass es dann nicht ganz so langweilig ist, wie allein in der Matsche zu stehen...
Im Folgenden möchte ich auf die Probleme hinweisen, die aus dieser Pferdehaltung entstehen. (Auch wenn es ja „nur“ im Winter so ist. „Im Sommer ist der Stall toll! Da stehen Sie 12h auf der Weide“ Schade nur fürs Pferd, dass der Sommer nur vom 1.5.-30.9. dauert, also nicht mal ein halbes Jahr…)
Die Pferdeweide und sonstige Fütterung
Unsere Weiden sind in den letzten 40 Jahren immer artenärmer geworden! Heute kann man auf einer Pferdeweide keinen Blumenstrauß mehr pflücken! Die Reiter kennen kaum noch Wildblumen, die ihr Pferd problemlos fressen könnte. Alles Bunte scheint giftig zu sein. Sie haben Angst vor Jakobskreuzkraut, was auch berechtigt ist, aber dass dort auch nahezu nichts mehr wächst, was das Pferd braucht, weiß scheinbar fast Niemand. Auch das Heu ist logischerweise sehr artenarm und es fehlen somit viele Nährstoffe.
Die Pferde selbst haben ebenfalls teilweise verlernt, welche Pflanzen giftig sind und welche sie wann, bei welchem Problem, fressen sollten. Ihre Mutter konnte es Ihnen nicht mehr beibringen, weil auch Sie die Pflanzen nicht mehr kennen gelernt hat.
Die Futtermittelhersteller haben reagiert. Es gibt immer mehr Kraftfutter mit Kräuterzusätzen. Ob das Pferd aber jetzt genau diese Pflanze in der Natur fressen würde, in der Situation, ist fragwürdig...
Bei Problemen mit dem Pferd frage ich den Besitzer häufig: „Was bekommt dein Pferd zu fressen?“ Heu und Kraftfutter. Zwei extreme, aber wahre Beispiele die mir begegnet sind: Warmblüter, 550kg,6x pro Woche auf E/A- Niveau eine Stunde geritten (also ein Futterbedarf der eher der „Erhaltung“ zugerechnet werde sollte): 7kg Heu, Stroheinstreu, 2x2 kg Pellets.
Oder ein Kaltblut, ca. 650kg, Kinderreiten, also auch keine Arbeit, die mehr Energie verbraucht: ca. 4kg Heu, Spänebox, 2x ca. 2kg Müsli.
Das erste Pferd war verhaltensgestört, das zweite Pferd musste 3 Wochen nach meinem ersten Besuch wegen einer Kolik eingeschläfert werden, was sehr tragisch ist, mich aber nicht verwundert. Die von mir empfohlene Futterumstellung zugunsten von Rauhfutter kam wohl zu spät. Traurig finde ich, dass die Besitzerin ihr Pferd ja nicht selbst gefüttert hat. Es wurde vom Stallpersonal so gefüttert, wie sie es für richtig hielt. Niemand kam auf die Idee, ihr zu sagen, dass da etwas nicht stimmt.





























