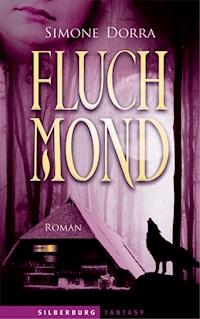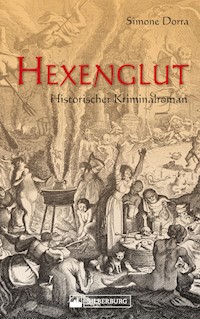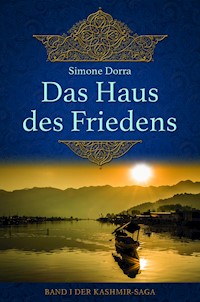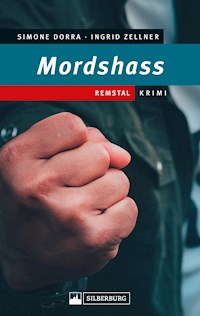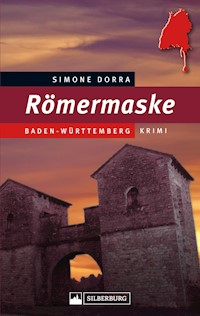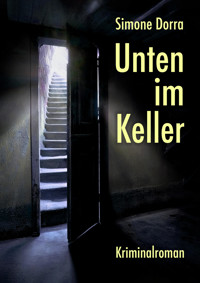
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als eine Leiche am Eppenzillfelsen auf der Schwäbischen Alb entdeckt wird, muss Kommissarin Sanna Schneider erst einmal die Identität des Toten herausfinden, bevor sie damit anfangen kann, nach seinem Mörder zu fahnden. Die Ermittlungen führen sie ungewollt in ihre traumatische Kindheit in einer brutalen Sekte zurück. Alte Alpträume werden wieder lebendig. Bringt sich Sanna durch ihre Nachforschungen selbst in Lebensgefahr?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
UNTEN IM KELLER
Für meinen Mann Kai, der mir immer schon den Rücken stärkt, der mich ermutigt und unterstützt – erst recht, seit ich 2013 zum ersten Mal die größenwahnsinnige Idee hatte, ein Buch zu schreiben. Danke für alles. Ich liebe dich.
Vorspiel: Morgen früh, wenn Gott will…
März, vor fünfundzwanzig Jahren
Das Schüsselloch kommt ihr vor wie ein böses, schwarzes Auge, das sie anstarrt. Sie starrt zurück, erfüllt von einer Mischung aus dumpfer Angst und Reue. Und obwohl sie es besser weiß, hofft sie verzweifelt auf das Geräusch des Schlüssels, der sich dreht.
Das letzte Mal hat es fast zwei Tage gedauert, bis der Hirte sie endlich herausgelassen hat. Fast achtundvierzig Stunden hat sie gewartet, von Hunger geplagt, den Mund ausgetrocknet.
Wie viele Stunden es diesmal schon sind, weiß sie nicht. Auch nicht, wie lange es gedauert hat, bis der Druck auf der Blase zu stark wurde, um ihn noch länger auszuhalten. Als es nicht mehr ging, hat sie an der Rückwand des Kellers hastig den Rock hochgezogen, die Unterhose hinuntergestreift und sich erleichtert. Jetzt riecht der Keller nicht nur nach Schimmel und nach ihrem Schweiß, sondern auch noch durchdringend nach Urin.
Sie schämt sich, und sie ekelt sich vor sich selbst. Das Gefühl ist ihr so vertraut, dass sie sich nicht im Geringsten darüber wundert. „Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen“, hat der Hirte mit seiner tiefen, klangvollen Kanzelstimme zitiert, bevor die Kellertür zufiel, „und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten.“
Sie weiß, sie ist schlecht. Sündig. Verloren. Sie hat es oft genug von ihm gehört.
Inzwischen muss er ihr das nicht einmal mehr sagen. Das Echo hallt ständig in ihrem Kopf wider, jedes einzelne Wort so endgültig, als wäre es in Stein gemeißelt. Für Hoffnung bleibt da kein Platz. Dass sie sich jemals wirklich ändern kann, dass sie irgendwann Gnade vor seinen Augen findet und wieder aufgenommen wird in die Gemeinschaft, daran glaubt sie schon lange nicht mehr. Gott wird ihr erst recht nicht gnädig sein. Sie ist eine Ausgestoßene, gefesselt durch die Stricke der Sünde, von denen sie es noch nie geschafft hat, sich zu befreien.
Hinter dem kleinen, schmierigen Kellerfenster schwindet das Tageslicht. Bald wird es ganz dunkel sein. Dass die Lampe an der Decke ihr nichts nützt, weiß sie schon; es gibt zwar einen Schalter, aber die Birne ist kaputt. Sie streckt sich auf dem Boden aus, dicht an der untersten Stufe der Treppe, und schließt die Augen.
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht.“
Darüber hat der Hirte am letzten Sonntag gepredigt. Eigentlich predigt er immer über die Sünde; er hat kein anderes Thema. „Ich dachte immer, Gott ist die Liebe“, hat sie einmal zu ihm gesagt. „Warum erzählst du uns nie was davon? Warum will Gott uns dauernd bestrafen?“
Er hat sie unter seinen schweren Lidern angestarrt. „Der Mensch ist böse von Jugend auf“, hat er nach einer langen, bedeutungsschwangeren Pause geantwortet. „Und du bist da leider keine Ausnahme, mein fehlgeleitetes Kind.“
Wenige Tage danach ist sie zum ersten Mal im Keller gelandet. Damals hat sie sich noch gewehrt. Zwei Brüder haben mit anpacken müssen, um sie die Stufen hinunter zu schleifen, und sie haben alle Mühe gehabt, sie zu bändigen. Sie hat sich stundenlang heiser geschrien und von innen mit beiden Fäusten an die Tür getrommelt. Sie hat dagegen getreten, hysterisch vor Panik, das Gesicht nass von Tränen und Rotz.
Fast ein Jahr ist das jetzt her. Inzwischen hat sie es aufgegeben, sich zu wehren, wenn sie wieder hier hinunter muss, und schreien tut sie auch nicht mehr.
Während die Müdigkeit immer größer wird, treiben Bilder vor ihrem inneren Auge vorbei, und plötzlich liegt sie wieder in ihrem Bett zuhause – jedenfalls dort, wo sie einmal zuhause war, bevor ihre Eltern den Hirten kennengelernt und sich seiner Gemeinschaft angeschlossen haben. Ihre Mutter sitzt neben ihr auf der Bettkante, lächelt sie an und hält ihre Kinderhand. „Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt“, singt die warme, vertraute Stimme. Bei Mama hat sie sich immer sicher gefühlt, sicher und geliebt. Aber Mama ist nicht mehr da.
Sie leckt sich die trockenen Lippen. Sie ist so müde. So entsetzlich müde. Sie will nur noch schlafen.
Bevor sie wegdämmert, regt sich ein Gedanke in ihrem Kopf. Er ist beängstigend und gleichzeitig auf surreale Weise tröstlich.
Vielleicht will Gott ja gar nicht, dass sie morgen früh wieder aufwacht.
Kapitel 1: Die Leiche
„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod.“(Römer 6, Vers 23)
Fiiiieeep. Fiiiieeep. Fiiiieeep.
Sanna Schneider fuhr im Bett hoch, die Augen noch fest geschlossen. Was…? Sie spürte, wie die Wolldecke, die sie am Vorabend zusätzlich über ihr dickes Daunenbett gebreitet hatte, herunterrutschte. Sie schlief fast immer unter mehreren Schichten, weil sie so leicht fror.
Fiiiieeep. Fiiiieeep.
Sie blinzelte. Hinter dem Fenster gegenüber von ihrem Bett, das nach Westen hinausging, war der Himmel von einem dämmerigen Graublau. Neben ihr auf dem Nachttisch blinkte das Display ihres Handys leuchtend grün. Sie langte seufzend danach, hob es ans Ohr und zog gleichzeitig die Daunendecke bis unter das Kinn hoch.
„Schneider…?“
„Guten Morgen – ich bin’s, Fritz.“ Die Stimme ihres Kollegen klang aufreizend munter. „Ich werf dich wirklich nur sehr ungern aus dem Bett, aber ich fürchte, wir haben hier einen Leichenfund.“
Sanna gähnte und warf einen Blick auf die Anzeige ihres Radioweckers. Viertel vor sieben. Scheibenkleister. Warum musste sie auch ausgerechnet am Samstag Bereitschaft haben.
„Wo ist ,hier‘?“
„Am Eppenzillfelsen. Wenn du ,Wanderparkplatz Eppenzill‘ in dein Handy eingibst, kannst du…“
„Ich weiß, wo das ist. Ich war schon ein paarmal da, okay?“
Sie rieb sich die Augen. Fritz, der keine zehn Kilometer von hier aufgewachsen war, glaubte auch nach ihren ersten sechs Monaten in der neuen Dienststelle immer noch, dass sie ohne seine Hilfe hoffnungslos die Orientierung verlor.
„Gib mir zwanzig Minuten.“
***
Mit dem Wagen brauchte sie bis zum Wanderparkplatz eine Viertelstunde. Sie stieg aus, schloss das Auto ab und schaute sich um. Ein Tisch mit zwei Bänken am Ende der Wiese, die sich zum Waldesrand hinabsenkte, war von einer Gruppe Menschen in bunter Outdoorbekleidung und mit Wanderstöcken umlagert. Dazwischen versuchte ein Polizist in Uniform offensichtlich, sich Gehör zu verschaffen. Sanna stapfte durch das struppige Gras rasch auf die Gruppe zu.
„Sie können uns hier nicht festhalten!“ Älterer Mann, Mitte fünfzig, Metallrandbrille, Wollmütze. Er sah aus wie ein aufgebrachter Studienrat und klang auch so.
„Niemand hält Sie hier fest. Wir müssen nur Ihre Personalien aufnehmen, dann dürfen Sie gehen.“ Der Polizist, der einen aufgeklappten Notizblock in der einen und einen Kuli in der anderen Hand hielt, bemühte sich hörbar um Geduld. Als er Sanna entdeckte, verzog sich sein Gesicht zu einem erleichterten Lächeln. „Frau Schneider? Von der Kripo Reutlingen?“
Sanna nickte.
Er deutete zum Wald hinüber. „Die Kollegen warten schon auf Sie. Unten am Felsen.“
„Danke.“
Sie tauchte in den Schatten der Bäume ein, tastete sich mit dicksohligen Trekkingstiefeln den rutschigen Pfad zwischen Steinen und Wurzeln entlang den Abhang hinab und trat wenige Minuten später aus dem Wald ins Freie.
Vor ihr breitete sich unter dem Absturz des Eppenzillfelsens das Maisental aus, nach dem Regen der vergangenen Tage saftig grün. Waldflächen türmten sich in der Tiefe auf wie die reglosen Wellen eines riesigen Ozeans; links unterhalb von ihr rauschten die Uracher Wasserfälle in die Tiefe, rechts von ihr leuchtete auf der anderen Talseite der Granit einer aufragenden Bruchwand nackt und weiß in der blassen Morgensonne. In wenigen Wochen würden die zahllosen Baumkronen sich spektakulär bunt verfärben, aber auch so war der Ausblick atemberaubend.
Allerdings war sie hier und heute zu abgelenkt, um ihn zu genießen.
Zwei KTU-Techniker in weißen Schutzanzügen waren damit beschäftigt, auf dem felsigen Steilhang Beweise zu sammeln. Neben dem breiten, geschwungenen Liegestuhl, den man hier zum Ausruhen für die Besucher aufgestellt hatte, beugte sich Dr. Ingeborg Renken offenbar über das Opfer; Sanna war der Tübinger Rechtsmedizinerin während der letzten Monaten ein paarmal begegnet und konnte sie gut leiden.
Von ihrer Warte aus war von der Leiche nur ein Arm zu erkennen.
„Da bist du ja!“
Ihr Kollege Friedrich Aschenberg kam auf sie zugestakst, wobei er sorgsam darauf achtete, den Technikern nicht in den Weg zu geraten.
„Furchtbar wenig Platz hier. Wer immer den armen Kerl dahinten auf dem Gewissen hat, hätte sich wirklich eine andere Stelle aussuchen können.“
„Echt rücksichtslos.“ Sanna grinste ihn flüchtig von der Seite an, schob sich an ihm vorbei und blieb nach ein paar behutsamen Schritten auf dem schlüpfrigen Felsen endlich stehen.
Vor ihr, dicht neben der Bank, lag ein junger Mann. Sein dunkles Haar war kurz, zerzaust und nass vom Tau. Er trug eine Sweatjacke mit halb heruntergezogenem Reißverschluss, genauso zerknittert und fleckig wie das T-Shirt darunter. Die Füße steckten in Tennissocken und schmutziggrauen Sneakern. Weit offene Augen starrten aus einem bleichen, schmalen Gesicht leer in den wolkenlosen Morgenhimmel.
Sanna runzelte die Stirn. „Haben wir eine Todesursache?“
„Kann gut sein.“ Dr. Renken legte beide Hände um das Gesicht des Toten und drehte es sachte zur Seite. „Schauen Sie mal.“
Erst jetzt wurde die tiefe Wunde am Hinterkopf sichtbar. Blut war daraus auf den felsigen Untergrund getropft. Sanna bückte sich und betrachtete die Rinnsale, die hinabgelaufen waren; es waren nicht so viele, wie sie erwartet hatte.
„Er ist nicht hier niedergeschlagen worden, oder?“
„Richtig, Frau Schneider.“ Dr. Renken nickte. „Das ist vermutlich da drüben passiert. Da haben wir eine größere Blutlache gefunden.“
Sie deutete nach links zum Waldrand hinauf, wo einer der Techniker gerade eine Bodenprobe in einen kleinen Plastikbeutel fallen ließ.
„Aber dort ist er nicht liegen geblieben“, sagte Fritz hinter ihr. „Der Mörder hat ihn neben die Bank geschleppt. Vielleicht wollte er ihn über den Felssturz runterwerfen – aber dazu hat ihm die Zeit nicht mehr gelangt. Eine Wandergruppe kam nämlich durch den Wald getrampelt, um hier ganz früh ein paar Stimmungsfotos zu knipsen, und die hat ihn gestört. Also hat er sein Opfer da gelassen, wo es war und ist abgehauen.“
Sanna drehte sich rasch zu ihm um. „Die Leute auf der Wiese neben der Picknickbank? Haben die ihn gesehen? Können die ihn beschreiben?“
„Leider nicht.“ Fritz schüttelte bedauernd den Kopf. „Er hat sich seitlich in die Büsche geschlagen, und mehr als einen Schatten und das Knacken und Krachen von ein paar abgerissenen Ästen haben die kaum mitbekommen. Sie wissen nicht einmal wirklich, wie er aussah… falls das wirklich der Mörder war. Vielleicht hat er ihn einfach als Erstes gefunden, und als er die Gruppe gehört hat, ist er vor Schreck geflüchtet.“ Er räusperte sich. „Oder es war eine sie. Alles möglich.“
„Da kann man wohl nichts machen.“ Sanna wandte sich wieder der Leiche zu und betrachtete sie. „Anfang, Mitte Zwanzig, würde ich sagen. Oder vielleicht noch jünger. Was meinen Sie, Dr. Renken?“
„Könnte sein.“ Die Pathologin richtete sich auf. „Aber Genaueres kann ich Ihnen natürlich erst sagen, wenn ich ihn bei mir auf dem Tisch habe. Ich ruf Sie an, wenn ich mit dem Bericht fertig bin. – Papiere hat er übrigens keine bei sich. Auch kein Handy.“
Also hatten sie erst einmal überhaupt keinen Anhaltspunkt, wer der Mann war. Das wurde wirklich immer besser.
Sanna warf einen letzten Blick auf das weiße, leblose Gesicht, wandte sich ab und fing an, den steilen Weg zum Waldrand wieder hinaufzuklettern. Fritz holte sie ein und tippte ihr auf die Schulter.
„Was hältst du davon, wenn ich dir einen Kaffee spendiere?“
Sanna seufzte dankbar. „Eine ganze Menge.“
***
Der Anruf kam schon am selben Abend um sechs – offenbar war Sanna nicht die Einzige, die an diesem Wochenende Dienst schob. Sie setzte sich ins Auto und war eine Stunde später im Universitätsklinikum Tübingen.
Das Büro von Dr. Renken war klein, hell und sehr aufgeräumt. Vor ihr auf dem Schreibtisch lag eine Klarsichtmappe mit dem Bericht, den sie Sanna früh morgens versprochen hatte.
Sanna ließ sich auf dem Besucherstuhl nieder. „Sie sind schnell.“
„Heute schon.“ Die Rechtsmedizinerin lächelte. „Ich hatte dieses Wochenende nichts Größeres vor, und mein Assistent zum Glück auch nicht. Ich dachte mir, dass Sie so schnell wie möglich die ersten Fakten haben möchten.“
„Worauf Sie sich verlassen können.“ Sanna beugte sich vor. „Und was sind die ersten Fakten?“
Dr. Renken schlug die Klarsichtmappe auf und fuhr mit der Fingerspitze den ausgedruckten Text hinunter. „Die Calvaria ist mit einem stumpfen Gegenstand zertrümmert worden; das dürfte ziemlich unmittelbar zu seinem Tod geführt haben.“
Sanna erinnerte sich an die klaffende Wunde und presste die Lippen zusammen. „Alles klar.“
„Sie dachten, er wäre Anfang Zwanzig oder jünger, erinnern Sie sich? Das war ganz gut geschätzt – die Wachstumsfuge zwischen Brust- und Schlüsselbein ist geschlossen, also ist er wahrscheinlich mindestens zwanzig und höchstens vierundzwanzig Jahre alt. Er hat kurz vor seinem Tod noch etwas getrunken. In seinem Magen befanden sich knapp 400 ml Kirschsaft – und der war mit etwa so viel Barbiturat versetzt, wie es in drei oder vier Schlaftabletten passt.“
Dr. Renken machte eine kurze Pause und überflog den Text.
„Die Leber ist unauffällig, also würde ich vor der weitergehenden histologischen Untersuchung nicht von irgendwelchem Drogenmissbrauch ausgehen... abgesehen von dem Barbiturat im Saft, wobei ich annehme, dass man ihm das heimlich verabreicht hat. Aber auf der Haut von Armen und Beinen befinden sich mindestens ein Dutzend Hämatome und mitten im rechten Humerus eine Splitterfraktur; er könnte entweder Prügel bezogen haben oder schwer gestürzt sein.“
Verprügelt. Gestürzt. Viele blaue Flecken. Ein gebrochener Oberarm. Nichts im Magen außer Saft mit Schlafmittel. War er vor seinem Tod misshandelt worden? Hatte man ihn danach betäubt, um ihn leichter umbringen zu können?
„Die Körpertemperatur Ihres Unbekannten habe ich schon am Fundort gemessen“, fuhr die Rechtsmedizinerin fort. „Wenn man die Tageszeit und seine relativ dünne Bekleidung mit einbezieht, war er wahrscheinlich leicht unterkühlt; ich denke, wir können trotzdem sicher sein, dass er ziemlich unmittelbar vor seinem Auffinden durch diese Wandergruppe gestorben ist. Minimale Schleifspuren haben die Kollegen von der KTU nur zwischen der Stelle mit dem ersten Blutfleck und der Liegebank gefunden, aber nirgendwo auf dem Weg durch den Wald. Möglicherweise ist er aus seiner Betäubung aufgewacht und war gerade noch munter genug, um mit etwas Hilfe oder Zwang die letzten paar Meter zum Felsen selbst hinunter zu stolpern… aber nicht genügend bei Bewusstsein, um sich zu wehren. Vielleicht hat Ihr Kollege außerdem recht mit seiner Vermutung, dass die Tatperson ihr Opfer vom Eppenzillfelsen in die Schlucht werfen wollte. Bei dem Schaden, den die Leiche bei diesem Sturz genommen hätte, wäre es uns verdammt schwergefallen, noch festzustellen, welche der Verletzungen er sich post mortem und welche er sich ante mortem zugezogen hat. Wir wären vielleicht zunächst von einem tragischen Unfall ausgegangen.“
Pech für den Mörder.
„Am besten wenden wir uns als Nächstes an die Presse und die Sozialen Medien“, sagte Sanna. „Wir brauchen ein Bild von ihm; hoffentlich erkennt ihn jemand.“
„Schon erledigt.“ Dr. Renken blätterte den Bericht um, zog ein einzelnes Blatt heraus und reichte es über den Tisch. „Hier.“
Es war der schwarzweiße Ausdruck einer Aufnahme von Kopf und Hals des Unbekannten. Diesmal waren die Augen geschlossen und das wirre, dunkle Haar ordentlich zurückgekämmt. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, dass er schlief. Auf den zweiten nicht mehr.
„Sehr gut.“ Sanna wusste, dass sie nicht darum bitten musste, die Aufnahme digital zugeschickt zu bekommen; wahrscheinlich hatte sie die E-Mail mit der Datei bereits auf dem Diensthandy. „Sie sagen mir Bescheid, was bei der histologischen Untersuchung herauskommt?“
„Natürlich. Den vorläufigen Bericht schicke ich Ihnen auch gleich – und dann mach ich endlich Feierabend.“
Dr. Renken öffnete eine Schublade vor sich und zog eine E-Zigarette heraus. Sie sog kräftig daran und blies eine Dampfwolke, die verblüffend süß nach Kaffee und Karamell duftete, in Richtung Bürodecke. Dann registrierte sie Sannas hochgezogene Augenbrauen und grinste schief.
„Ich hab vor zwei Monaten mit dem Rauchen aufgehört“, sagte sie. „Das hier ist so eine Art Notlösung, bis ich’s endlich schaffe, die Finger ganz vom Nikotin zu lassen.“
„Was immer Ihnen hilft.“ Sanna stand auf und drückte ihr die Hand. „Danke – und genießen Sie den Rest vom Wochenende.“
„Sie auch.“
***
Eine Stunde später war Sanna wieder zu Hause.
Als sie vor sechs Monaten aus Nordrhein-Westfalen hergezogen war, hatte sie ihre Wohnung in einem kleinen Weiler zwanzig Kilometer hinter Reutlingen überraschend schnell gefunden, durch einen Tipp ihres neuen Kollegen. Sie befand sich unter dem Dach eines zweigeschossigen Fachwerkhauses mitten im Dorf, mit einer geradezu lächerlich idyllischen Aussicht auf den Marktplatz mit zwei riesigen, alten Kastanienbäumen und einem Brunnen aus dem 18. Jahrhundert. Das Haus hatte noch zweihundert Jahre mehr auf dem Buckel, die Decken im Obergeschoss waren niedrig und die Wände stellenweise ein wenig schief, aber Sanna verliebte sich auf der Stelle in die drei verwinkelten Räume mit den kleinen, überdachten Fenstern, in denen es immer ein wenig nach längst erloschenen Herdfeuern roch. Sie waren genau der Rückzugsort, den sie gesucht hatte.
Außer ihrem breiten Boxspringbett (dessen Transport die schmale Stiege hinauf selbst zerlegt für die Umzugsleute eine echte Herausforderung gewesen war) hatte sie nur die allernötigsten Möbel mitgebracht; Dekogegenstände und Bilder für die Wände besaß sie keine. In Münster hatte sie ihr kleines Appartement in einem Mietshaus am Stadtrand höchstens zum Übernachten genutzt. Die Schneider ist so karrieregeil, die schläft doch sogar im Büro, hatten die Kollegen gelästert. Irgendwo im Aktenschrank hat sie wahrscheinlich eine Luftmatratze versteckt.
Damals hatte sie den Tratsch stoisch ignoriert. Und heute spielte das alles sowieso keine Rolle mehr.
Sanna stand in ihrem Wohnzimmer, einen Becher mit heißem Tee in beiden Händen. Sie nippte vorsichtig daran und schaute durch das Fenster auf den Brunnen hinunter. Das Wasser glitzerte in der tiefstehenden Abendsonne, und eine Mutter hinderte einen Dreikäsehoch im Anorak daran, eine Handvoll Kastanien in das Becken zu werfen. Jetzt im Frühherbst purzelten sie überall aus den Baumkronen und lagen auf dem Kopfsteinpflaster herum.
Sie dachte an die verlegene Bemerkung der Rechtsmedizinerin über die „Notlösung“ und zog eine Grimasse.
Sie selbst hatte nie geraucht oder als Teenager jemals irgendeine von den Drogen ausprobiert, mit denen Jugendliche oft aus Neugier herumexperimentierten. Drogen sind schlechte Krücken, mein Mädchen, hatte ihre Pflegemutter immer gesagt. Du glaubst, du kannst dich darauf stützen, bis du wieder selbst laufen kannst – aber irgendwann wirst du ohne diese Krücken überhaupt nicht mehr laufen können. Und genau das macht sie so gefährlich.
Sanna hatte sich lange daran gehalten, weil sie wusste, dass es stimmte. Dass es eine Zeit gegeben hatte, in der sie die eigenen, ehernen Grundsätze vergaß, weil der Druck so groß geworden war, dass sie es ohne schlechte Krücken nicht mehr aushielt – daran wollte sie nicht mehr denken. Auch das war vorbei. Sich von der Vergangenheit beherrschen zu lassen, machte keinen Sinn; mit der Gegenwart hatte sie schon genug am Hals.
Sie stellte fest, dass sie fror. Rasch trank sie die Teetasse leer, trug sie in die winzige, altmodische Küche hinüber, deren Möbel sie beim Einzug gleich mitgemietet hatte und stellte sie in die Spüle. Das wachsbleiche Gesicht auf dem Schwarzweißfoto ging ihr immer noch nicht aus dem Kopf.
Wer war dieser Mann?
***
Am Montag wurde das Bild des unbekannten Toten im Lokalteil sämtlicher Tageszeitungen in fünfzig Kilometer Umkreis von Reutlingen veröffentlicht. Auf der Facebook-Seite Blaulichtreport Reutlingen und Region und in den Nachrichten des Reutlinger Polizeipräsidiums erschien das Bild ebenfalls, mit einer kurzen Zusammenfassung, wann und unter welchen Umständen man den Mann aufgefunden hatte, dazu eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, die man anrufen sollte, wenn man ihn erkannte.
Bis Dienstagabend tröpfelten eine Handvoll Hinweise von diversen Mitbürgern herein, die sich zu erinnern glaubten, dem Opfer irgendwo auf dem Markt oder in einem Geschäft begegnet zu sein (oder wenigstens jemandem, der ihm einigermaßen ähnlich sah). Diese Hinweise waren allerdings zu vage, um ernsthaft nützlich zu sein, und kein einziger Anrufer hatte wirklich eine Ahnung, wer der Mann war.
Am Mittwochmorgen klingelte auf Sannas Schreibtisch das Telefon. Am anderen Ende war der Beamte von der Pforte.
„Hier ist eine junge Frau, die Angaben zu Ihrem unbekannten Opfer machen will“, sagte er. „Sie sagt, sie ist möglicherweise mit ihm verwandt. Würden Sie sie abholen?“
„Klar.“ Sanna knallte den Hörer auf die Gabel und warf Fritz, der ihr gegenüber saß, einen triumphierenden Blick zu. „Sieht ganz so aus, als hätten wir endlich Glück.“
Sie eilte aus dem Büro, durch eine Flucht von Fluren, in denen sie sich in den ersten Wochen seit ihrer Versetzung aus Münster immer wieder verlaufen hatte, und durch das Treppenhaus hinunter zum Haupteingang.
Dort stand vor der Pförtnerloge die junge Frau, die der Beamte angekündigt hatte – mittelgroß, schlank und sehr gerade in einem tiefroten, hüftlangen Wollcape und engen, schwarzen Jeans, eine mit bunten Herbstblättern bestickte Baskenmütze auf dem Kopf. Dunkles Haar quoll darunter hervor und fiel in weichen Wellen rings um ein schmales, blasses Gesicht, aus dem große, haselnussbraune Augen Sanna anstarrten. Sanna schätzte sie auf Mitte oder Ende Zwanzig.
Sanna streckte ihr die Hand entgegen. „Grüß Gott, ich bin Kriminalkommissarin Sanna Schneider. Und Sie sind — ?“
„Emily Behrens.“ Die junge Frau sprach schnell und nervös. „Ich hab das Bild in der Zeitung von gestern gesehen – vor einer halben Stunde, die letzten zwei Wochen war ich gar nicht zuhause. Ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und hab erst mal ausgepackt, wissen Sie? Aber nachdem ich vorhin einen Blick in die Zeitung geworfen und das Bild entdeckt hab…“ Sie brach ab und holte tief Atem. „Ich bin sofort hergefahren.“
Sie hatte eine angenehme Altstimme, und im Gegensatz zu den meisten Kollegen und den Menschen in der Gegend, die Sanna bisher kennengelernt hatte, sprach sie kein Schwäbisch, sondern Hochdeutsch.
„Jetzt kommen Sie erst mal mit“, sagte Sanna freundlich. „Über alles andere reden wir in meinem Büro, okay?“
Emily Behrens nickte und folgte ihr den langen Weg zurück an ihren Arbeitsplatz, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Sanna konnte sich sehr gut in ihre Situation hineinversetzen, weil sie das hier nicht zum ersten Mal erlebte: plötzliche Panik, wenn man davon ausgehen musste, dass einem geliebten Menschen etwas unvorstellbar Schreckliches zugestoßen war, gefolgt von der ängstlichen Hoffnung, dass das Ganze – vielleicht, irgendwie – doch keine Katastrophe war, sondern ein bedauerlicher Irrtum. Nach dem man erleichtert durchatmen und sein Leben weiterleben konnte, als sei überhaupt nichts geschehen.
Im Büro rückte sie der Besucherin einen Stuhl zurecht, und Fritz stellte ungefragt ein kleines Tablett mit einem Keramikbecher Kaffee, Zuckertütchen und Milch vor sie hin. Emily Behrens nickte ihm dankbar zu, goss sich Milch in den Becher und ließ den Zucker liegen. Sie trank einen großen Schluck und stellte den Becher ab.
„Das Bild in der Zeitung war… es war ziemlich körnig“, sagte sie. „Haben Sie vielleicht ein besseres hier, und könnte ich es sehen?“
„Natürlich.“
Sanna schlug den Bericht der Rechtsmedizinerin auf, der seit Montagmorgen auf ihrem Schreibtisch lag, holte den Ausdruck des Schwarzweißfotos heraus und reichte ihn ihr. Die junge Frau betrachtete es lange und schweigend, dann ließ sie den Kopf hängen und ihre Schultern sackten nach vorne.
„Ja“, sagte sie leise. „Ich kenne ihn. Das ist Adrian. Mein … mein Bruder. Adrian Behrens.“
„Sind Sie sicher?“
„Ganz sicher.“ Sie brach nicht in Tränen aus, aber der Kummer und die Verzweiflung, die plötzlich von ihr ausstrahlten, trafen Sanna wie ein eisiger Winterhauch. „Wir sind achtzehn Jahre lang gemeinsam aufgewachsen. Das ist Adrian, ohne jeden Zweifel.“
Sanna fiel ein, was Emily Behrens unten an der Pforte gesagt hatte, und sie runzelte die Stirn.
„Sie haben eben erwähnt, Sie wären zwei Wochen im Urlaub gewesen. War Ihr Bruder vorher schon weg? Oder ist er erst verschwunden, nachdem Sie abgereist sind?“
„Nein.“ Emily Behrens schnaubte leise. „Er ist schon viel länger weg als bloß zwei Wochen.“
Sie zog eine fast leere Packung Papiertaschentücher aus ihrem Wollcape und putzte sich kräftig die Nase.
„Ich habe Adrian seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Und ich hab die meiste Zeit keinen Schimmer gehabt, wo er abgeblieben ist – bis heute.“
Kapitel 2: Entfremdung
„Woher kommen die Kämpfe unter euch, und woher die Streitigkeiten?“ (Jakobus 4, Vers 1)
Fritz öffnete entgeistert den Mund und schloss ihn wieder, ohne etwas zu sagen. Sanna musterte ihre Besucherin scharf, mindestens so verblüfft wie ihr Kollege.
„Fünf Jahre? Wie kommt denn das?“
„Da müsste ich ein bisschen weiter ausholen.“ Emily Behrens seufzte. „Und ich fürchte, das dauert.“
Sanna faltete die Hände vor sich auf dem Schreibtisch. „Machen Sie sich keine Gedanken darüber. Wir haben Zeit.“
„Mein Bruder… Adrian ist… er war vier Jahre jünger als ich“, erklärte Emily Behrens. „Früher haben wir uns immer sehr gut vertragen; er war ein schüchternes, dünnes Kerlchen und hat sich buchstäblich vor seinem eigenen Schatten gefürchtet. Natürlich haben die aus seiner Klasse das mitgekriegt. So ein ängstliches Kind wird zum Opfer, fast immer.“
„Ich weiß.“ Sanna fuhr leicht zusammen. Und ob sie das wusste.
„Er hat sich nie getraut, zu Hause was zu sagen… und als ich es zufällig mitbekommen hab, hat er mir kategorisch verboten, meiner Mutter davon zu erzählen“, fuhr Emily fort. „Also hab ich ihn selbst beschützt. Ich war schon mit zwölf ziemlich kräftig, mit einer Eins in Schwimmen und Sport. Und wenn seine Mitschüler ihm mal wieder auf dem Heimweg aufgelauert haben, bin ich dazwischen gegangen und hab sie verdroschen.“
„Echt jetzt?“ Sanna grinste unwillkürlich.
„Echt jetzt.“ Emily Behrens grinste zurück, dann wurde sie wieder ernst.
„Erst später ist es wirklich schwierig geworden. Ich hab zwei Jahre in Freiburg Medizin studiert, aber dann bin ich zurück nach Hause; unsere Mutter hatte Multiple Sklerose, und in dieser Zeit hat sie körperlich immer mehr abgebaut. Also hab ich hier in der Nähe eine Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen. Mama ist kurz nach meiner Abschlussprüfung gestorben, sechs Monate, bevor Adrian mit der Schule fertig war. Er hat die ganzen Jahre zuschauen müssen, wie sie immer schwächer geworden ist… das war nicht schön. Und ihr Tod hat ihn auch ordentlich mitgenommen.“
„Kann ich mir vorstellen“, sagte Fritz leise.
Kurz vor Sannas Versetzung nach Reutlingen war seine Mutter einem langen, schweren Krebsleiden erlegen. Sie warf ihm einen kurzen, mitfühlenden Blick zu und vermied es sorgsam, an ihre eigene Mutter zu denken.
„Das Ganze hat ihn aus der Bahn geworfen. Er hat sich total hängen lassen, hat auch nicht mehr für das Abitur gelernt – und natürlich ist er durchgerasselt. Die Schule wusste Bescheid über unsere Situation. Die haben ihm alle Türen offengehalten, ihm gleich mehrere Angebote gemacht – aber das hat alles nichts genützt. Er hat sich verschlossen wie eine Auster, und niemand ist mehr an ihn herangekommen. Mama war nicht mehr da, und unser Vater hat einen tödlichen Unfall gehabt, da war Adrian gerade erst geboren. Plötzlich war ich ganz allein für ihn verantwortlich, und darauf war ich trotz allem nicht vorbereitet.“
Emily starrte auf ihre Hände hinunter; Sanna sah, dass sie am linken Mittelfinger einen Ring mit Schmucksteinen trug, angeordnet wie ein Regenbogen.
„Unser Elternhaus hatten wir gemeinsam geerbt, und das war gottlob schuldenfrei. Aber ich musste unbedingt schnell eine Stelle finden, damit wir weiterhin was zu essen hatten und die Rechnungen bezahlen konnten. Und während ich das versucht hab, saß mein Bruder zuhause herum, konnte mit sich und seinem Leben nichts anfangen und tat sich selbst furchtbar leid.“
Zu Emilys Bestürzung beschloss Adrian Behrens, seine Abiturprüfung nicht zu wiederholen; stattdessen verließ er die Schule und schlug sich mit verschiedenen Aushilfsjobs durch. Sie selbst hatte sich in einer Reha-Klinik in Bad Urach beworben und wurde eingestellt. Obwohl die Arbeit anspruchsvoll war, kam sie gut zurecht, aber die Lage zuhause verbesserte sich nicht, im Gegenteil. Wenn sie mit ihrem Bruder über seine unsichere Zukunft reden wollte, kam es jedes Mal zum Streit.
„Ich hab in der Zeit ein paar kurze Beziehungen gehabt – kein Wunder, ich wollte endlich mal wieder in den Arm genommen werden“, sagte Emily Behrens müde. „Ein bisschen Wärme, was zum Festhalten, verstehen Sie? Ich hab genauso getrauert wie Adrian, und ich hatte es gründlich satt, immer die Starke sein zu müssen.“
Sie senkte den Kopf und drehte den bunt glitzernden Ring an ihrer Hand hin und her.
„Mein Bruder fand diese lockeren Affären furchtbar; er hat mir vorgeworfen, ich würde mich aufführen wie eine Schlampe. Und als ich mich dann das erste Mal richtig verliebt hab, wurde es ganz übel.“
„Wieso das denn?“ Fritz musterte sie mit hochgezogenen Augenbrauen. „Wie alt war Ihr Bruder da – achtzehn? So verklemmt kann er doch gar nicht gewesen sein!“
„Er war neunzehn, und reichlich durcheinander“, meinte Emily Behrens nüchtern. „Vielleicht hat er, nachdem Mama nicht mehr lebte, Angst gehabt, mich auch noch zu verlieren. Aber wer weiß – vielleicht hätte ihm das Ganze ja weniger ausgemacht, wenn die ein, zwei Affären, mit denen ich ins Bett gegangen bin, keine Frauen gewesen wären – und der Kollege, mit dem ich zum ersten Mal was Ernsteres angefangen hab, keine Kollegin.“
Sie schaute Sanna geradewegs in die Augen. Ihr Blick war offen, fast herausfordernd, und Sanna spürte, dass ihre Kopfhaut kribbelte.
„Ihr Bruder war homophob?“, fragte sie.
„Er war… religiös“, erwiderte Emily Behrens. „Bis zum Tod von Mama ist er regelmäßig bei uns zuhause zur Kirche in den Gottesdienst gegangen, und jede Woche auch in eine Jugendgruppe. Nach Mamas Beerdigung hat er sich dort nicht mehr blicken lassen. Ich hab mit dem Glauben nicht so viel am Hut, aber ich muss zugeben, die haben wirklich versucht, ihm zu helfen. Sie haben immer wieder angerufen und sind sogar ein paarmal vorbeigekommen; nach ein paar Monaten hat das aber aufgehört.“
Sie zögerte, und es dauerte eine Weile, bis sie weitersprach.
„Dann hab ich eines Tages Frauke – das war meine Kollegin – mit nach Hause gebracht. Da waren wir schon einen Monat zusammen, und sie hat zum ersten Mal bei mir übernachtet. Als wir am nächsten Morgen beim Frühstück saßen, ist Adrian genau in dem Moment runtergekommen, als Frauke mir einen Kuss gegeben hat. Er bekam einen Tobsuchtsanfall und hat uns beiden eine fürchterliche Szene gemacht. – Zwei Tage später war er weg, mit nichts als einer kleinen Reisetasche.“
Sie schnitt eine Grimasse.
„Frauke war dann auch sehr bald weg. Adrians Theater ist ihr heftig unter die Haut gegangen, und sie hat nicht verstanden, wieso ich alles versucht hab, um ihn zu finden. ,Sei doch froh, dass du diesen heuchlerischen kleinen Arsch los bist‘, hat sie gesagt. Aber ich war nicht froh. Ich hab mir Vorwürfe gemacht. Und ich wollte unbedingt wissen, wo er war, und ob es ihm gut ging.“
Adrian Behrens war nach seinem Verschwinden telefonisch nicht mehr zu erreichen gewesen; das gesamte Geld auf seinem Sparbuch – knapp zweitausend Euro – war abgehoben worden, und Emily vermutete, dass er sich ein neues Handy gekauft hatte. Seine E-Mail-Adresse behielt er allerdings bei, und anfangs schrieb sie ihm täglich, obwohl lange Zeit keine Antwort kam. Sie gab sogar eine Vermisstenmeldung auf, die allerdings ins Leere führte, weil sie schlichtweg keine Ahnung hatte, wohin er sich gewandt haben mochte. Nach sechs Monaten kompletter Funkstille meldete er sich plötzlich per E-Mail bei ihr und teilte ihr in einer – ausgesprochen wortkargen – Nachricht mit, er sei in Karlsruhe und es ginge ihm gut. Emily wartete darauf, dass er den Kontakt wieder intensivieren würde, aber nachdem kein weiteres Lebenszeichen mehr folgte und ihre zahlreichen ängstlichen Nachfragen wieder ohne Reaktion blieben, gab sie diese Hoffnung auf.
„Vor drei Jahren hat er mir dann mitgeteilt, er wäre jetzt in der Nähe von Tübingen. Kaum dreißig Kilometer entfernt von unserem Elternhaus. Ich dachte wirklich, er kommt wieder heim. Aber das ist nicht passiert. Eineinhalb Jahre später hab ich zum letzten Mal von ihm eine E-Mail bekommen. Kein persönlicher Text, nichts – nur eine Bibelstelle: Psalm 1, Vers 1. Ich hab’s nachgeschlagen… mit Versöhnung hatte der Text nichts zu tun. Da hab ich begriffen, dass er mich wirklich nicht wiedersehen will.“
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen.
Die vertrauten Worte hallten in Sannas Kopf wider wie das schrille Heulen einer Alarmsirene. Sie schloss rasch die Augen, und erst, als Fritz sich neben ihr vernehmlich räusperte, begriff sie, dass Emily Behrens etwas zu ihr gesagt hatte. Sie versetzte sich innerlich einen kräftigen Tritt.
„Wie bitte?“
„Ich würde meinen Bruder gern sehen. Ist das möglich?“
Sanna nickte. „Natürlich. Haben Sie jemanden, der Sie begleiten kann?“
„Nein.“
„Sind Sie mit dem Auto hier?“
„Leider nein. Mein Wagen hat auf der Heimfahrt vom Urlaub zu zicken angefangen. Irgendwas mit dem Vergaser. Er steht seit gestern Abend in der Werkstatt; ich bin mit dem Bus da.“
„Wenn Sie möchten, bringe ich Sie hin“, sagte Sanna. „Lassen Sie mich kurz die Rechtsmedizinerin anrufen, damit sie weiß, dass wir kommen. Inzwischen geben Sie meinem Kollegen Ihre persönlichen Daten – und am besten auch die E-Mail-Adresse Ihres Bruders, damit wir einen Ausgangspunkt haben, wo wir ansetzen können. Und danach können wir fahren.“
Emily Behrens musterte sie erstaunt, dann verzog sich ihr Gesicht zu einem blassen Lächeln.
„Dankeschön.“
***
Eine Stunde später waren sie in Tübingen. Sanna parkte ihren Wagen auf dem Patientenparkplatz des Uniklinikums und wartete darauf, dass Emily Behrens den Gurt ablegte und ausstieg. Aber die tat keines von beidem; sie blieb reglos sitzen. Auch das war Sanna nicht neu.
„Haben Sie es sich anders überlegt?“, fragte sie. „Das wäre kein Problem. Sie haben Ihren Bruder bereits eindeutig auf dem Foto identifiziert, Sie müssen das hier nicht machen.“
Emily Behrens starrte durch die Windschutzscheibe und schwieg. Sanna wartete geduldig.
„Doch, muss ich“, kam es endlich leise, aber entschlossen. „Das vorhin in Ihrem Büro war bloß ein Bild. Ich muss ihn sehen. Ich muss wissen, dass es wahr ist.“
„Das verstehe ich.“ Sanna nickte. „Ich kann mitkommen – wäre das für Sie in Ordnung?“
„Ja.“ Wieder dieses blasse Lächeln. „Ja, es wäre in Ordnung. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen.“
„Schon gut.“
Emily Behrens ging stumm neben Sanna her durch das Klinik-Foyer, stand neben ihr im Aufzug, während der zum Untergeschoss hinabfuhr und folgte ihr durch den langen Korridor, der zum Büro der Rechtsmedizinerin führte. Die Tür stand offen, und Dr. Renken kam hinter ihrem Schreibtisch hervor.
„Emily Behrens?“
Die nickte ruckartig; ihre Augen waren ängstlich geweitet. Sanna verzichtete trotzdem darauf, ihr nochmals den Rückzug anzubieten. Emily hatte mehr als deutlich gemacht, weswegen sie glaubte, sich das hier antun zu müssen.
„Kommen Sie bitte mit.“
Sanna ging in kleinem Abstand hinter den beiden her, sah zu, wie die Rechtsmedizinerin mit Emily in der Pathologie verschwand und trat nach kurzem Zögern hinter ihnen ein.
Alle stählernen Tische waren makellos sauber, das Arbeitswerkzeug gnädig außer Sichtweite verstaut. Der Raum hätte genauso gut ein neutrales Chemielabor sein können, wäre da nicht der penetrante Leichengeruch gewesen, der trotz aller Desinfektionsmittel und Filtersysteme in der Luft hing – und die stille Gestalt auf der Metallbahre, bedeckt von einem weißen Laken. Dr. Renken legte Emily kurz und beruhigend eine Hand auf die Schulter, dann trat sie an die Bahre heran und schlug das Laken zurück.
Es war das dritte Mal, dass Sanna Adrian Behrens nach seinem gewaltsamen Tod zu Gesicht bekam. Wieder einmal wunderte sie sich darüber, wie schnell ein Mensch, aus dem endgültig das Leben gewichen war, sich veränderte. Der junge Mann, der vor wenigen Tagen tot auf dem Eppenzillfelsen gelegen hatte, kam ihr plötzlich vor wie eine künstliche Wachsfigur. Es fiel ihr schwer, sich vorzustellen, dass er einmal geatmet, dass er gelacht und geweint, dass er Pläne gemacht hatte. Oder dass er außer sich vor Wut auf seine Schwester losgegangen war, weil sie Frauen liebte.
Emily Behrens stand Sanna genau gegenüber, auf der anderen Seite der Bahre. Sie betrachtete die Leiche ihres Bruders minutenlang, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Dann trat sie einen Schritt vor und legte eine Hand auf seine nackte Brust – genau über der dunklen Linie der groben, ypsilonförmigen Naht, wo Dr. Renken die Leiche geöffnet hatte.
„Addi….“, sagte sie leise. „Ach, mein Kleiner. Du dummer, dummer Junge.“
Sie zog die Hand zurück, berührte die farblose Stirn und strich ihm durch das Haar. Dann schloss sie die Augen und biss sich auf die Lippen. Sanna und Dr. Renken wechselten einen kurzen, vorsichtigen Blick; sie hatten beide ausreichend Erfahrung mit der Reaktion von Angehörigen auf die unabänderliche Realität des Todes, um notfalls helfend einzugreifen.
Aber Emily Behrens weinte nicht, und sie brach auch nicht zusammen. Stattdessen beugte sie sich leicht vor, nahm die Enden des weißen Lakens und deckte ihren Bruder wieder zu – so sanft, als hätte sie ihn gerade ins Bett gebracht. Sie sah Dr. Renken an.
„Danke“, sagte sie schlicht. Dann wandte sie sich an Sanna. „Ich würde jetzt gerne gehen. Ich möchte nach Hause.“
***
Draußen hatten sich die Wolken, die schon den ganzen Morgen über der schönen, alten Universitätsstadt hingen, überraschenderweise verzogen, und die Sonne schien von einem dunstig blauen Himmel. Emily Behrens blieb vor dem Eingang des Uniklinikums stehen und holte erleichtert Luft. Dann drehte sie sich zu Sanna um, das Gesicht blass und verlegen.
„Ich weiß, Sie haben heute meinetwegen schon reichlich Aufwand betrieben – aber würden Sie mich zum Bahnhof bringen? Von da aus kann ich den Bus nehmen.“
„Wo wohnen Sie denn?“
„In Ehendingen.“
„Ehendingen?“ Sanna stellte fest, dass sie trotz der ernsten Umstände lächelte. „Dafür brauchen Sie keinen Bus. Ich kann Sie mitnehmen – ich wohne da nämlich auch.“
„Wirklich?“
„Wirklich. In einem alten Fachwerkhaus direkt am Marktplatz, seit einem halben Jahr.“
Emily Behrens blickte verblüfft drein, fast ein bisschen erfreut. „Dann sind wir Nachbarn! Na ja… fast. Mein Elternhaus steht hinter dem Ortsausgang Richtung Reutlingen. Die ehemalige Mühle. Kennen Sie die?“
Sanna kannte sie tatsächlich. Sie kam jeden Morgen bei der Fahrt zum Dienst daran vorbei – ein schmuckes, altes, weiß verputztes Gebäude mit einem Sockel aus grauen Feldsteinen, einem dunklen Holzbalkon und einem Krüppelwalmdach. Es lag etwas abseits der Straße an einem rasch dahinfließenden Nebenlauf der Lauter, der vermutlich früher das Mühlrad in Gang gehalten hatte.
„Aber sicher. Soll ich Sie hinbringen?“
„Macht Ihnen das auch wirklich nichts aus?“
„Gar nicht. Außerdem können Sie mir bei der Gelegenheit gleich das Zimmer Ihres Bruders zeigen – falls es das noch gibt – und mir noch etwas mehr von ihm erzählen. Je mehr wir über ihn wissen, desto leichter wird es vielleicht sein, herauszufinden, wo er sich zuletzt aufgehalten hat.“
Emily Behrens verschränkte die Arme vor der Brust; ihre haselnussbraunen Augen wurden dunkel.
„Mit dem Zimmer haben Sie Pech“, sagte sie brüsk. „Über drei Jahre hab ich es so gelassen, wie es ist… weil ich doch immer gehofft hab, dass er wieder zurückkommt. Aber nach dieser letzten E-Mail – der mit dem Bibelvers – da hab ich es komplett ausgeräumt. Ich dachte, wenn er alle Brücken hinter sich abbrechen und mich aus seinem Leben ausradieren kann, dann kann ich das auch.“
Nicht doch.
„Haben Sie nur das Zimmer ausgeräumt?“, erkundigte sich Sanna. „Oder haben Sie gleich tabula rasa gemacht und seine Sachen weggeworfen?“
„N… nein.“ Emilys blasses Gesicht rötete sich leicht. „Das wollte ich zwar, aber ich hab es dann doch nicht übers Herz gebracht. Ich hab alles in eine Kiste gepackt und auf den Dachboden geschleppt. Und seitdem staubt das Zeug zu, während ich mir alle Mühe gebe, zu vergessen, dass es noch da ist.“
„Ich hätte einen Vorschlag“, meinte Sanna. „Wenn wir in Ehendingen und in Ihrem Haus sind, holen wir die Kiste herunter, laden sie in meinen Kofferraum und ich nehm sie mit. Dann haben die Kollegen die Möglichkeit, alles in Ruhe durchzusehen – und Sie sind den ganzen Krempel los. Ob Sie ihn wiederhaben wollen, können Sie später immer noch entscheiden. Aber vielleicht sind ja auch ein, zwei Dinge dabei, die für Sie doch noch irgendeinen Wert haben. Als gute Erinnerung an Ihren Bruder, meine ich.“
„Komisch, dass Sie das sagen.“ Wieder einmal drehte Emily Behrens an ihrem Ring. „Als ich eben da drin vor dieser Bahre stand und ihn gesehen hab… da hatte ich das Gefühl, das wäre gar nicht er. Nicht mehr. Und stattdessen ist mir wieder eingefallen, wie er als ganz kleiner Junge gewesen ist. Da hat er an mir geklebt wie eine Klette. Er musste unbedingt immer da sein, wo ich war, auch wenn ich das damals ziemlich lästig gefunden hab. Aber es war auch irgendwie süß. Er hatte am Anfang Probleme, seinen eigenen Namen richtig auszusprechen. Also hat er Addi daraus gemacht, das war einfacher. Mich hat er Milly genannt.“ Sie schluckte heftig. „Addi mit Milly geh’n, hat er immer gesagt.“
Plötzlich kamen ihr die Tränen. Sie blinzelte und tastete fahrig in der Tasche ihres Wollcapes herum. „Mist… ich hab vorhin mein letztes Tempo aufgebraucht. Hätten Sie vielleicht…“
Sanna nickte und reichte ihr kommentarlos eines der Stofftaschentücher, die sie für Notfälle immer bei sich trug. Dann schloss sie ihren Wagen auf und rutschte hinter das Steuer.
„Was halten Sie davon: Ich fahr Sie heim, schlepp die Kiste alleine ins Auto und Sie kochen mir dafür einen Kaffee?“
Emily Behrens öffnete die Beifahrertür, setzte sich neben sie und trocknete sich die Augen. „Klingt wie ein guter Plan.“
Sie hielt inne und sprach erst nach einer kleinen, befangenen Pause weiter.
„Tut mir leid. Ich wollte Ihnen nichts vorheulen.“
„Ihr Bruder war fünf Jahre lang verschwunden, und jetzt ist er tot“, antwortete Sanna ruhig. „Es hätte mich viel mehr gewundert, wenn Sie mir nichts vorgeheult hätten.“
„Wollen Sie Ihr Taschentuch wiederhaben?“
So wie sie Emily Behrens einschätzte, würde sie es noch ein paarmal brauchen. Und ganz bestimmt nicht nur heute.
„Behalten Sie’s.“
Kapitel 3: Spurensuche
„Wer das Recht liebt, verabscheut die Rechtsbrecher. Wer das Unrecht liebt, verabscheut die Rechtschaffenen.“(Sprüche 29, Vers 27)
Herauszufinden, wo sich Adrian Behrens in den fünf Jahren nach seinem Verschwinden aufgehalten hatte, erwies sich als reine Fleißarbeit. Nach den Angaben seiner Schwester gingen Sanna und ihre Kollegen davon aus, dass sie in Karlsruhe mit der Suche anfangen mussten, und dass der junge Mann drei Jahre später irgendwo in der Nähe von Tübingen gelandet war. Also wandten sie sich an die entsprechenden Einwohnermeldeämter und baten um Auskunft; außerdem war der E-Mail-Account von Adrian noch aktiv, auch wenn sich darauf in letzter Zeit nichts mehr getan hatte.
„Komischer Vogel“, meinte Fritz. „Wie kann jemand geschlagene zwei Jahre keine einzige E-Mail mehr schreiben? Sonst war er scheinbar auch nicht online unterwegs. Kein Facebook-Account, nicht auf Twitter oder Instagram oder sonst irgendeiner Plattform… mit dem Internet hat er wohl kaum was am Hut gehabt.“
Sanna grinste ironisch in ihre Kaffeetasse.
„Das kannst du dir nicht vorstellen, was? Und dabei bist doch du derjenige, der mir ständig geharnischte Vorträge darüber hält, wie gefährlich es ist, zu viel Zeit in der digitalen Welt zu verbringen.“
„Weil es eine Parallelwelt ist!“, versetzte Fritz prompt. In seinen Augen leuchtete es so kriegerisch, als wäre er drauf und dran, auf sein liebstes Steckenpferd zu steigen und loszugaloppieren. „Wer nur noch durch Social Media mit anderen Menschen kommuniziert…“
„... der vergeudet sein Leben, ich weiß“, beendete Sanna den Satz für ihn. „Im Fall von Adrian Behrens wäre ein bisschen mehr Internet-Präsenz aber ganz hilfreich gewesen. Dann müssten wir uns nämlich nicht auf E-Mails verlassen, die er vor Jahren mal an irgendwen geschickt hat und hoffen, dass dabei irgendein brauchbarer Hinweis herauskommt.“
Zum Glück fanden sie Hinweise, wenn auch zunächst nicht viele. So, wie es aussah, hatte Adrian zwei Monate nach seiner überstürzten „Abreise“ von daheim bei einer Karlsruher Spedition angefangen – nicht als Fahrer (er hatte keinen Führerschein), sondern als Lagerarbeiter. Die Spedition gehörte einem Mann namens Bruno Pfisterer, der Werkzeuge aus Süddeutschland nach Polen, in die Tschechische Republik und die Slowakei lieferte. Adrian hatte für ihn unzählige Pappkartons in die Laster geladen und an Hilfsarbeiten erledigt, was gerade anfiel; sein neuer Chef hatte ihm freundlicherweise eine winzige Mansardenwohnung im Dachgeschoss des Gebäudes überlassen, wo sich die Büros der Spedition befanden.
„Netter Junge“, sagte Pfisterer, als Sanna am Telefon mit ihm sprach. „Sehr fleißig, aber auch sehr still, wissen Sie? Freunde hat er hier kaum welche gehabt, glaube ich – falls überhaupt. Und der Lockdown während der Pandemie hat es ihm bestimmt noch schwerer gemacht, welche zu finden. Leider war er ungelernt, deswegen konnte ich ihm nur wenig zahlen. Dafür hab ich ihm aber keine Miete abgenommen.“
Knappe zwölf Monate war Adrian in Karlsruhe und in der kleinen Wohnung geblieben. Die E-Mails aus dieser Zeit konnte man an einer Hand abzählen, und keine davon ging an irgendwelche privaten Kontakte außerhalb der Firma. Am Ende der halbstündigen Unterhaltung fiel dem Spediteur aber noch ein kleines Detail ein, das ihnen weiterhalf: Um das magere Gehalt aufzubessern, das er von Pfisterer bekam, hatte Adrian, als der Lockdown im Mai 2020 etwas abgemildert wurde, zusätzlich nach Feierabend und an den Wochenenden in einem Burgerrestaurant gejobbt. Und bevor er verschwunden war, hatte es in genau diesem Burgerrestaurant gebrannt.
Das wurde Sanna von den Karlsruher Kripo-Kollegen bestätigt, die freundlicherweise bereit gewesen waren, sie vor Ort zu unterstützen. Im Moment waren sie damit beschäftigt, den Hintergrund der Spedition und ihres Besitzers zu durchleuchten, um festzustellen, ob er wirklich der selbstlose Menschenfreund war, als der er sich darstellte, oder ob er doch vielleicht Dreck am Stecken hatte.
Und dann meldete sich noch am selben Tag ein weiterer Karlsruher Kollege bei ihr, ein Hauptkommissar namens Frank Steinhaus – erst per Mail und kurz danach auch telefonisch. Zu Sannas Überraschung war er Ermittler bei der Karlsruher Drogenfahndung. Und er kannte Adrian Behrens persönlich.
„Ihr Opfer und der junge Mann, dem ich hier vor ziemlich genau viereinhalb Jahren zum ersten Mal begegnet bin, sind ein und derselbe“, sagte er. „Sie suchen nach jemandem, der Grund gehabt haben könnte, Adrian Behrens ans Leder zu wollen? Ich fürchte, ich hab da ein handfestes Motiv für Sie.“
Sanna beugte sich gespannt vor. „Ich bin ganz Ohr.“
„In dem Burgerschuppen, wo sich Behrens was dazuverdient hat, gab es nicht nur Fastfood, müssen Sie wissen“, erklärte er. „Da wurden auch Drogen vertickt. Der Franchise-Nehmer steckte bis zum Hals in der Sache drin. Abends kam immer dasselbe Dutzend Leute und erhielt mit seinen Menüs zusätzlich ein paar Plastiktütchen mit Ecstasy-Pillen in ihre Pappschachteln. So blöd, das Zeug direkt vor Ort an die Konsumenten zu verkaufen, sind die natürlich nicht gewesen. Sie haben in der Stadt an den einschlägigen Plätzen damit gedealt.“
„War Adrian Behrens darin verwickelt?“, fragte Sanna. Es fiel ihr schwer, sich das vorzustellen, aber sie hatte im Dienst schon viel erstaunlichere Dinge erlebt, als dass ein sittenstrenger, junger Mann auf die schiefe Bahn geriet.
„Nein, war er nicht“, erwiderte der Kollege. „Er hat irgendwann einmal mitgekriegt, wie sein Chef die Tütchen in die Schachteln gemogelt hat und sich die Sache nach und nach zusammengereimt. Dann hat er beschlossen, etwas zu unternehmen.“
„Was hat er getan?“
„Er ist zu uns gekommen“, meinte Steinhaus. „Wie gesagt, das war vor viereinhalb Jahren. Er hat uns von seinen Beobachtungen erzählt. Wir hatten zwar schon länger den Verdacht, dass in dieser Burgerbraterei irgendwas Unsauberes lief, aber was Handfestes haben wir nicht gehabt – bis zu dem Tag, an dem Adrian Behrens in mein Büro marschiert kam. Danach hatten wir endlich einen Hebel, mit dem wir ansetzen konnten. Es wurde eine ziemlich große Sache daraus, und der Junge hat sich damit ein paar ziemlich gefährliche Feinde gemacht.“
„Es gibt doch bestimmt eine Akte dazu“, meinte Sanna. „Können Sie mir die zur Verfügung stellen?“
„Klar kann ich“, erwiderte Steinhaus. „Und wenn Sie mich ab sofort auf dem Laufenden halten, dann haben wir hoffentlich beide was davon.“
Sanna versprach es ihm, legte auf und schüttelte verblüfft den Kopf.
Also war Adrian Behrens einem Drogenring in die Quere geraten. Das war doch nicht zu fassen.
***
Eine halbe Stunde später hatte Sanna die fragliche Akte auf dem Bildschirm. Sie klickte sich geduldig durch mehr als dreißig Seiten Text, Vernehmungsprotokolle und digitalisierte Fotos und staunte über das ungeahnte Drama, das sich da vor ihren Augen entfaltete. Mit dieser Geschichte im Hintergrund bekam der Mord an Adrian Behrens eine komplett neue Dimension.
Sie legte sich gerade Block und Kugelschreiber zurecht, um die Akte ein zweites Mal durchzusehen und sich Notizen zu machen, als die Bürotür aufschwang und Fritz hereinkam. Er sah ziemlich schlecht gelaunt aus.
„Handwerker!“, knurrte er. „Straßenräuber sind das. Erst wartet man wochenlang darauf, dass sie endlich kommen, und dann ziehen sie einem das letzte Geld aus der Tasche!“
Er war seit über einem Jahr damit beschäftigt, gemeinsam mit seinem Vater sein Elternhaus gründlich zu renovieren. An den Wochenenden machte er selbst all die Arbeiten, die für seinen alten Herrn zu mühsam waren und für die er keine Fachleute brauchte. Klempnern konnten sie allerdings alle beide nicht, und sein Vater hatte heute Vormittag einen Arzttermin gehabt; deshalb war Fritz notgedrungen auf der heimischen Dauerbaustelle geblieben.
Sanna lächelte in sich hinein. Trotz seiner Vorliebe für eine gewisse Kleidermarke mit gesticktem Krokodil und einem Hang zu kostspieligen Restaurantbesuchen blieb ihr Kollege in Bauangelegenheiten ein typischer Schwabe.
„Ich hab Neuigkeiten für dich“, sagte sie. „Und die könnten uns wirklich ein gutes Stück weiterbringen. Stell dir vor – unser vermisster und ermordeter Junge ist in Karlsruhe unversehens über einen Drogenring gestolpert! Nicht bei seinem eigentlichen Arbeitgeber – so, wie es bis jetzt aussieht, war der ein anständiger Kerl, hat ihm Job und Unterkunft gegeben und ihm so gut unter die Arme gegriffen, wie er konnte. Aber weil Adrian Behrens von dem Minigehalt, das der Mann ihm gezahlt hat, nicht wirklich leben konnte, ist er auf die Suche nach einer weiteren Verdienstmöglichkeit gegangen – und im Lauf der Zeit musste er feststellen, dass es dort nicht mit rechten Dingen zuging. Die haben mit Ecstasy gedealt.“
„Wow.“ Fritz ließ sich auf seinen Schreibtischstuhl fallen. „Woher weißt du denn das alles?“
„Von einem Kollegen in Karlsruhe. Der hat mir gleich die ganze Akte geschickt, und die hat es in sich.“
Denn Adrian Behrens hatte der Drogenfahndung nicht nur von seinem Verdacht erzählt, er hatte sich obendrein freiwillig bereit erklärt, die Dinge weiterhin an Ort und Stelle im Auge zu behalten und herauszufinden, woher der kriminelle Burgerbrater seine Ware bezog. Frank Steinhaus war zwar sehr daran interessiert gewesen, die Lieferwege der Drogen nachzuvollziehen, und auch, von wem genau sie gekauft wurden, aber er hatte sich zunächst kategorisch geweigert, diesem abenteuerlichen Plan zuzustimmen.
„Kann ich mir vorstellen“, bemerkte Fritz trocken. „Was hat der Kleine denn gedacht, wer er ist – ein beinharter Undercover-Ermittler? Für so was braucht man jahrelanges Training, und er hat ja nicht mal das Abitur geschafft!“
Sanna war während ihrer Zeit in Münster zwei oder drei ausgesprochen fähigen Undercover-Ermittlern ohne Abitur oder Studium begegnet, aber sie hatte keine Lust, sich mit Fritz auf eine Diskussion einzulassen. Stattdessen schaute sie wieder auf den Bildschirm.