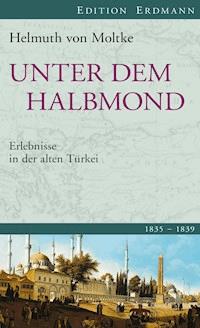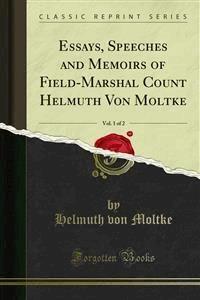Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der preußische Generalfeldmarschall Helmuth Karl Bernhard von Moltke war an der Schlacht von Nizip gegen die Türkei beteiligt. Die Jahre und Erlebnisse im Osmanischen Reich hatte der Feldherr in "Unter dem Halbmond" aufgezeichnet und der Nachwelt erhalten, die er in die Lage versetzt, ein längst vergangene Zeit und Kultur hautnah zu erleben. Spannend und unterhaltend, vielschichtig und tiefgründig, informativ und faszinierend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmuth von Moltke
Unter dem Halbmond
1. Besuch beim Pascha von Neu-Orsowa – Reise durch die Walachei – Bukarest
Bukarest, den 25. Oktober 1835
Dicht unterhalb von Alt-Orsowa taucht aus den Fluten des Donaustroms ein Eiland empor, das eine türkische Festung trägt. Die Österreicher, die sie erbaut, tauften sie Neu-Orsowa; die Türken eroberten den Platz und obwohl seitdem ihre Grenzen von den Karpaten bis zum Balkan zurückgedrängt wurden, haust noch heute ein Pascha in Ada-Kalessi, der Inselfestung. Weit hinausgeschoben zwischen christliche Länder ragt hier ein letztes Minarett empor, von dem die Verehrung des Propheten verkündet wird, und die Türken, die von ihrem eigenen Grund und Boden, aus Serbien und der Walachei, verbannt sind, finden auf jener Insel eine Zuflucht.
In Begleitung eines Zoll- und eines Gesundheitsbeamten wurde meinem Reisegefährten, dem Baron von Bergh, und mir erlaubt Sr. türkischen Exzellenz einen Besuch abzustatten. In fünfzehn Minuten waren wir da.
Osman Pascha empfing mit viel Freundlichkeit zwei Fremde, die aus dem fernen Lande »Trandeburg« (Brandenburg) kamen. Er ließ uns Kaffee reichen und Pfeifen und gestattete uns seine Festung zu besehen. Der Pascha ist ein stattlicher Herr mit dickem rotem Bart, aber so unbeschreiblich schlecht logiert, wie bei uns kein Dorfschulze. Sein Palast ist ein Bretterschuppen. Trotz der empfindlichen Kälte saßen wir in einem halb offenen Gemach ohne Fensterscheiben. Unnötigerweise hatten wir einen Frack angezogen, während Se. Exzellenz in zwei bis drei Pelzen, einer größer und weiter als der andere, erschien.
In der Stadt überraschte uns die Unreinlichkeit der engen Straßen. Die Anzüge der Männer waren rot, gelb, blau – kurz, von den schreiendsten Farben, aber alle zerlumpt. Die Frauen schlichen tief verhüllt wie Gespenster umher. Alle Wohnungen trugen Spuren des Verfalls und an der Festung ist, glaub ich, seit der Besitznahme kein Ziegel ausgebessert.
Am 31. Oktober setzten wir unsere Reise durch die Walachei fort. Wenn mein Urteil über dies Land nicht sehr günstig ausfällt, so muss ich ehrlicherweise bemerken, dass ich nur den noch in dem letzten Feldzug furchtbar verwüsteten Teil gesehen habe. Vielleicht sind die nördlichen Gegenden besser. Dabei durchzogen wir diese Einöde während eines mehrtägigen unausgesetzten Regens und es war ein Glück für mich die mühevolle Reise wenigstens in angenehmer Gesellschaft zu machen.
Wir hatten uns in Orsowa einen Leiterwagen gekauft, denn die walachischen Fuhrwerke sind wie Kinderwagen, nicht über zwei Fuß vier Zoll hoch, und so kurz und eng, dass kaum ein Mensch darin sitzen kann, führte er auch so wenig Gepäck mit sich wie wir. An dem ganzen Wagen ist nicht das kleinste Stück Eisen; Nabe, Achse, alles aus Holz. Ebenso wenig darf man irgendeine Art von Metall an dem Pferdegeschirr suchen. Wir fanden die Flüsse so angeschwollen, dass das Wasser bis in unseren großen Wagen trat, und gratulierten uns, nicht noch zwei Fuß niedriger zu sitzen. Unsere Karosse galt aber als eine voiture monstre, ein großes Gefährt, in der Walachei; man spannte uns acht Pferde vor, und an schwierigen Stellen noch einige Büffel. Wo es der Weg gestattete, da ging es in schnellem Galopp und unter lautem Schreien der Postillione davon, die ohne Sattel auf den kleinen Pferden saßen und fast die Erde mit den Beinen berührten. Das Rufen benachrichtigt schon von weitem die Poststation und wenn man in den umzäunten Hof fährt, stehen die neuen Pferde bereit.
Der Regen goss unaufhörlich vom Himmel und mein Hut war so durchweicht, dass ich ihn aus dem Wagen warf. In Crajowa mussten wir, um unsere Pelze zu trocknen, zum Bäcker schicken, und erhielten sie, wie eine Art Backwerk, halb verbrannt zurück. In den Dörfern fand man nichts, weder Essen noch Trinken, noch Nachtquartier. Selbst die Postämter sind elende Hütten oder nur Höhlen in der Erde, mit einem Dach aus Zweigen überdeckt. Von einer solchen Armut hatte ich bisher keine Vorstellung.
Nicht wenig erfreut waren wir in Bukarest ein Gasthaus zu finden. Seit Orsowa hatten wir keins gesehen.
Obwohl wir uns fast unter dem gleichen Breitengrad mit Genua befinden, wo ich mich vorigen Jahres um diese Zeit des schönsten Sommers erfreute, so ist hier doch schon alles in tiefem Winter erstarrt. Wir durchstreifen indes die Stadt, die Kasernen und die Salons und rüsten uns zur Reise nach Konstantinopel.
In Bukarest erblickt man die elendsten Hütten neben Palästen im neuesten Stil und alten Kirchen von byzantinischer Bauart; die bitterste Armut zeigt sich neben dem üppigsten Luxus und Asien und Europa scheinen sich in dieser Stadt zu berühren.
2. Zustand der Walachei – Die Spuren langer Knechtschaft – Konsulate – Geringe Einwirkung der Regierung auf das Land – Vergleich mit Serbien
Die Walachei ist seit fünf Jahren erst in die Reihe christlicher Länder getreten, und wenn dies zwar unter der Bedingung einer doppelten Abhängigkeit geschah, so hat sie doch das Recht erlangt ihre innere Verwaltung nach eigenem Ermessen zu regeln.
Die Physiognomie dieses Landes trägt die furchtbarsten Spuren einer langen Knechtschaft. Zur Hälfte noch in Trümmern und Schutthaufen liegen die Städte ohne Mauern, ohne Tore, denn jede Gegenwehr war bisher Verbrechen gewesen. Nachdem der Widerstand sich so oft fruchtlos gezeigt, nachdem er so oft verderblich geworden war, dachte der Walache an keine andere Rettung mehr als an die Flucht. Sobald eine türkische Schar über die Donau herangezogen kam, entwich, wer etwas zu verlieren hatte, in die Wälder nach Ungarn oder nach Siebenbürgen.
Von dem zum Ackerbau geeigneten Boden ist kaum der fünfte Teil bestellt und so gleicht denn dieses Land in der Tat nur einer weiten Wüstenei, einer Wüstenei freilich, die nur auf fleißige Menschenhände wartet, um jede Mühe überschwänglich zu lohnen.
Der Walache hat von seinem Vater gelernt, nie mehr anzubauen, als gerade ausreicht sein Leben kümmerlich zu fristen; ein Mehr wäre nur die Beute seiner Machthaber oder seiner Feinde gewesen. Gewohnt, sich mit dem Allergeringsten zu begnügen, kennt er keine der tausend Bedürfnisse anderer Nationen, scheut die Dürftigkeit nicht so sehr wie die Arbeit, den Zwang der Gesittung mehr als das Elend der Barbarei. Die Walachen sind ein auffallend schöner, großer Menschenschlag; ihre Sprache ist eine Tochter der römischen und noch heute der italienischen ähnlich. Aber das türkische Joch hat dieses Volk völlig geknechtet. Die Waffen sind ihm lange schon fremd geworden, es ergibt sich in jede Forderung. Jeder wohl gekleidete Mann imponiert dem Walachen, er hält ihn für völlig berechtigt ihm zu befehlen und Dienstleistungen von ihm zu verlangen. Nie wird man einen Walachen danken sehen, selbst wenn ein Geschenk alle seine Erwartungen übersteigt, aber ebenso stillschweigend nimmt er auch Misshandlungen hin; er hält es für unklug, seine Freude und seinen Schmerz zu verraten. Dagegen findet man ihn stets heiter, wenn er in einer elenden Erdhöhle am mächtigen Feuer seine durchnässten Lumpen trocknen, einen Maiskolben rösten oder gar eine Pfeife rauchen kann.
So viele unserer Landsleute wandern aus, um sich in fremden Weltteilen ein besseres Dasein zu gründen, und so wenige versuchen es aus dieses reichen Landes Quellen zu schöpfen, wo jede Arbeit ihren Lohn finden müsste, wenn nur Schutz und Sicherheit des Eigentums vorhanden wären.
Man hat in den Hauptrichtungen durch das Land Postverbindungen hergestellt und der Reisende wird in der günstigsten Jahreszeit äußerst schnell, aber auch äußerst unbequem befördert. Allein, da für Straßen und Brücken bis jetzt auch noch nicht das Allermindeste geschehen ist, so grenzt es fast an Unmöglichkeit, sich nach anhaltendem Regen in diesem schweren Lehmboden von einem Ort zum anderen zu bewegen. Die Flüsse, die von den Karpaten herabstürzen, füllen dann ihre breiten Betten in der Ebene und unterbrechen jeden Verkehr. Mit der Wegbarkeit sieht es in diesem Land noch sehr schlecht aus; Straßen gibt es nicht, die Donau zieht nur an der Grenze entlang und die Flüsse, die ihr zuströmen, sind nicht schiffbar und auch kaum schiffbar zu machen.
Man staunt, in dieser Wüstenei eine Stadt wie Bukarest mit fast 100 000 Einwohnern zu finden. In Bukarest gibt es Palais, Gesellschaften und Visiten, Theater, marchandes de mode, Zeitungen und Equipagen; aber so wie man den Fuß vor das Tor setzt, versinkt man in Barbarei. Man hat eine Gesellschaft von Naturforschern und eine Musterwirtschaft gegründet, aber selbst der Anbau der Kartoffel ist in der Walachei noch nicht eingeführt. In der Stadt sieht man den Hof, aber im Lande die Regierung nicht.
Serbien bildet in vielen Beziehungen das Gegenstück zur Walachei. In Serbien gibt es weder Bojaren noch anderen Adel, weder große Städte noch einen Hof, sondern nur Volk und Fürst. Milosch, dieser außerordentliche Mann, hat mit dem Schwert die Freiheit seiner Landsleute erkämpft, aber er hat es verschmäht, ihren bürgerlichen Zustand zu begründen.
Milosch Obrenowitsch war während seiner Anwesenheit in Konstantinopel mit seltener Auszeichnung empfangen worden und ist der Pforte noch wahrhaft ergeben, denn er ist klug genug einzusehen, dass nur durch sie sein Fürstentum bestehe. Im Innern seines Landes herrscht er durch das Andenken an große Verdienste, durch die Vereinigung aller materiellen Gewalt in seinen Händen und durch den Einfluss eines ungeheuren Reichtums. Nach außen ist er stark durch den kriegerischen, tüchtigen Charakter des serbischen Volkes, denn obwohl seine Miliz nicht zahlreich ist, so weiß doch jeder Serbe die Waffen zu führen, für deren Besitz er so lange gekämpft hat.
3. Walachische Schlitten – Gjurgewo – Rustschuk – Reise mit dem Tataren – Schumla – Türkische Bäder – Der Balkan – Adrianopel – Ankunft in Konstantinopel
Konstantinopel, den 29. November 1835
Nach achttägigem Aufenthalt in Bukarest setzten wir unsere Reise im Schlitten fort, wenn man diese schmeichelhafte Benennung für ein Fuhrwerk gebrauchen will, das eigentlich nichts war, als eine mit vier Pferden bespannte Schleife, und diese noch dazu so eng und kurz, dass die Beine über den Rand hervorragten und man bei der schnellen Bewegung sich nur mit äußerster Anstrengung im Sitz hielt. Auch hatten wir die erste Post noch nicht erreicht, als unser Postillion gestürzt und ich zweimal aus dem Schlitten gefallen war. Der Führer des Miniaturfahrzeugs nahm davon nicht die mindeste Kenntnis; er jagte mit seinen kleinen Pferden weiter und man hatte die äußerste Mühe ihn durch Rufen darauf aufmerksam zu machen, dass er ein Stück seiner Fracht verloren habe. Die Bäche waren in den Tälern über die Wege getreten.
Das Schlimmste für den europäischen Reisenden in diesen Ländern ist der gänzliche Mangel an Gasthöfen. Wenn man hungrig, durchnässe und halb erstarrt abends in eine Stadt kommt, so findet man für Geld weder eine warme Stube noch ein Bett, noch ein Abendessen. Es bedurfte eines Schreibens des Fürsten, um uns in Gjurgewo Aufnahme in eine Privatwohnung zu verschaffen.
Man sieht in dieser Stadt noch deutlich genug die Spuren der Verwüstung aus den letzten Kriegen. Die Festungswerke nach der Landseite sind geschleift, an der Donau sind dagegen einige Bollwerke stehen geblieben. Die Lage an dem schiffbaren Strom wird aber gewiss den Ort bald wieder heben und schon jetzt steigen außer den Kirchen mit ihren byzantinischen Kuppeltürmen einige stattliche steinerne Gebäude empor.
Am folgenden Morgen setzten wir über den hier sehr breiten Strom, der an dieser Stelle mehrere Inseln bildet. Der Wind half uns gegen die starke Strömung, denn Gjurgewo liegt etwas unterhalb Rustschuks. Dort betraten wir türkischen Boden.
Alles in dieser Stadt erschien uns neu und außerordentlich. Wir sahen mit ebenso viel Erstaunen um uns, als wir von den Einwohnern mit Erstaunen angesehen wurden. Unser Weg führte uns am Palast des Paschas vorüber, einem großen baufälligen Haus aus Fachwerk mit vergitterten Fenstern und weit hervorragendem Dach. Gegenüber auf einem freien Platz standen einige Kanonen. Hierauf durchwanderten wir den Basar, eine lange Straße zwischen zwei Reihen von Buden, deren Dächer fast zusammenstießen, sodass man einigermaßen gegen Sonne oder Regen geschützt geht. Pfeifen, Pferdegeschirr, baumwollene und halbseidene Gewebe, Früchte, Stiefel und Pantoffeln waren die einzigen Gegenstände, die dieser Markt bot. Endlich erreichten wir das Hann oder den türkischen Gasthof. Dieser gewährt den Reisenden ein Obdach, aber auch durchaus weiter nichts. Irgendein reicher Pascha erbaut ein solches Hotel als eine Art fromme Stiftung, aber niemand denkt daran, es zu möblieren oder nur in baulichem Stand zu erhalten. Jedes Hann hat seine Fontäne, die reicheren haben zugleich eine Moschee und ein Bad, aber der Reisende muss sein Lager wie seine Mahlzeit selbst mitbringen. Mir fiel es besonders auf, dass in einer Stadt, die einen so rauen Winter hat, wie hier an den Ufern der Donau, nicht einmal Fensterscheiben zu finden waren. Die Fenster waren entweder ganz offen oder höchstens mit Papier verklebt.
Wir hatten aus Bukarest eine Empfehlung an einen griechischen Kaufmann, der sich in dem Hann förmlich eingerichtet hatte und seine Strohmatte, seine Kissen und seine Mahlzeit mit uns teilte. Er schloss auch den Handel mit einem Tataren ab, der es für nicht ganz 100 Taler übernahm, uns mit unserem Gepäck nach Konstantinopel zu schaffen, wobei er zugleich für die Zehrung zu sorgen hatte. Es ist mir noch ein Rätsel, wie es uns gelang, uns über alle diese Dinge zu verständigen, denn unser griechischer Wirt konnte gerade so viel Deutsch oder Französisch, wie wir Türkisch oder Griechisch.
Bei Tagesanbruch trabten wir über das holperige Steinpflaster zum Tor hinaus. Unsere kleine Karawane bestand aus fünf Reitern und sieben Pferden. Voraus ritt mit einem Handpferd der Wegweiser, ein Araber, dessen schwarzes Gesicht in der weißen Winterlandschaft etwas deplatziert aussah. Der Sohn der Wüste versank oft bis zu den Bügeln im Schnee. Ihm folgte der Surudschi, der Pferdejunge, mit dem Packpferd an der Hand, und dann wir mit dem Tataren. Alle waren bewaffnet und führten in der Rechten den Kamtschik, eine lange Peitsche mit kurzem Stiel.
Anhaltender Regen hatte, ehe der Frost eintrat, den schweren Lehmboden sehr aufgeweicht. Jetzt waren alle diese Unebenheiten fest gefroren und durch hohen, aber lockeren Schnee verdeckt. Es war daher ein halsbrecherisches und langwieriges Reiten.
Die Tataren, wenn sie auch noch so früh ausreiten, halten erst des Abends an. Die Pferde bleiben oft zwölf bis vierzehn Stunden ohne Futter. Bergauf reitet man Schritt, in der Ebene einen kurzen Zuckeltrab, der den Reiter schrecklich ermüdet; bergab aber, selbst auf den abscheulichsten Wegen, geht es Galopp. Sobald man das Nachtquartier nur aus der Ferne sieht, setzt sich alles in Galopp und nun geht es mit vollem Rennen und mit lautem Allah-Ruf über halsbrecherisches Steinpflaster, durch enge abschüssige Straßen bis an den Hof des Hann oder der Karavanserai. Der Surudschi führt dann die dampfenden Pferde wohl eine Stunde lang noch herum; der Reiter aber zieht sogleich die Stiefel aus und streckt sich auf das Kissen am Kaminfeuer. Man bringt die Kanne und das Waschbecken (Ibrik Lehenn) und reicht gleich darauf eine winzige Tasse (Fildschan) ohne Unterschale, aber auf einem kleinen Messingfuß (Sarf) mit Kaffee ohne Zucker und ohne Milch, den Kaffeesatz in der Tasse. Dann kommt die Pfeife zum Vorschein und endlich breitet man ein Leder vor dir aus, auf welches eine Schüssel Pillaw (Reis) gesetzt wird, und unmittelbar darauf legt sich jeder schlafen, angezogen, wie er ist. Wer nicht an Reisen zu Pferde gewöhnt ist, dem kann ich einen Ritt im Winter mit dem Tataren durch Bulgarien und Rumelien nicht empfehlen.
Am Abend des zweiten Tages erreichten wir Schumla. Nachdem man die Höhe, auf welcher das Fort Strandscha liegt, erstiegen hat, hat man einen prächtigen Anblick auf die Stadt mit ihren zierlichen Minaretts und großen Kasernen, auf die steilen Berge, welche hinter ihr emporsteigen, und die weite Ebene, die bis zur Donau reicht. Die Vorberge des Balkan umfassen Schumla in Form eines Hufeisens und die offene Seite ist durch Verschanzungen geschützt. Die Stadt ist weit freundlicher und besser gebaut als Rustschuk und die Hauptmoschee sehr zierlich und schön.
Hunger, Kälte und Ermüdung nach vierzehnstündigem Ritt schüttelten mir die Glieder mit Fieberfrost, als ich im Karavanseraj abstieg, und die kurzen Steigbügel des Tatarensattels hatten meine Beine fast gelähmt. Man schlug mir vor ins Hamam oder türkische Bad zu gehen. Da ich von diesem Bad noch keine Vorstellung hatte, so schleppte ich mich mühsam dahin, um es wenigstens zu sehen. Wir traten in ein weites hohes Gewölbe, in dessen Mitte ein Springbrunnen plätscherte, der mir die Kälte sozusagen anschaulich machte, die in diesen Räumen herrschte. Ich verspürte nicht die geringste Versuchung nur das kleinste Stück meiner Toilette abzulegen; überdies sah ich überhaupt keine Badewanne und dachte nur mit Schrecken an den Springbrunnen und seine Eiszapfen. Mit Erstaunen erblickte ich auf der hölzernen Estrade, die rings das Gemach umgab, mehrere Männer auf Teppichen und Matratzen liegen, bloß mit einem dünnen Leintuch zugedeckt, behaglich die Pfeife rauchend und sich wie an einem schwülen Sommertag an der Kühle labend, die mir in diesem Augenblick so entsetzlich schien.
Der Badewärter, der in unseren bedenklichen Mienen las, führte uns in ein zweites Gewölbe; in dem schon eine ganz anständige Hitze war. Hier bedeutete man uns durch Zeichen, dass wir uns entkleiden möchten; man wickelt sich ein halbseidenes blaues Tuch um die Hüften und bekommt ein Handtuch als Turban um den Kopf, von dem angenommen wird, dass er nur aus Versehen nicht geschoren ist. Nach dieser Einkleidung schob man uns in eine dritte gewölbte Halle hinein, deren marmorner Fußboden so stark geheizt war, dass man ihn nur auf hölzernen Pantinen (Galendschi) betreten konnte. Unter der Mitte der Kuppel, durch deren sternförmige, mit dickem Glas geschlossene Öffnungen das Tageslicht eindringt, erhebt sich ein zwei Fuß hohes Plateau mit Marmor, Jaspis, Porphyr und Agat reich ausgelegt, auf welches man sich behaglich hinstreckt.
Der Telektschi oder Badewärter schreitet nun zu einer ganz eigentümlichen Prozedur. Der ganze Körper wird gerieben und alle Muskeln gereckt und gedrückt. Der Mann kniet einem auf die Brust oder fährt mit dem Knöchel des Daumens über das Rückgrat; alle Glieder, die Finger und selbst das Genick bringt er durch eine leichte Manipulation zum Knacken. Wir mussten oft laut auflachen, aber der Schmerz nach dem langen mühseligen Ritt war verschwunden. Durch Klatschen in die Hände gibt der Telektschi das Zeichen, dass er mit seiner Operation fertig sei.
Man begibt sich nun in die kleinen, noch stärker erwärmten Zellen, welche die große Halle umgeben. Hier sprudelt klares Wasser in Marmorbecken, und zwar nach Belieben, aus zwei Hähnen, warmes und kaltes. Der Patient wird nun demselben Verfahren unterworfen wie die türkischen Pferde beim Striegeln, indem nämlich der Wärter einen kleinen Sack aus Ziegenhaar über die rechte Hand zieht und damit den ganzen Körper anhaltend überfährt. Dies ist allerdings eine gründliche Reinigung und man möchte sagen, dass man noch nie gewaschen gewesen ist, bevor man nicht ein türkisches Bad genommen hat. Der Telektschi erscheint nun aufs Neue mit einer großen Schüssel mit wohlriechendem Seifenschaum. Mittels eines großen Quastes aus den Fasern der Palmrinde seift er seinen Mann vom Scheitel bis zur Fußsohle, Haare, Gesicht, alles ein, und mit wahrem Vergnügen gießt man sich dann das kalte Wasser über Kopf, Brust und Leib.
Jetzt ist man fertig; statt der durchnässten Tücher erhält man trockene, über dem Feuer erwärmte umgewickelt, einen Turban auf den Kopf und ein Laken über die Schultern, denn die größte Schicklichkeit wird beobachtet. Bergh und ich erkannten uns in dieser Maskerade kaum wieder und mussten einer über den anderen lachen. Wir streckten uns nun in der Eingangshalle so behaglich hin, wie wir es von den Türken sahen. Man schlürft einen Scherbet (kaltes Limonadengetränk), Kaffee oder raucht die Pfeife und empfindet die Kälte nur als angenehme Erfrischung, so innerlich durchwärmt ist der Körper. Die Haut fühlt sich äußerst glatt und geschmeidig an und es ist gar nicht zu beschreiben, wie erquickend und wohltuend ein solches Bad auf große Ermüdung wirkt. Nach einem köstlichen Schlaf setzten wir am folgenden Morgen unseren Ritt so frisch fort, als ob wir noch keine Anstrengungen gehabt hätten.
Da alle Bäche und Flüsse über die Ufer getreten waren, so mussten wir uns von Schumla zu einem weiten Umweg über Eski-Schumna und Osman-basary entschließen. Von dort erstiegen wir ganz allmählich und auf breiten Schneeflächen den Balkan und nachdem wir einen felsigen Grat überschritten hatten, sahen wir das tiefe Tal von Kasann vor uns, in welches die Straße sich sehr steil hinabsenkt. Die Stadt Kasann erblickt man erst in einer letzten Schlucht zwischen den schroffen hohen Felswänden. Jenseits windet sich der nur für Reiter geeignete Pfad wieder sehr steil empor. Der Weg wird nun dadurch, dass er sich über mehrere kleine Rücken und durch tiefe Täler zieht, äußerst beschwerlich. Endlich erreicht man die letzte Höhe, von der man weit über das rumelische Hügelland hinschaut. Hier wehte uns eine mildere Luft entgegen; der Schnee verschwand, die Bäume trugen noch Laub und zahllose Krokusse blühten auf den grünen Wiesen.
Längs einer Schlucht, deren Tiefe durch Wolkennebel verhüllt war, ging's nun in vollem Galopp durch Frucht- und Olivengärten dem Städtchen Islenije (Selimnia) zu.
Von Islenije gewährte das hohe zackige Gebirge einen prachtvollen Anblick. Wolken hingen an den Gipfeln, während die Sonne die kahlen Steinwände beschien, welche die kühnsten und malerischsten Formen zeigen.
Ehe wir das Nachtquartier erreichten, war es Abend geworden und wir bemerkten, dass unser Tatar, mit dem wir keine Silbe reden konnten, sich verirrt hatte. Wir befanden uns auf einer weiten Wiese, von den Überschwemmungen der Tundscha nach allen Richtungen umgeben. Dabei war es so finster, dass man nicht drei Schritte vor sich sah und wir alle Mühe hatten, nicht von unserem Führer abzukommen. Wir stießen auf große Herden von Kühen und Ziegen, aber alles Rufen nach den Hirten war vergebens; sie mochten wohl wissen, dass der Besuch eines Tataren ihnen Dienstleistungen ohne Lohn verhieß.
Dieser erwischte schließlich, Gott weiß wie, einen kleinen Ziegenhirten, knebelte ihn sogleich, band ihn mit dem Kamtschik an sein Pferd und zwang ihn durch dick und dünn vor uns herzutraben. Der kleine Bulgare wehrte sich herzhaft, schrie, als ob er gespießt würde, und ich erwartete jeden Augenblick ein paar Flintenschüsse von seinen Angehörigen. Es war ein widriges Gefühl, dies Unrecht dulden zu müssen, aber wir konnten uns weder verständigen noch der Hilfe des Knaben entbehren. Als ob der Himmel die Unbilde rächen wollte, strömte der Regen auf uns herab und nur einzelne Blitze erhellten die Gegend vor uns. So zogen wir wohl eine halbe Stunde fort, bis unser kleiner Führer vor einer elenden Hütte Halt machte, von der wir sogleich Besitz nahmen. Nur mit Mühe gelang es, aus grünen Tannenzweigen ein Feuer mitten auf dem Fußboden anzufachen, und der Rauch wurde bald so unerträglich, dass man es nur an der Erde liegend aushalten konnte. Zu essen gab es hier nichts und wir mussten uns, bis auf die Haut durchnässe, schlafen legen, denn selbst die Mantelsäcke trieften von Regen.
Ich suchte mir den trockensten Platz in der Hütte und schlief aus Ermüdung sehr bald fest ein. Als ich am folgenden Morgen aufwachte, fühlte ich jedoch, dass ich kein ganz bequemes Lager gehabt hatte. Ich befand mich auf einer Art Schleife, deren ganze Fläche mit scharfen Feuersteinen besetzt war. Man drischt nämlich hier das Korn nicht wie bei uns, sondern legt es im Freien auf eine Art Tenne »Harman« und fährt dann mit dem beschriebenen Schlitten im Kreise darauf herum. Das Stroh wird dabei zugleich zermalmt und den Pferden genießbarer gemacht.
Nachdem wir unseren kleinen Führer reichlich beschenkt hatten, setzten wir bei fortwährendem Regen die Reise weiter fort. Aber schon mittags mussten wir in einem elenden Dorf liegen bleiben, weil es keine Möglichkeit gab, einen der Zuflussbäche zur Tundscha zu passieren. Als am folgenden Morgen das Wasser etwas gefallen war, furteten wir durch; das Packpferd aber stürzte mit unseren Sachen in den Fluss und wäre beinahe davongeschwommen. Die Wege waren bodenlos aufgeweicht und unsere Karawane gewährte den traurigsten Anblick, als wir endlich in Adrianopel einzogen.
Wie alle türkischen Städte ist auch Adrianopel von außen gesehen sehr schön. In einem weiten Wiesental, zwischen mächtigen Baumgruppen und schlängelnden Flussarmen erheben sich die Kuppeln und Minaretts, die Mauern und Türme über ein Gewirr von flachen roten Dächern, zwischen denen lichtgrüne Sträucher und hohe schwarze Zypressen hervorleuchten. Die mächtige Moschee Sultan Selims mit ihren vier schlanken Minaretts ragt auf dem höchsten Hügel über die ganze Stadt empor, welche von Weinbergen, Gärten und Ackerfeldern umschlossen ist.
Unser Tatar trieb indes zur Eile und am zehnten Morgen, seit wir aus Rustschuk ausgeritten waren, sahen wir die Sonne hinter einem fernen Gebirge emporsteigen, an dessen Fuß sich ein Silberstreifen hinzog; – es war Asien, die Wiege der Völker, es war der schneebedeckte Olymp und der klare Propontis, auf dessen tiefem Blau einzelne Segel wie Schwäne schimmerten. Bald leuchtete aus dem Meer ein Wald von Minaretts, von Masten und Zypressen empor – es war Konstantinopel.
4. Fahrt von Konstantinopel auf dem Bosporus nach Bujukdere
Konstantinopel, den 3. Dezember 1835
Nachdem wir eine Nacht in Pera geruht hatten, setzten wir uns in einen der äußerst zierlichen leichten Nachen (Kaik), die zu hunderten im Hafen, dem Goldenen Horn, herumfahren. Die Ruderer sitzen schon fertig und warten: »Buirun captan. Hekim baschi. St!«, rufen die Türken, die von jemandem, der den Hut trägt, voraussetzen, dass er ein Schiffskapitän oder ein Arzt sein müsse; »Ellado tscheleby!« – Hierher, gnädiger Herr! – die Griechen. Sobald man sich entschieden hat, wem man den Vorzug geben will, und unten auf dem Boden des schwankenden Fahrzeugs Platz genommen hat, versetzen ein paar Ruderschläge den Nachen aus dem Getümmel der Wartenden hinaus ins Freie.
Aber, wie soll ich dir den Zauber schildern, der uns jetzt umfing. Aus dem rauen Winter waren wir in den mildesten Sommer, aus einer Einöde in das regste Leben versetzt. Die Sonne funkelte hell und warm am Himmel und nur ein dünner Nebel umhüllte durchsichtig den feenhaften Anblick. Zur Rechten hatten wir Konstantinopel mit seiner bunten Häusermasse, über welche zahllose Kuppeln, die kühnen Bogen einer Wasserleitung, große steinerne Hanns mit Bleidächern, vor allen aber die himmelhohen Minaretts emporsteigen, welche die sieben riesengroßen Moscheen Selims, Mehmeds, Suleimans, Bajasids, Valideh, Achmeds und Sophia umstehen. Das alte Serai streckt sich weit hinaus ins Meer mit seinen phantastischen Kiosken und Kuppeln mit schwarzen Zypressen und mächtigen Platanen. Der Bosporus wälzt gerade auf diese Spitze zu seine Fluten, die sich schäumend am Fuß der alten Mauer brechen. Dahinter breitet sich der Propontis mit seinen Inselgruppen und felsigen Küsten aus. Der Blick kehrt aus dieser duftigen Ferne zurück und heftet sich auf die schönen Moscheen von Skutari, der asiatischen Vorstadt; auf den Mädchenturm (Kiskalessi), welcher zwischen Europa und Asien aus der tiefen Flut auftaucht; auf die Höhen, die noch mit frischem Grün prangen, und auf die weiten Begräbnisplätze im Dunkel der Zypressenwälder.
Wir eilten zwischen großen Kauffahrern mit den Wimpeln aller Nationen und riesenhaften Linienschiffen hindurch aus dem Goldenen Horn in den Bosporus. Zahllose Kaiks glitten in allen Richtungen über das unbeschreiblich klare, tiefe Wasser; jetzt wendeten wir uns links um das Vorgebirge, welches Pera, die Frankenstadt und Galata mit seinen alten Mauern und dem gewaltigen runden Turm trägt, von welchem einst die Genueser der Eroberung Konstantinopels teilnahmslos zuschauten.
Wegen der heftigen Strömung halten sich die Nachen beim Hinauffahren ganz dicht an das europäische Ufer und wir betrachteten mit Vergnügen die Sommerwohnungen (Jalys), die von den Wellen bespült werden. Die Fenster sind mit dichten Rohrgittern geschlossen und die Gärten von Lorbeer- und Granatbäumen beschattet und mit zahllosen Blumentöpfen besetzt. Eine Menge blühender Rosen lachte den Vorüberfahrenden aus den Gitterfenstern der Gartenmauern entgegen und Delphine sprangen schnaubend dicht neben dem Kahn über die glatte Fläche empor. Auf beiden Ufern des Bosporus reiht sich eine Wohnung an die andere, eine Ortschaft folgt der anderen und die ganze, drei Meilen weite Strecke von Konstantinopel bis Bujukdere bildet eine fortgesetzte Stadt aus zierlichen Landhäusern und herrlichen Palästen, aus Fischerhütten, Moscheen, Cafés, alten Schlössern und reizenden Kiosken.
Besonders schön liegt Therapia, wo die Botschafter Englands und Frankreichs wohnen. Der Ort schaut aus den von jetzt an felsigen und unbebauten Bergwänden des Bosporus hinaus ins Schwarze Meer. Links um eine weite Bucht reihen sich die Häuser von Bujukdere mit den Gebäuden der österreichischen, russischen, preußischen und anderen Gesandtschaften.
Wir gingen in Bujukdere an Land und stellten uns unserem Gesandten vor, der uns mit der ausgezeichnetsten Güte und Freundlichkeit empfing und uns sogar eine Wohnung in seinem reizend gelegenen Haus einräumte.
5. Besuch beim Seraskier Pascha
Konstantinopel, den 24. Dezember 1835
Vor einigen Tagen begleiteten wir unseren Gesandten zu einer Audienz bei Mehmed Chosref Pascha, dem allgewaltigen Kriegsminister und Oberkommandierenden.
Die Wohnung dieses Würdenträgers ist ein ausgedehntes hölzernes Gebäude, welches einen schönen Blick auf das Marmarameer gewährt. Der Seraskier empfing den Gesandten stehend in einem sehr großen Saal mit vielen Fenstern. Außer dem breiten Diwan befinden sich Sofas, Stühle, Tafeluhren und Tische im Zimmer, ebenso viel Dokumente zeugen von der Europäisierung des türkischen Generals. Ein schöner Teppich bedeckte den Fußboden und ein großes bronzenes Kohlenbecken glühte in der Mitte des Saals. Nachdem man sich gesetzt hatte, waren wohl zwanzig bis dreißig Agas beschäftigt die Pfeifen und den Kaffee zu reichen, denn je mehr man seinen Gast ehren will, je mehr Diener müssen erscheinen. Diese Schar zog sich dann in tiefer Stille, die Hände als Zeichen der Ehrfurcht vor den Leib gekreuzt, rückwärts zur Tür und verschwand auf einen Wink des Gebieters.
Der Seraskier führte die Unterhaltung mit Hilfe eines Dragomans, eines Dolmetschers, mit viel Jovialität und Ungebundenheit. Er richtete auch einige Fragen an mich über das preußische Landwehrsystem, welche zeigten, dass er sich wohl mit diesem Gegenstand beschäftigt hatte, und rühmte sehr die Vortrefflichkeit unserer Militäreinrichtungen.
Du weißt, dass meine Absicht war, nur etwa drei Wochen in Konstantinopel zu verweilen und dann über Athen und Neapel zurückzukehren. Nun hat aber der Seraskier mich durch die Gesandtschaft förmlich auffordern lassen die Abreise zu verschieben, was meinen ganzen Reiseplan ändert. Ich muss meinen Gefährten, den Baron Bergh, allein ziehen lassen, was mir in jeder Beziehung äußerst leid ist.
6. Spaziergang durch Tophane – Öffentliche Briefschreiber – Galata
Konstantinopel, den 4. Januar 1836
Ich schrieb dir in meinem letzten Brief, dass mein Aufenthalt sich hier unerwartet verlängert. Der Seraskier lässt mich jede Woche ein paarmal rufen; da die Türken aber jetzt den Ramadan feiern, wo alle Geschäfte des Tages über ruhen, so finden die Besuche des Nachts statt. Das zehnrudrige Kaik des Seraskiers erwartet mich zu Galata und am jenseitigen Ufer des Hafens finde ich seine Pferde. Ebenso geht es zurück. Voraus schreitet ein Kawass oder Polizeisoldat, der mit seinem langen Stock unbarmherzig auf alles losschlägt, was nicht aus dem Wege geht. Dann folgt der Imrohor oder Stallmeister des Paschas und zwei Fackelträger zu Fuß; dann ich auf einem schönen türkischen Hengst mit Tigerdecken und goldenen Zügeln, begleitet vom Dolmetscher.
Was die Lebensweise hier anbetrifft, so ist sie außerordentlich einförmig. Nach dem Frühstück mache ich bei gutem wie bei schlechtem Wetter eine Promenade, gewöhnlich durch die Hauptstraße von Pera zu dem großen Begräbnisplatz. Die hohen hundertjährigen Zypressen beugen unter der Last des Schnees ihre grünen Zweige zur Erde und die zahllosen aufrecht stehenden Leichensteine sind mit einer Eisrinde wunderbar überzogen. Da, wo der Weg aus dem Zypressenwald tritt, öffnet sich eine herrliche Aussicht auf den Bosporus. Unten liegt Beschik-tasch, ein Schloss des Großherrn, denn das alte Serai hat er für immer verlassen, weil daran zu fürchterlich blutige Erinnerungen kleben; auch ist ihm prophezeit, dass er dort sein Leben enden werde. Jenseits erheben sich die schneebedeckten Berge Asiens, Skutari, die Vorstadt mit 100 000 Einwohnern und mitten im Wasser der Leanderturm.
Begleite mich nun auf meiner Wanderung, die steile Höhe, welche der Begräbnisplatz krönt, hinab an das Ufer des Bosporus. Wir bleiben ein Weilchen stehen und sehen den Wellen zu, die sich mit Macht an den steinernen Kais brechen und schäumend weit über die vergoldeten Gitter bis an den Kiosk des Großherrn spritzen. Griechen sammeln die Austern, welche die bewegte See ans Ufer wirft, und ganze Herden von Hunden verzehren die Reste eines gefallenen Pferdes. Wir wenden uns nun rechts an einem prachtvollen Marmorbrunnen vorüber und treten in eine lange Reihe von Kaufläden, deren Dächer oben fast zusammenstoßen. Dort sind es vor allem die Esswaren und Früchte, die meine Aufmerksamkeit erregen; wüsste ich nur ein Schiff, so würde ich euch einen schönen Korb füllen. Da gibt es Datteln, Feigen, Pistazien, Kokosnüsse, Manna, Orangen, Rosinen, Nüsse, Granatäpfel, Limonen und viele andere gute Sachen, von denen ich die Namen nicht einmal weiß. Da gibt es Honigbrei, Reisspeisen, Ziegenrahm und Traubengelee, alles aufs Reinlichste und Beste bereitet; dann kommt der Gemüsemarkt mit Blumen, Kohl, Artischocken, ungeheuren Melonen, Kürbissen, Karden und Pasteken. Gleich daneben liegen die Erzeugnisse des Meeres: ungeheure Fische wie der riesenhafte Thon, die silbernen Palamiden, der Goldfisch, die Steinbutte und alle die Meeresungeheuer, die doch so gut schmecken, die Austern, Hummer, Krebse und Krabben.
Zwischen mehr als hundert Läden, in denen Tschibuks oder Pfeifenrohre, Köpfe aus rotem Ton und lange Spitzen aus Bernstein gefertigt werden, kommt man endlich nach Tophane, dem Viertel der Artilleristen. Die von dem jetzigen Großherrn erbaute Moschee Nusrethieh (die Siegreiche) zeichnet sich aus durch ihre beiden Minaretts, die hundert Fuß hoch sind und deren unterer Durchmesser doch nicht über neun Fuß misst. Wie gut müssen solche schlanken Türme gebaut sein, um Stürmen, oft auch Erdbeben widerstehen zu können. Im Vorhof, der mit schönen Säulen umgeben ist, waschen, trotz der kalten Witterung, in langen Reihen von Wasserbecken die andächtigen Moslems Gesicht, Hände und Füße, denn sonst wird das Gebet nicht akzeptiert. Nach dieser etwas frischen Prozedur kniet der Gläubige, das Gesicht gegen Mekka gewendet, nieder, sagt seinen Spruch, zieht seine Stiefel an und geht davon.
Nahebei ist die große Moschee Kilidsch-Aly. In dem schönen Vorhof befinden sich Kaufläden mit anmutigen Sachen. Unter einem Bogen sitzt ein türkischer Briefschreiber, ein Stück Pergament auf dem Knie und eine Rohrfeder in der Hand. Frauen in weiten Mänteln und gelben Pantoffeln, das Gesicht bis auf die Augen verhüllt, erzählen ihm mit lebhaften Gebärden ihr Anliegen und mit regungslosen Zügen schreibt der Türke das Geheimnis des Harems, eine Prozessangelegenheit, eine Bittschrift an den Sultan oder eine Trauerpost, faltet das Blatt zusammen, wickelt es in ein Stück Musselin, drückt ein Siegel von rotem Wachs darauf und empfängt 20 Para für eine Freudenpost wie für eine Todesnachricht.
Die zahllosen Cafés gewähren jetzt einen eigenartigen Anblick, alles drängt sich um die Feuerbecken, aber der liebliche Dampf des Kaffees und der Pfeife fehlt; es ist das Fest des Ramadan und vor Einbruch der Nacht darf kein Rechtgläubiger essen, trinken, Tabak rauchen oder sich nur den Geruch einer Blume erlauben. Die Türken schleichen langsam in den Straßen herum und schneiden grimmige Gesichter vor Hunger und ungewohnter Kälte. Sobald aber die Sonne hinter der Moschee Suleimans des Prachtvollen untergeht, rufen die Imams von allen Minaretts: »Es gibt keinen Gott als Gott«, und nun ist es sogar die Pflicht des Moslems, die Fasten zu brechen.
Wir sind nun bis an die Mauern von Galata gekommen und steigen zu jenem großen weißen Turm empor, von dem man wieder einen prachtvollen Anblick auf die Stadt jenseits des Hafens, auf Skutari, jenseits des Bosporus, und auf das Marmarameer, die Prinzeninseln und den asiatischen Olymp hat. Rechts breitet sich die mächtige Stadt von einer halben Million Einwohner aus.
Die äußerste Spitze mit den hohen Mauern, den vielen Kuppeln und dunkelgrünen Zypressen ist das Seraj, eine Stadt für sich mit 7000 Einwohnern, mit ihren eigenen Mauern und Toren. Dicht daneben wölbt sich die mächtige Kuppel der Sophienkirche, jetzt eine Moschee, welche das Vorbild zu so vielen anderen Kirchen, selbst zu St. Peter in Rom, geworden ist. Weiter rechts ragen die sechs prächtigen Minaretts der Moschee Sultan Achmeds hervor. Wegen ihrer schlanken Form sehen diese Minaretts ungleich höher aus als die höchsten Türme unserer christlichen Kirchen. Den höchsten Punkt aber bildet der schöne Turm des Seraskiers. So weit das Auge reicht, nichts als flache Dächer, rote Häuser und hohe Kuppeln, überragt von der Wasserleitung Kaiser Valens, welche mitten durch die Stadt geht und noch heute, nach sechzehn Jahrhunderten, das Wasser für hunderttausende von Menschen herbeileitet. Durch die weiten Bogen flimmert jenseits der Hellespont, und die asiatischen Berge schließen dies Bild.
7. Chosref Pascha
Konstantinopel, den 20. Januar 1836
Mehmed Chosref Pascha ist nächst dem Großherrn der mächtigste Mann im Reich. In seiner Erscheinung hat er wohl kaum seinesgleichen in der Welt. Stelle dir einen Greis von nahezu achtzig Jahren vor, der die ganze Lebendigkeit, Rührigkeit und Laune eines Jünglings bewahrt hat. Das stark rote Gesicht mit schneeweißem Bart, eine große gebogene Nase und auffallend kleine, aber blitzende Augen bilden eine markante Physiognomie, die durch die rote, über die Ohren herabgezogene Mütze nicht verschönert wird. Der große Kopf sitzt auf einem kleinen, breiten Körper mit kurzen, krummen Beinen. Der Anzug dieses Generals besteht aus einer blauen Bluse ohne alle Abzeichen, weiten Pantalons und ledernen Strümpfen (Terlik).
Chosref Pascha hat sich während fünfunddreißig Jahren in den höchsten Staatsämtern zu erhalten gewusst, was seiner Gewandtheit alle Ehre macht.
Der Seraskier redet fast nur in scherzhaftem Ton, aber die Mächtigen zittern bei seinem Lächeln. Er weiß alles, was in der Hauptstadt vorgeht, hat seine Kundschafter überall und kennt keine Schonung gegen solche, die sich der neuen Ordnung der Dinge widersetzen.
Chosref Pascha war der Erste, welcher dem Großherrn eine europäisch ausexerzierte Truppe vorstellte, und der Erste unter den Großen, welcher die schöne alttürkische Tracht gegen die geschmacklose und unbequeme Nachbildung europäischer Uniform vertauschte; er gilt daher für einen Hauptbeförderer der Reform.
Mir kommt es jedoch manchmal vor, als ob der Seraskier Mehmed Chosref die Reform in seinem geheimsten Innern mit der tiefsten Ironie behandle; aber sie ist ihm das Mittel zur Macht und Macht ist die einzige wahre, ungebändigte Leidenschaft dieses Greises. Wer ihm in dieser Beziehung entgegentritt, sei auf seiner Hut. Jemand, der eine hohe Stellung bekleidet, ohne sie durch ihn erlangt zu haben, gilt ihm schon für einen Feind.
8. Die Frauen und die Sklaven im Orient
Arnaut-Kjöi bei Konstantinopel, den 9. Februar 1836
Wenn von der Sklaverei im Orient die Rede ist, so war dabei fast immer der himmelweite Unterschied übersehen worden, welcher zwischen einem türkischen und einem Negersklaven in Westindien besteht. Schon der Name Sklave in dem Sinne, den wir mit jenem Wort verbinden, ist falsch. Abd heißt nicht Sklave, sondern vielmehr Diener. Abd-allah: der Diener Gottes; Abd-ul-medschid: der Diener der Andacht usw. Ein gekaufter türkischer Diener ist unendlich viel besser dran als ein gemieteter. Eben weil er das Eigentum seines Herrn und dazu ein teures Eigentum ist, schont er ihn; er pflegt ihn, wenn er krank ist, und hütet sich wohl ihn durch übertriebene Anstrengung zu Grunde zu richten. Bestimmt doch der Koran: »dass Sklaven und Sklavinnen mit nicht mehr als sechs Geißelhieben gezüchtigt werden sollen«.
Wenn irgendeine europäische Macht die Freilassung aller Sklaven im Orient bewirkte, so würden diese ihr wenig Dank dafür wissen. Als Kind in das Haus seines Brotherrn aufgenommen, bildet der Sklave ein Glied der Familie. Er teilt die Mahlzeit mit den Söhnen des Hauses, wie er die Arbeit in der Wirtschaft mit ihnen teilt; diese besteht meist darin, ein Pferd zu warten oder seinen Herrn zu begleiten, ihm die Kleider nachzutragen, wenn er ins Bad geht, oder die Pfeife, wenn er ausreitet. Tausende von Sklaven, die Khavedschi und Tütundschi, haben kein anderes Geschäft, als Kaffee zu kochen und die Pfeife in Stand zu halten. Fast immer endet die Sklaverei nicht bloß mit einer Freilassung, sondern auch mit einer Ausstattung fürs Leben. Gewöhnlich heiratet der Sklave die Tochter des Hauses und wenn keine Söhne vorhanden sind, setzt ihn der Herr zu seinem Erben ein. Sind doch die Schwiegersöhne des Großherrn gekaufte Sklaven und lässt sich doch von den meisten Würdenträgern des Reiches der Marktpreis nachweisen.
Viel härter als das Los der Sklaven im Orient scheint mir das Verhältnis der Frauen bei der Ausdehnung, in welcher der Türke die materielle Gewalt über das schwächere Geschlecht übt.
Die Ehe ist im Orient rein sinnlicher Natur und der Türke geht über das ganze »Brimborium« von Verliebtsein, Hofmachen, Schmachten und Überglücklichsein als ebenso viele faux frais hinweg zur Sache. Die Heiratsangelegenheit wird durch die Verwandten geregelt und der Vater der Braut bekommt viel öfter eine Entschädigung für den Verlust eines weiblichen Dienstboten aus seiner Wirtschaft, als dass er der Tochter eine Aussteuer mitgäbe. Der Tag, an dem die Neuvermählte verschleiert in die Wohnung ihres Gemahls tritt, ist der erste, wo dieser sie erblickt, und der letzte, an welchem ihre nächsten männlichen Verwandten, ihre Brüder selbst, sie sehen. Nur der Vater darf ihren Harem noch betreten und übt auch später immer eine gewisse Gewalt über sie. – »Harem« heißt wörtlich Heiligtum und die Vorhöfe der Moscheen tragen denselben Namen.
Diese Art, die Ehen zu schließen, bedingt schon an sich die Leichtigkeit sie wieder zu lösen; ein vorhergesehener Fall, für den die Rückzahlung des etwaigen Heiratsgutes und eine Geldentschädigung gleich bei der Hochzeit festgesetzt wird.
Obschon das Gesetz den Rechtgläubigen vier Frauen erlaubt, so gibt es doch nur sehr wenige Türken, die reich genug wären, um mehr als eine zu heiraten. So viele Frauen, so viele besondere Haushaltungen und Wirtschaften muss er haben, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass zwei Frauen in einem Konak (Wohnhaus) sich durchaus nicht vertragen. Dagegen gestatten Gesetz und Sitte dem Moslem, so viele Sklavinnen zu haben, wie er will. Nicht der mindeste Makel haftet an der Geburt des Sohnes einer Sklavin; diese stehen unter dem Befehl der eigentlichen Kadyn oder Hanum, der Frau vom Hause. Welche reiche Quelle aber von Zwist und Hader, von Eifersucht und Ränken ein solches Verhältnis ergibt, ist leicht einzusehen.