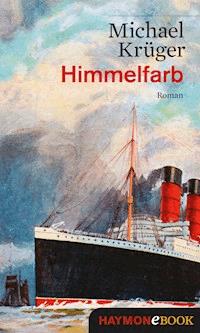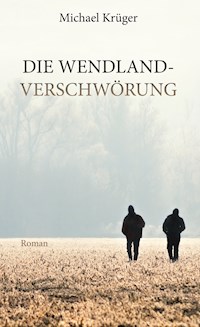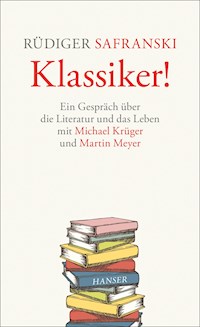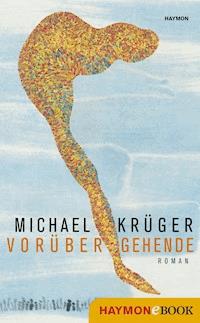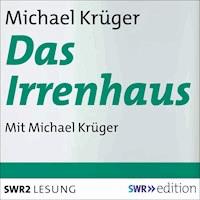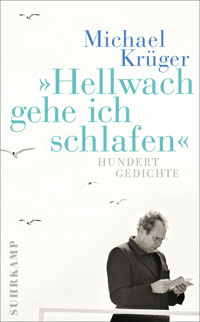29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Michael Krüger hat weit mehr erlebt und zu erzählen als das, was er in seinen Memoiren Verabredung mit Dichtern so eindrucksvoll schilderte. Als Verleger, Herausgeber, Dichter und Übersetzer hat er zahlreiche Autorinnen und Autoren vorgestellt, gefördert – und auch betrauert.
Auch in Unter Dichtern folgt er einem chronologischen Aufbau. Von einem Wohnungswechsel zum nächsten, die meisten finden innerhalb Münchens statt, überschreiten neue Dichter Krügers Schwelle, sie erfahren Aufnahme und Echo und finden, fast unvermeidlich, einen Freund.
Sein ganzes Leben hat Michael Krüger mit Dichtern verbracht: Er verlegte ihre Werke bei Hanser und anderswo, veröffentlichte sie in der von ihm drei Jahrzehnte lang herausgegebenen Zeitschrift Akzente, zeichnete sie mit dem Petrarca-Preis aus, den er gemeinsam mit Nicolas Born, Bazon Brock, Hubert Burda und Peter Handke ins Leben rief. Zahllose Lesungen hat Michael Krüger eingeleitet und hundert Lobreden gehalten, er ist mit den Dichtern auf Reisen gegangen – und immer wieder hat er auch Nachrufe auf die mit ihm befreundeten halten müssen.
In Unter Dichtern hat Michael Krüger eine stattliche Auswahl der Texte, die im Verlauf seiner Arbeits-, Dichter-, Lebensreise entstanden sind, versammelt und von heute aus in einen Zusammenhang gebracht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 808
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Michael Krüger
Unter Dichtern
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Für Ariane
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.
© Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Gruppenfoto 1981 in Australien mit Arnfrid Astel, Michael Krüger, Jürg Federspiel, Peter Rühmkorf (von links), Hans Magnus Enzensberger und Reinhard Lettau (vorn); Akademie der Künste, Berlin, Reinhard-Lettau-Archiv, Nr. 775.2
eISBN 978-3-518-78363-4
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
Günter Bruno Fuchs
Dichter in der Hildeboldstraße
Brief des Dichters Wolfgang Bächler an die deutschen Akademien
Über Oskar Pastior
:
Das arme Klappbett
Oskar Pastior
Herzogstraße
Merkwürdigkeiten im Umgang mit der Post
Günter Kunert († 21.09.2019)
Gert Jonke
Rede zum 60. Geburtstag, Mai 1990
Totenrede Dezember 1990
Liebigstraße
Andreas Gryphius
Alles ist eitel
Ernst Stadler
Mensch, werde wesentlich
Karl Kraus
Das Schweigen der Beredten
Hermann Lenz
Wenn du nur durchkommst
Harald Hartung
Und dann der Blick in den Spiegel
Christine Lavant
Frau Hiob
Ilse Aichinger
Der Bettler befiehlt
Jürgen Becker
Das Geheimnis einer bestimmten Art von Gedichten
David Rokeah
Steine, über die schon der Erlöser gegangen ist
Tomas Tranströmer
Klugheit und Empfindungskraft
Hanno, der Dichter
Und jetzt das
Krieg im Libanon – deutsche Eiszeit Nicolas Borns Roman »Die Fälschung«
Der große Bewunderer
Alfred Kolleritsch
Überwältigende Präsenz
Ambach
»Warum sagt ihr mir nicht …«
Tankred Dorst – Grabrede Juni 2017, Berlin
Wilhelm Killmayer
Von Flügeln und lyrischen Schwingen
Dichter auf Reisen
Notiz
Elias Canetti
Besuch bei Canetti
Nachwort
Eine unbekannte Episode aus dem Leben des Verlegers M.K.
Die Familie Enzensberger auf den Photographien von Stefan Moses
HME
(† 24.11.2022)
Peter Rühmkorf auf Reisen
Zurück in der Herzogstraße, nur etwas vornehmer
Vielleicht lebst du weiter im Stein
Albertus Magnus d.J.
Walter Helmut Fritz
Benennt einen der höchsten Berge nach ihm!
Rede zum Goethepreis an Peter von Matt
Kaiserstraße
Litauen-Rede: Mein Europa
Tomas Venclova
Retter der Poesie
Weltalte Schrift: Weltalte Zeichen
Ansprache anlässlich der Verleihung des Ernst-Meister-Preises
Will nichts gelingen
Lucile-Grahn-Straße
Marcel Beyer und die Notwendigkeit von Gedichten
:
Erdkunde
Zu Lutz Seiler
Laudatio auf Inger Christensen
Nichts, nicht das geringste darf verloren gehen
Sebald / Stuttgart
Condom
Eine Anekdote zum Abschied
:
Rainer Malkowski (†1.09.2003)
Auch ein kurzer Satz hat eine lange Geschichte
Zu Rainer Malkowskis Schnee-Gedicht, anläßlich einer Gedenkfeier für den Dichter:
Über Raoul Schrott
:
Der Erfinder der Erfindung der Poesie
Rede zum Joseph-Breitbach-Preis (2010)
»… aber sag ihr, sie soll weiter erzählen«
Nachwort zu einer Sammlung von Paul Celans Gedichten
Gellertstraße
Michael Köhlmeier
Guntram Vesper Gedichte
Günter Herburger († 03.05.2018)
Nachruf auf Hans Blumenberg
Ludwig Harig († 05.05.2018)
Der Geruch der Bücher
Allmannshausen
Valzhyna Mort
John Burnside
Fabio Pusterla
Eva Maria Leuenberger
Weisheit und Poesie
Zum Tod von Charles Simic († 09.01.2023)
Nachweise
Bildnachweis
Informationen zum Buch
Vorwort
Foto: Stefan Moses
Eine Erzählung von Danilo Kiš wird mich mein restliches Leben lang begleiten: die »Enzyklopädie der Toten«. In einem riesigen unterirdischen Magazin in der schwedischen Hauptstadt Stockholm – man denkt sofort an das Bergwerk von Falun – hat eine Gruppe von Archivaren die Biographien all der Menschen gesammelt, die sonst in keinem Nachschlagewerk vertreten sind. Jeder der monumentalen Säle ist einem Buchstaben gewidmet – was es der Besucherin, die sich für eine Nacht dort einschließen lässt, leichtmacht, sofort den Ordner mit den Materialien ihres verstorbenen Vaters zu finden. Es wird für sie keine leichte Lektüre. Denn in den Mappen und Umschlägen, die sich unter ihrem Blick wie in einem Bild von Escher immer weiter verzweigen und in ungeahnte Tiefen führen, finden sich nicht nur der Lebenslauf, die Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunde, sondern, in einer auf den ersten Blick nicht fassbaren Ordnung, sämtliche Daten und Taten des verstorbenen Vaters: wo und wie er gelebt hat, welcher Arbeit er nachgegangen ist, wann und in wen er verliebt war und wen er geheiratet hat. Sogar die Seitensprünge sind korrekt verzeichnet. Dazu natürlich sämtliche Bücher, die er gelesen, die Zigarettenmarken, die er geraucht und die seine Lunge ruiniert haben, seine Reisen, seine Hoffnungen, seine Sprüche und seine merkwürdigen Hobbys – mit anderen Worten: das GANZE LEBEN mit all seinen Zufällen und Banalitäten, seinen seltenen Höhepunkten und seinen furchtbaren (selbstverschuldeten und von anderen erzwungenen) Abstürzen. Das Unheimliche an dieser unheimlichsten Enzyklopädie, die sich ausdenken lässt, ist die kaum erklärbare Tatsache, dass die Texte zu den Menschen während der Lektüre an Umfang noch zunehmen und nicht etwa ausdünnen, als sei auch ein noch so am Rande gelebtes Leben mit allen verfügbaren Wörtern der Welt nicht zu beschreiben.
Ich will die Pointe hier nicht vorwegnehmen. Es lohnt sich, diese verblüffende Eloge auf das Leben selber zu lesen – und ganz besonders für die, die darüber stöhnen, dass die Literatur nichts ausrichten könne, dass sie keine (öffentliche) Bedeutung mehr habe. Solche Menschen müssen sich einmal in die Labyrinthe des Argentiniers Jorge Luis Borges begeben oder eben sich von Danilo Kiš erklären lassen, wie unendlich die Möglichkeiten sind, das eigene Leben zu beschreiben; von Subotica, dem vielsprachigen Städtchen in der Vojvodina, wo Kiš 1935 auf die Welt kam, nach Buenos Aires, der argentinischen Hauptstadt, in der Borges kurz vor der Jahrhundertwende geboren wurde, ist es für große Schriftsteller nur ein Katzensprung; ihre Sterbeorte liegen mehr oder weniger nebeneinander: Borges starb 1986 in Genf, Kiš drei Jahre später in Paris; ihre Unterhaltung dauert an.
Mit beiden Autoren hatte ich zu tun, das heißt: Ich bin ihnen begegnet. Den greisen, fast blinden Borges sehe ich noch genau vor mir, wie er 1980 die ersten Bände der ersten Ausgabe seiner gesammelten Werke im Hanser Verlag in München-Bogenhausen in Empfang nahm. Eine solche Ausgabe gab es weder in spanischer Sprache, was daran lag, dass der Dichter in der Welt herumzog und seine schmalen Bücher an den verschiedensten Orten publizierte, noch auf Englisch, das er, als lebenslanger Liebhaber der englischen Literatur, so gut beherrschte. Schon in den späten fünfziger Jahren hatte der Verlag begonnen, die Erzählungen und Essays (vor allem in der Übersetzung von Karl August Horst) zu drucken, jetzt stellten wir sie neu zusammen und baten Freunde des Hauses um Nachworte: von Umberto Eco (der Borges neben James Joyce als den von ihm am meisten bewunderten Schriftsteller bezeichnete und ihn versteckt oder verkleidet in seinen Romanen auftreten ließ) über Lars Gustafsson, Curt Meyer-Clason (der auch einen großen Teil der Gedichte übersetzte) und Caroline Neubaur bis zu Dietmar Kamper entstand so ein großes Spektrum von Ansichten über die Sphinx aus Buenos Aires, die ja nie Autor von gut verkäuflichen Büchern war; leider war das Gegenteil der Fall. (Trotzdem haben wir später, mit Hilfe des Fischer Taschenbuchverlags, noch eine weitere Gesamtausgabe erarbeitet, mit Gisbert Haefs als Herausgeber.)
Borges, der zusammen mit seiner Frau Maria Kodama in den Verlag gekommen war, erhielt von uns in einer feierlichen Zeremonie das erste Exemplar. »Beredtes Schweigen. Hüsteln. Die Vertreter des Verlages schauen sich mit gerunzelter Stirn an.« Es war wie bei einer »suspense«-Szene in einem Hitchcock-Film. Borges nahm das Buch in die Hand, drehte es nach allen Seiten, roch daran, schlug es auf, beschaute sich das Titelblatt, blätterte, tat so, als würde er lesen, indem er die Lippen bewegte – der Zuschauer sollte nicht sicher sein, ob der alte Herr wirklich blind war oder aus undurchsichtigen Gründen nur einen Blinden spielen sollte. Dann sprach das Orakel die erlösenden Worte: Es ist das schönste Buch, das ich je in meinen Händen gehalten habe. Da der große Autor einmal Direktor der argentinischen Nationalbibliothek war und alle schönen und schönsten Bücher in seinen Händen gehalten hatte, ergänzten wir bescheiden im Stillen: …von mir; es war die schönste Ausgabe eines Buches »von mir«, die er je in der Hand gehalten hatte. Aber als könnte er zwar nicht mehr sein eigenes Buch lesen, wohl aber hinter unseren Stirnen, fügte er gleich an: Vergleichen Sie nur mein Buch hier mit der Erstausgabe des »Endymion« von Keats, dann wissen Sie, was ich meine.
Was ging in diesem Kopf vor? Wollte er sich über uns lustig machen, die wir zwar wussten, wer Keats war, aber – vielleicht mit der Ausnahme von Fritz Arnold, unserem Chef – nie eine Zeile von ihm gelesen hatten; und wie die erste Ausgabe des »Endymion« aussah, wussten wir gleich dreimal nicht. Die Synapsen im Gehirn von Borges waren anders geschaltet als die von normalen, halbwegs gebildeten Mitteleuropäern, man muss nur seine »Spiegel-Theorie« lesen, dann weiß man, was ich meine. Mit einem Wort: Er war nicht nur zufrieden, er war glücklich.
Danach »Schnittchen« und Kaffee. Bei dieser Gelegenheit habe ich ihn nach seinen deutschen Vorlieben ausgefragt, die hier und da in seinen Texten »aufblitzen«. Es kamen erstaunliche Sachen heraus, so seine Schwärmerei für die deutsche Revolution nach dem Ersten Weltkrieg, der er, damals Schüler in Genf, »beitreten wollte«, wie man einem Club beitritt. Aber zunächst musste er natürlich Deutsch lernen. Und wie lernt man am besten eine fremde Sprache? Indem man Gedichte übersetzt. Warum er sich dann ausgerechnet den heute (vielleicht zu Unrecht) vergessenen Kurt Heynicke ausgesucht hat, bleibt ein Rätsel; wahrscheinlich hat er dessen Texte in der expressionistisch-revolutionären Zeitschrift »Die Aktion« gelesen oder im »Sturm«, jedenfalls erinnerte er sich an die Namen der Herausgeber, Franz Pfemfert und Herwarth Walden.
Viele Jahre nach dem Tod des Meisters habe ich einmal (zusammen mit Hanns Zischler) anlässlich eines Abends zu Ehren des Autors und in Anwesenheit der Witwe Maria Kodama im Instituto Cervantes in Berlin über Borges und Deutschland gesprochen. Das müssen Sie unbedingt publizieren, so Frau Kodama – das war das Stichwort, auf das Hanns und ich gewartet hatten. Da auch Maria Kodama tot ist, kann ich hier getrost aufschreiben, warum wir so dringend mit ihr sprechen wollten. Borges hat mehrere kleine Schriften als Co-Autor herausgegeben, unter anderem eines über die isländischen Sagas, die eine Zeitlang seine Phantasie beflügelten. Diese Bücher wurden nach dem Tod von Borges aus seinem Werk ausgeschieden und durften auch nicht übersetzt werden – und böse Stimmen behaupteten, dass Maria Kodama – die Erbin der Rechte und Testamentsvollstreckerin – verhindern wollte, dass der Name von Borges im Zusammenhang mit anderen Frauen (außer der Mutter) genannt wird. Noch bösere Stimmen verbreiteten das Gerücht, er habe die Co-Autorinnen, mit denen er befreundet war, nur deshalb mit auf den Umschlag gesetzt, um die Mutter zu beruhigen: Wir arbeiten, Mutter, du kannst ganz beruhigt sein. Hanns Zischler jedenfalls, der in seinem kleinen, aber sehr feinen Verlag Alpheus die Saga-Schrift publizieren wollte, erhielt trotz vieler Interventionen (auch meinerseits) nicht die Rechte … Was natürlich damit zusammenhängen könnte, dass die bösen Stimmen gar nicht böse waren, sondern »nur« die Wahrheit sprachen. Was natürlich nichts zu tun hat mit meiner bleibenden Verehrung des dichterischen Werks des argentinischen Autors. Sollte ich allerdings noch länger am Leben bleiben, werde ich das sehnlichst erwartete Buch über Schriftsteller-Witwen schreiben, in dem Borges und seine Frau Maria Kodama eine wichtige Rolle spielen werden.
Aber noch einmal zurück zu dem großen Poeten aus der Vojvodina, Danilo Kiš, dem Autor der Geschichte »Enzyklopädie der Toten«. Zu seinem achtzigsten Geburtstag am 22. Februar 2015 habe ich in der ZEIT eine kleine Erinnerung an diesen wunderbaren Menschen veröffentlichen dürfen:
»Ah, Michel! Deutschmark!«
Er sah aus wie der Gitarrist der »Rolling Stones«, Keith Richards, in seinen besten Jahren: groß, schlaksig, breit gebaut, hager, eine Welle aus dunklen Haaren über der hohen Stirn; ein Melancholiker, der sich zeitweise mit Ironie über Wasser hielt; ein Schriftsteller, der so lange nichts schrieb, wie ihm die »Gnade der Form« versagt blieb; ein Unbeugsamer, der nichts von intellektuellem Geschwätz hielt; ein Mann mit mitteleuropäischem Herzen, dem der Begriff Mitteleuropa auf den Wecker ging; ein vielsprachiger Kosmopolit und geprüfter Emigrant, dem alle Wehleidigkeit zuwider war – und ein liebenswerter Mensch. So stand er eines Tages neben mir an einer Hotelbar in Lissabon, und da ich ihn erkannte, begann ich, ihm von seinem Roman »Garten. Asche« vorzuschwärmen, diesem Wunderbuch der Trauer und der Vergegenwärtigung, dem zärtlichsten Buch über einen Vater, das je geschrieben wurde. Ich konnte nicht aufhören, in meinem furchtbaren Französisch seine Bücher zu rühmen, die Vorzüge seines Stils, seine Neigung zu Dokumenten, sein Spiel mit der Zeit, seinen Witz und seine abgrundtiefe Traurigkeit, seine zärtliche Aufmerksamkeit für die noch so kleinen, unwichtigen Dinge; ich verglich ihn mit Bruno Schulz und mit Primo Levi, in deren Werken ich mich gut auskannte, mit Isaac Singer und Bernard Malamud, ich stellte ihn – mit der Ausnahme von Vasko Popa – über alles, was ich von jugoslawischer Literatur wusste, und benahm mich insgesamt wie ein Schüler, der sich nach der Vorlesung bei seinem Professor einschmeicheln will. Danilo Kiš schaute mich die ganze Zeit über wie ein seltsames Insekt an. Er rauchte (wie ein Profi, das heißt, er zündete sich eine Gitane an der anderen an), trank (eine Art portugiesischen Cognac, von dem er gar nicht genug kriegen konnte) und blickte mir in die Augen. Und sagte schließlich mit seiner durch viel zu viel Rauch gebeizten Stimme: Du musst dich nicht so anstrengen, ich kenne die Bücher und ihren Wert sehr genau, ich habe sie nämlich selber geschrieben. Darauf bestellte er noch eine Runde, dann machten wir uns auf in die Altstadt, wo er bereits nach zwei Tagen bestens bekannt zu sein schien, und verbrachten den Abend zusammen. Da es eine große Zahl von Autoren gab, die wir beide liebten, war bald auf einer Serviette ein literarisches ABC beisammen, das von A wie Andrić über B wie Borges, C wie Calvino und D wie Danilo bis zu Z wie Zeno Cosini ging, eine weitere Liste neben den vielen anderen, die in seinen Büchern eine lebenswichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, festzuhalten, was einen mit dem Leben noch verbindet.
Die Serviette ist leider ebenso verlorengegangen wie viele Details der Unterhaltung, weil Danilo darauf bestand, erst dann ins Hotel zurückzukehren, wenn wir sicher sein konnten, keinen der Kongressteilnehmer mehr anzutreffen. Er hatte einen Horror vor interessanten Gesprächen mit besorgten Menschen. Kiš war, besonders im Kreis von sogenannten Salon-Linken, wie sie ihm in Paris und auf Kongressen auf Schritt und Tritt über den Weg liefen, ein strikter Anti-Kommunist, dem das Einerseits-andererseits dermaßen auf den Geist ging, dass dieser sanfte Mensch bis zur schroffsten Grobheit gereizt reagieren konnte. Ich glaube, von Kundera stammt die Bemerkung, Kiš sei der einzige ihm bekannte Schriftsteller, der in seinen Büchern nicht einen Satz an politische Gemeinplätze verschwendet hätte. Und am Ende seines kurzen Lebens sagte Kiš selber in einem Interview: »Ich gehe davon aus, dass wir nichts wissen. Die Metaphysik ist eine Art Poesie in Prosa. Der Mensch ist ein Unbekannter. Wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen, und wir wissen nicht, warum wir existieren. Wir verharren im Unbekannten, wie am Anfang der Welt oder am Anfang des Menschen.«
Nach dieser denkwürdigen Nacht in Lissabon haben wir mit Hilfe von Ilma Rakusa, Pascale Delpech und Peter Urban alle seine Bücher verlegt, leider nicht immer mit dem Erfolg, den sie verdient hätten. Wenn ich Danilo anrief und er meine Stimme erkannte, rief er fröhlich ins Telefon: Ah, Michel Deutschmark, bonjour! Er brauchte, wie alle Schriftsteller, die etwas taugen, Zuspruch, Anerkennung und Geld. Und dieser Emigrant und Bohemien brauchte besonders viel davon, weil er mit jedem seiner Bücher etwas Neues wagte, ein unbekanntes Terrain erobern wollte. Aber im Grunde ging es natürlich immer nur darum, den Schmerz zu besiegen, der ihm mit dem Verlust des Vaters zugefügt worden war. »Im Jahre 1944«, schreibt Kiš in einem Lebenslauf, »wurden mein Vater und all unsere Verwandten nach Auschwitz deportiert, und von dort ist fast keiner zurückgekehrt.«
Danilo Kiš, der heikle Patriot, starb kurz vor dem Untergang Jugoslawiens.
Ich will an Danilo Kiš erinnern, weil ich befürchte, dass auch er schon in Vergessenheit geraten ist, trotz aller Anstrengungen, für sein nicht besonders umfangreiches Werk auch in Deutschland Leser zu finden. Aber es gibt ja gottlob die fleißigen anonymen Bibliothekare und anderen Zulieferer der »Enzyklopädie der Toten«, die alle seine Spuren sammeln, dokumentieren und zur Verfügung stellen. (Einer von ihnen ist Karl-Markus Gauß, der große Wanderer durch Mitteleuropa aus Salzburg, der nicht müde wird, die Bedeutung von Danilo Kiš hervorzuheben.)
Meine in diesem und dem vorangegangenen Band (»Verabredung mit Dichtern«) gesammelten Erinnerungen und Porträts sollen nichts anderes sein als Zulieferungen zu diesem gemeinsamen Projekt einer »Enzyklopädie der toten Schriftsteller«, die in den Höhlen unter Stockholm entsteht. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn Danilo Kiš den Nobelpreis für Literatur erhalten hätte (oder eben Borges, Italo Calvino, Aleksandar Tišma oder Vasko Popa, Giuseppe Ungaretti oder Botho Strauß, Amos Oz, Jehuda Amichai oder David Grossman, Harry Mulisch, Cees Nooteboom, Hugo Claus, John Burnside, Max Frisch, Hans Magnus Enzensberger und Jürgen Becker oder Inger Christensen, um nur ein paar Namen zu nennen, die mir gerade in dieser Sekunde durch den Kopf gehen), »verdient« (was immer das heißen mag) hätte er ihn natürlich allemal. Aber auch die noble Nobel-Stiftung kann den Preis leider nur einmal im Jahr vergeben. Wäre genug Geld für einen monatlichen Nobel-Preis vorhanden, würden wir uns leichter tun mit der Gerechtigkeit.
Keiner weiß, wie lange ein Schriftsteller »überlebt«, das heißt, wie lange es nach seinem Tod noch Leser gibt, die aus seinen Büchern einen »Gewinn« ziehen. Eben war ein Autor noch in aller Munde, schon spricht keiner mehr von ihm. Selbst seine »runden« Geburtstage werden nicht mehr erwähnt, geschweige denn »begangen«. Je länger es so etwas wie freie Schriftsteller gibt, also seit etwa dreihundert Jahren, desto mehr hat die Literaturwissenschaft zu tun, dieses Gewimmel von Namen und Werken zu sortieren: Göttinger Hainbund (kann vernachlässigt werden), Pegnitz-Schäfer (?) oder Romantische Schule (!), Expressionismus (wichtig) – alles schön und wichtig für Fachleute, aber warum soll ich meine kurz bemessene Lebenszeit mit der Lektüre dieser Bücher verbringen? Heute ist es wichtig geworden zu wissen, ob Theodor Storm ein Antisemit war, weil im zutreffenden Fall die Theodor-Storm-Schule umbenannt werden muss – aber soll ich noch einmal seine Novellen lesen? (Ja, sollst du, lieber Leser!) Der sogenannte gebildete Zeitgenosse ist eine Wunschvorstellung aus fernen Zeiten. Heute spielt es keine Rolle, ob der Industriekaufmann in seiner Freizeit Rilke liest – oder James Joyce, aber es wird doch lieber gesehen, wenn er sich in den neuesten Forschungen zur KI auskennt als bei Flaubert.
Und dennoch … gibt es Menschen, die ihr ganzes Leben damit verbringen, in dem endlosen Meer der Literatur herumzuschwimmen. Für sie habe ich dieses Buch geschrieben.
*
Ich war etwa dreizehn Jahre alt, als ich mich zum ersten Mal für den Beruf des Dichters zu interessieren begann. Mein Vater war mit Edwin Maria Landau befreundet, der in seiner Jugend mit Wolfgang Frommel den »Verlag Die Runde« gegründet hatte, ein strenger, immer etwas bekümmert dreinblickender Mensch, der uns häufig besuchte. Es dauerte nie lange, bis sie auf Stefan George zu sprechen kamen, ein Idol ihrer Jugend, und kaum war der Name gefallen, setzte mein Vater, ein Jurist und Beamter, ein spezielles Gesicht auf, wie wir es sonst von ihm nicht kannten: Er legte den Kopf schief, verdrehte die Augen und machte insgesamt den Eindruck von Entzückung. George war ein Dichter, ein wirklicher Dichter, der herausragende Dichter der Vorkriegszeit. An ihm führte kein Weg vorbei, an ihm durfte nicht gerüttelt werden. Auch danach gab es noch Autoren, die dichteten, aber sie waren keine Dichter im eigentlichen Sinne. Gelegentlich flochten Herr Landau und mein Vater in ihren Dichterdienst ein paar Zeilen des Verehrten, die allerdings anders klangen als alles andere. Als Mitglied der evangelischen Jungenschaft unter der Leitung des literarisch beschlagenen Claus Eggers konnten wir den »Zupfgeigenhansel« mehr oder weniger auswendig, und wenn wir »Wildgänse rauschen durch die Nacht / mit schrillem Schrei nach Norden« sangen, begleitet von meinen beiden mit »Zupfgeigen« vertrauten Brüdern, blieb kein Auge trocken. Aber das waren, wenn ich Herrn Landau folgte, Gebrauchslieder. Und »Am Brunnen vor dem Tore«, mein Lieblingslied? Das ist ein Volkslied. So ging es bis zum Ende des Mittagessens. Alles war immer etwas anderes, aber die wirklichen, wahren Gedichte hatte Stefan George gedichtet, nur er – und allenfalls Rilke – war im strengen Sinne ein Dichter.
Kein Wunder, dass ich mich für diesen Dichter zu interessieren begann, dessen eigentümlich gedruckte Bücher im Bücherschrank meines Vaters standen. Das soll nicht heißen, dass die übrige Welt mich kaltließ, im Gegenteil, ich nahm regen Anteil an unseren Diskussionen, die am Sonntag nach dem Essen bis in den Nachmittag hinein dauern konnten. Mein Vater hatte zum Beispiel einen Verwandten, der in Debrecen in Ungarn Theologie lehrte, wo gerade ein Volksaufstand gegen die moskauhörige Regierung von sowjetischen Panzern erstickt worden war – das hatte man, nach Chruschtschows Rede zur Entstalinisierung, »dem Russen« nicht zugetraut. Während »unser Hitler und seine Bande« 1956 sehr selten diskutiert wurden, saß – und ganz besonders in Berlin – der Russe eigentlich immer mit am Tisch, ein »an sich« netter Mensch, der auch nur leben wollte, aber von einer ungehobelten Bande regiert wurde, die nur Böses im Sinn hatte. Das reine Gegenstück zu dieser Bande gab es im Fürstentum Monaco zu bewundern, wo der Fürst Rainier III. erfolgreich um die Hand der amerikanischen Schauspielerin Grace Kelly geworben hatte. Unfassbar, mit welcher ironischen Herablassung in unserer Familie über den Fürsten gesprochen wurde, der natürlich, im eigentlichen Sinne, gar kein Fürst war, sondern ein dicklicher Operettenheini, der ein Spielcasino betrieb, um das herum ein paar Häuser standen, die er gut vermietet hatte. Und bei allem Respekt vor ihrer schauspielerischen Leistung war Grace Kelly, die bekanntlich Majer hieß, doch nicht plötzlich eine Fürstin, wenigstens nicht im deutschen Sinne. Was Schauspielerinnen betrifft, so wurde natürlich in jenem Jahr auch die Ohrfeige diskutiert, die Käthe Dorsch in Wien dem Kritiker Hans Weigel verpasst hatte (den der Theaterkritiker Edwin Maria Landau natürlich gut kannte, aber nicht verteidigte). Während meine Mutter den pragmatischen Standpunkt einnahm, dass eine Ohrfeige »dann und wann« nicht nur nicht schaden, sondern sogar zu mehr gegenseitigem Respekt führen könne, war mein Vater »vom Juristischen her gesehen« dagegen: »Wenn das jeder machen würde!« Es machte aber nicht jeder, so dass die nächste Ohrfeige erst viele Jahre später diskutiert werden musste, als nämlich 1966 Beate Klarsfeld dem gerade gewählten Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger eine verpasste.
Wir Kinder waren alle auf der Seite von Käthe Dorsch, die sich ja nur gewehrt hatte. (An diese Diskussionen musste ich denken, als kürzlich ein Choreograph mit der Hundescheiße vom eigenen Hund eine Kritikerin beworfen hatte.) Und schließlich wurde in genau jenem Jahr auch der Tod von zwei Dichtern diskutiert, die ganz in der Nähe von uns gelebt hatten: Gottfried Benn und Bert Brecht. Während Benn mit seinem Nebenjob als Hautarzt – mein Bruder Hanspeter: Geschlechtskrankheiten – noch gerade so durchging, wurde Brecht nur als fauler Fuffziger hingestellt, der sich »dem Russen« in die Arme geworfen hatte, aber seine Zigarren und Apfelsinen mit amerikanischem Pass im Westen kaufte. Über den Dichter Brecht, den ich drei Jahre später für mich entdeckte, kein Wort.
Aber immerhin: Es gab Dichter unter uns, deren Tod betrauert wurde! Der eine besaß sein eigenes Theater, in dem er seine eigenen Stücke aufführen konnte, der andere eine Arztpraxis – während der wahre Dichter, Stefan George, nichts besessen hatte außer den Kleidern auf seinem Leib. Nun war George natürlich im Vorteil, weil er – anders als Benn und Brecht – nicht mehrere Frauen zu versorgen hatte und damit auch keine Kinder, die ständig um ein Eis oder ein Fahrrad bettelten. Er war und blieb allein in der Runde seiner Freunde, so etwa mein Vater, und nur und ausschließlich seinem stetig wachsenden Werk verpflichtet.
Ich habe mich schon damals gefragt, was Dichter tun, wenn sie gerade nicht dichten. Ist Nicht-Dichten die Voraussetzung für das Schreiben von Gedichten? Und: Wie lebt ein Dichter? In Berlin, wo ich aufgewachsen bin, gab es damals keine Dichter, die ich hätte fragen können. Ich spreche natürlich von dem dichtungsfreien West-Berlin, denn im Osten der Stadt gab es zahllose Dichter, deren Namen auch hin und wieder in unserer freien West-Presse auftauchten, wenn sie unbotmäßige Verse verfasst hatten. Wir fanden die Zensur in der DDR, die manchmal einzelne Worte verbieten wollte, lächerlich und für die Ziele des Sozialismus untauglich, wie uns überhaupt die gesamte Organisation und Selbstdarstellung des anderen deutschen Staates spießig, kleinbürgerlich und verlogen vorkam. Aber man hielt lieber die Klappe. Die Dichter sollten selber sehen, wie sie sich mit dem Staat arrangieren wollten, sie brauchten keine Besserwisser aus der West-Zone, die durch Interventionen und Ratschläge die Sache nur schlimmer machten.
Doch, es gab einen wirklich großartigen Dichter in West-Berlin: Günter Bruno Fuchs. Mit seinem mächtigen Kopf mit der hohen Stirn sah er aus wie ein jüngerer Bruder von Balzac, auch er hatte einen stattlichen Bauch und einen unstillbaren Durst. Er passte überhaupt nicht in die Wohnblockästhetik in Wilmersdorf, wo er, als ich ihn noch in meiner Zeit als Lehrling kennenlernte, mit seiner Mutter in einer kleinen Dreizimmerwohnung lebte. Der Vater, ein ehemaliger Portier des Hotels Adlon, war in den Wirren der Nachkriegszeit »verschüttgegangen«, wie man in Berlin sagte, erst viele Jahre später tauchte er wieder auf und bat den Sohn um einen Besuch in seiner gepachteten Pension am Tegernsee. Weil Günter Bruno Fuchs einen solchen Bammel hatte, ihn wiederzusehen, bat er mich, der inzwischen sein Lektor war, ihn zu begleiten. Er wollte mit dem Zug nach München reisen, bei mir übernachten, am folgenden Tag Herrn Dr. Carl Hanser und seine Freunde im Verlag sehen, Fritz Arnold, Claus Seitz (den Hersteller und Grafiker, der die immer besonders »angezogenen« Bücher von Fuchs betreute) und Christoph Schlotterer, und am nächsten Tag, einem Freitag, wollten wir dann janz jemütlich seinen Vater und dessen neue Frau besuchen. Die auf drei Tage geplante, eine Woche dauernde Reise wurde ein Horrortrip. Es fing damit an, dass der dicke Mann mir aus dem Abteil mehr oder weniger entgegenfiel, weil er im Speisewagen einen »ganz hervorragenden Zeitgenossen« getroffen hatte, erste Güte, einen besseren Kenner des Bommerlunder findest du in ganz Deutschland nicht!, mit dem er die ganze Fahrt über getrunken und gesungen hatte, weil dieses Männlein, das der Zugbegleiter – ein Wort, wie für Günter Bruno Fuchs geschaffen – mit einem spitzen Finger aus dem Abteil befördert hatte, eben neben seinen Kenntnissen der ganzen Bommerlunder-Familie auch noch ein Spezialist für deutsche Volkslieder war. Und nichts ist ja ansteckender, als wenn man in fremder Umgebung »Am Brunnen vor dem Tore« singt und bei der zweiten Wiederholung dann »Am Tore vor dem Brunnen« und wenn aus dem Lindenbaum dann ein Fläschlein Wein wird und so weiter. Auch das Doppelsaale-Lied hatten sie zur Verblüffung der anderen Fahrgäste zum Besten gegeben: An der Doppelsaale hellem Doppelstrande / Stehen Doppelburgen / Hell und doppelkühn … Kurzum, der ganze Speisewagen hatte gesungen, und Günter Bruno hatte bezahlt. Er war pleite, die Reisekasse war leer. Aber Günter Bruno war glücklich! Den ersten Schritt seiner lange vorbereiteten Reise zu seinem Vater hatte er getan, jetzt sollte ich ihm helfen, den zweiten zu überstehen, der ihn ins Haus von Herrn Dr. Hanser und zur Kassette mit den Vorschüssen führen sollte, der Rest wäre leicht zu bewältigen.
Wie ich ihn, ohne seinen spindeldürren neuen Freund, in meine Wohnung verbracht habe, kann ich hier nicht beschreiben. Er hat so entsetzlich unter seinem Kater gelitten! Nachts hat er versucht, eine Flasche Wein zu öffnen, die ihm aus den Händen glitt, weil er durch den Brand in seiner Kehle zittrige Hände hatte, dann hat er sich ein mit 4711 getränktes Handtuch über Mund und Nase gelegt. Er hat die ganze Nacht über so geschrien vor Schmerz, dass ich auf dem Sofa im Nebenzimmer Angst hatte, er würde sich umbringen. Aber am Morgen war er dann gottlob eingeschlafen. Als ich in den Verlag fuhr, hatte er, in einem lichten Moment, seine Gastgeschenke auf dem Küchentisch ausgebreitet, eine Zeichnung, einen Holzschnitt und einen gerahmten Stich von einer Nachtigall, alles wunderschön beschriftet in seiner runden Schrift, die immer so perfekt aussah, als hätte die ausführende Hand nie ein Glas Alkohol gehalten.
Das Mittagessen mit Dr. Hanser wurde aus »organisatorischen« Gründen zu einem Nachmittagstee verkürzt. Es herrschte eine furchtbare Atmosphäre, weil die Fahne aus Alkohol und Kölnischwasser, in die Günter Bruno sich eingewickelt hatte, Frau Lotte Hanser in die Nase stieg und nicht weichen wollte: Zwei Stunden lang saß die Arme mit einem Taschentuch vor dem Gesicht da und staunte in einer Mischung aus Ängstlichkeit und Verblüffung diesen dicken Koloss an, an dessen Gedichten ihr Mann einen Narren gefressen hatte. Günter Bruno nahm nur Selters und Alka-Seltzer zu sich, und zwar in solchen Mengen, dass er ununterbrochen aufstoßen musste, wodurch die ohnehin anstrengende Konversation aus angefangenen Sätzen und entsetzlichen Geräuschen bestand, die Günter Bruno immer mit einem eleganten Ausruf verabschiedete: »Oh, Verzeihung! Was Sie nicht sagen! Dunnerlüttchen!« Ich war froh, als es überstanden war, von Geld war nicht die Rede gewesen, und alle meine Versuche, über die immer teurer werdenden Lebenshaltungskosten eine Brücke zu Günter Brunos Geldnot zu schlagen, verliefen unkommentiert.
Das kriegen wir schon hin, sagte ich zu ihm, als er endlich im Taxi saß, um sich bei mir auszuschlafen, damit wir am nächsten Morgen nüchtern zu dem eigentlichen Ziel der Reise aufbrechen konnten. Als ich am Abend (mit einem dicken Umschlag voller Geld, Herr Hanser hatte sich nicht lumpen lassen) nach Hause kam, bot sich mir folgendes Bild: Meine Nachbarin in dem Wohnblock in der Hildeboldstraße im Norden Schwabings, eine pensionierte Studienrätin für die naturwissenschaftlichen Fächer, mit der mich ein herzliches nachbarschaftliches Verhältnis verband, saß weinend auf der Treppe. »Ihr dicker Freund«, sagte sie, habe versucht, mit einem falschen Schlüssel ihre Tür aufzubrechen, und als sie öffnen ging, sei er mit einem »Grüß Gott, gnädige Frau« an ihr vorbeigegangen, direkt ins Schlafzimmer, wo er sich in ihr Bett gelegt habe und augenblicklich eingeschlafen sei. Sogar die Schuhe hat er anbehalten!
Ich ging also Herrn Fuchs wecken, der mir auch, etwas verwirrt vom Druck der veränderten Verhältnisse, in meine Wohnung folgte, nicht ohne sich mit den galantesten Sätzen der Aufmerksamkeit von der Nachbarin zu verabschieden.
Warum ich das so ausführlich erzähle? Weil auch das in die Enzyklopädie der toten Dichter gehört, und natürlich auch alle Folgen: Denn selbstverständlich wurde zum Beispiel meine Nachbarin eine treue Leserin der Gedichte von Günter Bruno Fuchs. Und Dr. Hanser, der mir das Geld nicht vor den Augen seiner Frau geben wollte, weil er sich nicht erklären wollte (oder konnte?), war natürlich ein heimlicher Bewunderer der Gedichte und Holzschnitte von Günter Bruno Fuchs, obwohl die beiden Leben auf den ersten Blick nichts miteinander gemein hatten. Dr. Hanser hat ihm schließlich auch das Geld für eine Druckmaschine geschenkt, auf der die schönsten Bücher in kleinen Auflagen gedruckt wurden: die »Rixdorfer Drucke«.
Am nächsten Tag fuhren wir an den Tegernsee. Ich besaß einen mehr oder weniger schrottreifen Karmann Ghia, einen »Nutten-Porsche« hat ihn Max Frisch einmal genannt, ein hellblaues Cabrio, das mir Horst Bienek zu einem moderaten Preis überlassen hatte. Herrliches Wetter, also Verdeck runter. Da saß der dicke Günter Bruno, zum ersten Mal in einem Cabrio, fast auf der Straße und grüßte nach allen Seiten seine neuen bayerischen Mitbürger. Zwischen den Beinen hatte er eine Kiste Bier platziert, damals noch mit den alten Verschlüssen, die satt schnalzten, wenn man sie öffnete: Bloppp … Er rezitierte Gedichte. Die Maus-Verse von Robert Walser kannte er auswendig, wenn ihm eine Zeile entfallen war, ergänzte er sie mit eigenen Worten. Nach Walser kam Scheerbart, von der Kater-Poesie konnte er jede Zeile sagen. Hielten wir an einer Ampel, begrüßte er die Wartenden mit der Scheerbart’schen Einsicht: Charakter ist nur Eigensinn, es lebe die Zigeunerin! Nicht immer wurde der seltsame Vogel freundlich zurückgegrüßt. Und auf der Autobahn folgte schließlich eine Mischung aus Eichendorff und Johannes Bobrowski. Bobrowski war sein Bruder Hannes, es war selbstverständlich, dass er einen großen Teil von dessen Werk immer vorrätig im Kopf hatte. Als ich ihm erzählte, dass Günter Eich und Ilse Aichinger nicht weit von der Abfahrt Tegernsee an der österreichischen Grenze lebten, war er nicht mehr zu halten. Wir müssen sie besuchen, und zwar sofort, der Vater könne schließlich noch einen weiteren Tag auf ihn warten. Aber ich blieb stur. Die Kiste Bier war schon mehr oder weniger ausgetrunken, ein Zwischenhalt bei den Eichs hätte zu einer Katastrophe führen müssen.
(Dass ich Günter Eich ein Jahr später in diesem himmelblauen Cabrio zur Verleihung des Prix Veillon nach Lausanne fahren durfte und wir bei dieser Gelegenheit Schwyzerdütsch zu lernen versuchten, ist eine andere Geschichte.)
Zu der Pension, die Günters Vater gepachtet hatte, musste man ein paar Stufen hinaufgehen, Günter kam schwer atmend oben an, es sah alles sehr leer aus. Auf der Theke der Rezeption lagen die Bücher von Ludwig Ganghofer, einem der bekanntesten bayerischen Autoren des 19. Jahrhunderts, der von den Tantiemen seiner Romane »Das Schweigen im Walde« und »Der Edelweißkönig« gut am Tegernsee leben konnte. Mit einem gewissen Neid berührte Günter die aufdringlichen Umschläge und schob die Bücher dann beiseite, um mit fester Hand die Klingel zu drücken. Eine Sekunde später stand sein Vater vor uns, ein kleiner, magerer Mann, der hinter der Tür zur Küche auf seinen Sohn gewartet haben muss. Ich war irgendwie überflüssig. Ich bin der Chauffeur, sagte ich und nannte meinen Namen, und der Vater schien zu überlegen, ob ich, wenn sein Sohn über Nacht bleiben würde, ein eigenes Zimmer brauchte, für umsonst. Leg erst mal ab, sagte er zu seinem Sohn, aber der Sohn hatte nur ein Hemd an, das er nicht ablegen wollte. Ich ruf dann mal meine Frau, damit du einen Kaffee kriegst, sagte der Vater. Ich habe den Namen der Frau vergessen, obwohl ich fest vorhatte, ihn mir zu merken. Wir saßen dann zwei bedrückende Stunden am Tisch, ich trank Kaffee, Günter und die Frau tranken Weißbier, Tegernseer Weiße, sagte die Frau und hielt ihr Glas in die Sonne, das gibt’s nur hier, obwohl auf dem Bierdeckel, der unter dem Glas lag, behauptet wurde, Tegernseer Weiße würde man überall auf der Welt schätzen. Noch ein zweiter Tisch war besetzt, mit schweigenden Norddeutschen, die es zu kalt für diese Jahreszeit fanden.
Ja, wie lange haben wir uns nicht gesehen, sagte der Vater. Und Günters Antwort: Darauf einen Dujardin!
Es war entsetzlich.
Nach zwei Stunden sagte ich: Ich lasse euch jetzt mal allein, damit ihr in Ruhe euer Wiedersehen feiern könnt.
Als ich zurückkam, saßen Vater und Sohn unter dem Kruzifix in einer Ecke der Gaststube, die Frau des Vaters saß bei den Gästen und trank schon wieder oder noch immer Tegernseer Weiße. Ich fuhr allein zurück, Günter fuhr am nächsten Tag direkt nach Berlin. Von seinem Vater haben wir nie wieder gesprochen.
1977, nicht einmal fünfzig Jahre alt, fand seine Mutter Günter Bruno tot vor der Schreibmaschine.
Ich habe immer wieder über diesen großen Dichter kleinere Dinge geschrieben.
Günter Bruno Fuchs
Leiterwagen
Da saß ein Mann im Leiterwagen,
hat nie geschlafen, nie gewacht,
hat hundert Jahre so verbracht –
saß antwortlos und ohne Fragen.
Hat nur ein einzig Mal gelacht,
als ihm der Tod das Bett gemacht.
Das wollt ich euch nur sagen.
Günter Bruno Fuchs war der erste Dichter, den ich berührt, das heißt, dem ich die Hand gegeben habe. Er hatte einen mächtigen Kopf mit riesiger Stirn wie Balzac, einen Leibesumfang wie Theodor Däubler, einen Durst wie Johannes Bobrowski und Uwe Johnson zusammen, und außerdem das große Herz eines erstaunten Kindes. Er war pazifistisch wie Paul Scheerbart, dessen »Katerpoesie« er auswendig konnte (»Guten Morgen, sprach das Menschentier / und mancher Schuft trinkt jetzt noch Bier!«), er beherrschte den Holzschnitt wie die alten Meister und die Feder wie Kubin, er liebte alte Holzlettern und die Poesie vom deutschen Barock über François Villon bis zu Peter Hille, er stellte wunderbare Pressendrucke in seiner Rixdorfer Werkstatt her und war überhaupt ein Buchnarr. Und er war es, der Paul Celan zu seinen einzigen wirklich heiteren Versen inspiriert hat: »In der R-Mitage, / da hängt ein blauer Page. / Da hängt er, im Lasso: / er stammt von Pik-As (so?) …«
Was dieser freundliche Dichter Günter Bruno Fuchs nicht besaß: Geld, Eitelkeit, Neid, Mitgliedschaft in der Akademie.
Hatte er gelegentlich einen über den Durst getrunken, konnte er wunderbare Unsinnsgedichte erfinden, die sich gottlob zu großen Teilen erhalten haben, wie die unvergängliche Nationalhymne der deutschen Toilettenfrauen, die mit dem wahrhaft gut beobachteten Vers endet: »Im deutschen / Manne / wohnt ein Kind, / das möchte immer / spülen.«
»Brevier eines Degenschluckers«, »Pennergesang«, »Blätter eines Hofpoeten« und »Handbuch für Einwohner« hießen seine wichtigsten Gedichtbände, die er alle selbst liebevoll ausgestattet hat. In Carl Hanser, meinem späteren Chef, hatte er einen loyalen Verleger, der wegen Fuchsens Sauferei zwar immer missbilligend den Kopf geschüttelt hat, die Kunst von GBF jedoch schätzte, wie übrigens auch Walter Höllerer, der diesen aus der Art und der Mode gefallenen Dichter immer gefördert hat. Denn Fuchs war in einem ganz und gar unideologischen Sinne ein Volksdichter, der den Stoff für seine vertrackten Balladen aus dem Milieu der Gaukler und Penner, Abrisskutscher und Leierkastenspieler bezog, die er sehr genau kannte: Es waren die vom Fortschritt geschnittenen Menschen, die ihn anzogen. Das gilt natürlich auch für den Mann im Leiterwagen, der die große Geschichte mit ihrem Lärm an sich vorbeiziehen lässt, ohne einen Mucks zu sagen. Er wird sowieso nicht gefragt. Er hat buchstäblichen keinen Reim auf die Welt, deshalb setzt ihm GBF ein gereimtes Denkmal. Und als der Tod kommt, der von allen gefürchtet wird, bricht der Mann im Leiterwagen in sein großes Lachen aus: Was kann ihm der schon antun!
*
Was also macht ein Dichter, wenn er nicht schreibt? Schreibt ES in ihm weiter? Und von was lebt er? Bei Goethe war die Sache einfach; er war fast zu viel auf einmal, Minister, fiskalischer Experte, Theaterdirektor, Aufseher der Bergwerke an der Ilm, da blieb ihm kaum Zeit; er musste also neben der wichtigen Arbeit für den Herzog die eigenen Sachen schnell aufs Papier bringen, wenn er sie festhalten wollte. Einige der großen Projekte, wie zum Beispiel den Roman über das Weltall, ließ er einfach liegen; sollten doch schwächere Talente sich des Stoffes annehmen. Außerdem war er ein Genie. Man konnte ihm ein beliebiges naturwissenschaftliches Problem vorlegen, schon hatte er eine Xenie dazu verfasst; bedeutende Gedichte schrieb er am Wochenende. Für »Wanderers Nachtlied« – das Gedicht Goethes, das immer wieder neu in alle Sprachen übersetzt wird – brauchte er oben vor dem Holzhäuschen auf dem Kickelhahn über der Ilm genau zwölf Sekunden. Da wurde nicht lange gefackelt. Und weil kein Papier zur Hand war, schrieb er die Zeilen eben einfach auf die Holzwand, die Herausgeber seiner gesammelten Gedichte würden es nach Goethes Abreise nach Italien schon finden.
Kurz vor seinem Tod hat Goethe die Hütte noch einmal besucht und das Gedicht gefunden, das inzwischen weltberühmt und von seinem Freund Zelter vertont worden war. Beim Wiederlesen habe Goethe Tränen in den Augen gehabt. Hans Blumenberg, der jede Zeile von und fast alles über Goethe gelesen hatte, behauptete, Goethe habe nur zweimal im Leben nachweislich geweint: auf dem Kickelberg beim Wiederlesen von »Wanderers Nachtlied« und als sein Freund Zelter dem krank im Bett liegenden Dichter dessen eigene »Marienbader Elegie« vorgelesen hat, ein Abschiedsgedicht auf die Liebe und das Leben. Das ist wichtig für unsere Enzyklopädie der Toten, weil andere Dichter viel öfter die Tränen haben fließen lassen. (Paul Hoffmann, dem Wärter im Hölderlin-Turm von Tübingen, dem ich Blumenbergs Tränen-These erzählt habe, war geradezu empört: Goethe habe ständig Zähren vergossen – und nicht nur beim Wiederhören der eigenen Gedichte. Vielleicht findet sich jemand, der darüber einen endgültigen Aufsatz schreibt: Goethes Tränen.)
Übrigens hat Goethe den größten Teil seiner lyrischen Arbeit ausdrücklich als Gelegenheitsgedichte bezeichnet, also Texte, die ihm gewissermaßen aus der Feder geflossen sind, während andere Dichter unter ungeheuerlichen Mühen ihre Verse zimmerten oder sogar an dieser Arbeit zerbrachen. Dieser Spagat ist bedeutsam in der Geschichte der Literatur. Hier der Dichter (wie Rückert), dem das Gedichteschreiben leichtfällt, dort der ständig Zweifelnde (Ludwig Greve).
Und von was lebten die Dichter? Wovon bezahlten sie Miete, Alkohol, Erholungsreisen? Schiller bezog für seine Vorlesungen als Professor für Geschichte in Jena Kolleg-Gelder, davon mussten er und seine Familie ernährt werden. Das war bekanntlich nicht einfach. Schiller war noch drei Jahre weniger auf der Welt als Günter Bruno Fuchs, nämlich nur sechsundvierzig. Gottfried Benn konnte nur schreiben, wenn ihn seine Patienten mit ihren Geschlechtskrankheiten in Ruhe arbeiten ließen, verdient hat er mit seinen über alle Maßen und bis an die Kitsch-Grenze schönen Gedichten kaum mehr als nichts. Ingeborg Bachmann hat nach zwei Gedichtbänden gesagt: Nun soll Schluss sein, es ist alles gesagt, was ich in Gedichten sagen kann. Sie wurde nicht einmal so alt wie Günter Bruno Fuchs und starb mit siebenundvierzig Jahren. Und die große Dichterin Christine Lavant? Sie schrieb nur, wenn es in ihr wütete; und Gott sei Dank war dafür Anlass genug. Ihr schmales Werk hat bis heute überlebt. Günter Eich lebte von Hörspielen. Peter Huchel war Redakteur einer Zeitschrift. Der große Formkünstler Ludwig Greve, Bibliothekar in Marbach, hat vielleicht hundert Gedichte in seinem Leben schreiben können, während Friedrich Rückert, Vater von zehn Kindern und Professor für Orientalistik, diese Anzahl in einem Monat schaffte: Von ihm sind mehrere tausend erhalten. Von Günter Eich stammt das schöne Gedicht »Zuversicht«:
In Saloniki
weiß ich einen, der mich liest,
und in Bad Nauheim.
Das sind schon zwei.
Einer, der sich von den Honoraren seiner Gedichtbücher ein Haus bauen konnte, war Eugen Roth. Er konnte über alles schreiben, über Krankheiten, Mode, Liebe, Tiere und den Menschen als solchen, nichts war ihm sperrig genug, um nicht doch in seinen Reimen bezwungen zu werden. Er hatte, wie Kafka, erste Bändchen in der Reihe »Der Jüngste Tag« veröffentlicht, expressionistisches Gefunkel erster Güte, aber bekannt wurde er mit seinen heiteren Versen, die buchstäblich millionenfach verbreitet sind. Als ich den alten Grantler, der nichts von einem heiteren Verseschmied hatte, einmal fragte, ob er – wie zum Beispiel Rilke – auch unter Schreibhemmungen gelitten habe, schaute er mich an, als hätte ich einen schlechten Witz gemacht: Rilke – rief er – der Rilke, naaa! Mehr war nicht aus ihm herauszulocken.
Von Rilke – letztes Beispiel – wissen wir, dass er nach Jahren des Nicht-Schreibens, in denen er nur in unzähligen Briefen an seine adligen Gönnerinnen von dieser Blockade berichten konnte, plötzlich und in kürzester Zeit die Duineser Elegien aufs Papier gebracht hat, die zu den großen Werken des Dichters und zu den größten im 20. Jahrhundert gehören.
Ich habe mein ganzes Leben mit Dichtern verbracht. Trotzdem frage ich mich immer noch, was es ist, das sie von anderen Schriftstellern (und allen anderen Menschen) unterscheidet. Auf den folgenden Seiten habe ich versucht, einige dieser Dichter, denen ich begegnet bin und an die ich immer mit Dankbarkeit denke, zu beschreiben. Keine Angst, ich will keinen mit abseitigen Liebhabereien quälen, sondern nur ein bisschen Reklame für die Lyrik und andere verwandte Formen machen, denn es will mir einfach nicht in den Kopf, dass nicht jeder, der noch seine fünf Tassen im Schrank hat, an der Schönheit und Vielfalt von Gedichten sich erfreuen kann. Aber ich kenne die Auflagen der Gedichtbände meiner Freunde und weiß, was sie, die nichts als Freude bringen, leiden müssen.
In diesem Buch kann es nicht systematisch zugehen. Ich bin Dichtern begegnet, bevor ich eine Zeile von ihnen gelesen hatte, und ich habe Gedichtbände gekauft und gelesen, ohne auch nur zu ahnen, dass ich ihren Autoren einmal begegnen würde. Und ferner kommen in diesem Buch nur Dichter vor, über die ich schon einmal geschrieben habe: in Vor- und Nachworten, bei Preisverleihungen oder Lesungen, meistens in Nachrufen. In der »Enzyklopädie der Toten« sind sie nicht tot, das sage ich nicht nur zur Beruhigung. Kürzlich, am 14. Juli 2024, sprach ich mit Peter Handke in einem Biergarten in München über unseren gemeinsamen Freund Nicolas Born, der 1979, in jeder Hinsicht zu früh, gestorben ist. Ist der auch schon vergessen?, fragte ich bange. Peter Handke war empört! Solange wir über ihn sprechen, ist er nicht tot – oder?
Ich habe, ohne dies näher begründen zu wollen, als Ordnungsprinzip die Wohnungen gewählt, in denen ich gelebt habe – und in denen viele der Dichter für eine Nacht oder länger meine Gäste waren. Ein seltsames Ordnungsprinzip, aber es gefällt mir besser als das Alphabet von A wie Artmann bis Z wie Zagajewski.
Die Augen von Michael Krüger, Radierung von Jan Peter Tripp
Dichter in der Hildeboldstraße
Um die Mitte der sechziger Jahre zog ich nach München. Ich hatte kein Geld und war froh, in einem nicht besonders schönen Neubau in der Hildeboldstraße in Schwabing eine Wohnung gefunden zu haben.
Von der Hildeboldstraße hat mein Freund Herbert Heckmann, der im ländlichen Bad Vilbel zu Hause war, einmal gesagt, sie sei vielleicht eher nicht zu den schönsten Straßen von München zu rechnen. Das war umständlich-freundlich ausgedrückt, denn tatsächlich war sie eine der hässlichsten Straßen in der Stadt. Wer auf die Idee gekommen ist, die völlig gesichtslosen Häuser nach dem Minnesänger Hiltbolt von Schwangau aus dem 13. Jahrhundert zu benennen, ist nicht bekannt, aber da ihn sowieso keiner kannte, bereitete dieses Problem auch kein Kopfzerbrechen. Die einzige Frage, die diese arme Straße aufwarf, war, ob sie mit dt oder nur mit d geschrieben wird. Manchmal, wenn ich mit Christian Enzensberger beim Abendessen Listen der attraktiven Berufe aufstellte, meldete ich mich für das Amt des Direktors der Straßennamen an, weil ich in einer Studie des russischen Formalisten (und Freundes von Achmatowa) Boris Eichenbaum gelesen hatte, wie schwer und interessant es war, die russischen Straßen nach der Revolution umzubenennen: Wie aus dem Tulpen-Weg die Straße des Friedens werden sollte, das war die entscheidende Frage. Und was sollte aus der Hildeboldstraße werden? Christian favorisierte das Amt eines Erneuerers der Musik in Flugzeugen: Er war wild entschlossen, die Musik, die einen zum Beispiel beim Landen in Wien berieselte, Wiener Walzer, was denn sonst, auszutauschen. Aber gegen was?
Die Wohnung in der Hildeboldstraße war billig, als ich den Neubau 1968 bezog. Sie hatte zu den zwei kleinen Zimmern, Küche und Bad einen winzigen Balkon, auf dem ich in einem Liegestuhl lesen konnte, und sie ging von der Schleißheimer Straße ab, auf der einen die Tram in zehn Minuten in die Museen oder in die Innenstadt brachte. München war damals immer noch die Residenz-Stadt, deren Zentrum man mit dem Fahrrad in zehn Minuten durchfahren hatte: Uni, Stabi, Museen, Theater, Parlament, alles lag schön geordnet zusammen. Auf der andern Seite der Schleißheimer war man schon in einem älteren Schwabing, da wohnten, fünf Minuten von mir entfernt, Tankred Dorst und Ursula Ehler, und das hieß, einmal in der Woche gutes Essen und viele Gäste: Christian Enzensberger, Keto von Waberer, Rudolf Augstein, Max und Marianne Frisch und die Baumgarts, vor allem aber die Theaterleute: Peter Zadek und seine Truppe allen voran.
Bei mir ging es spartanischer zu, aber es war trotzdem immer viel los. Als ich mit dem schon erwähnten Herbert Heckmann die Anthologie von Kindergedichten, »Kommt Kinder, wischt die Augen aus, es gibt hier was zu sehen«, zusammenstellte, mussten wir mit den Fotokopien auf den Balkon ausweichen, weil der Platz in der Wohnung nicht ausreichte. Aber hier will ich von einem Besuch vor und einem Besuch nach Günter Bruno Fuchs berichten, von Wolfgang Bächler und Oskar Pastior.
Wolfgang Bächler hatte ich schon in Berlin kennengelernt, also vor 1968. Eine Freundin hatte mich angerufen, ich solle umgehend zum Hotel am Steinplatz kommen, dort habe sich ein Dichter eingeschlossen, der suizidgefährdet sei. Wer sich nicht nur für Dichtungen, sondern auch für Dichter interessierte, war offenbar auch Suizid-Spezialist. Tatsächlich hatte Bächler alle beweglichen Möbel von innen vor die Tür geschoben, weil er Angst hatte, dass Reinhard Gehlens Bundesnachrichtendienst ihm auf den Fersen war. Lieber von eigener Hand sterben als von den Gehlen-Leuten umgebracht werden. Da ich zurzeit in Berg über dem Starnberger See lebe, gehe ich manchmal, nach dem Kauf der Zeitungen, auf den Friedhof von Aufkirchen, um diese dort auf einer Gartenbank zu lesen, und immer wenn ich am Grab des unangenehmen Kriegsgewinnlers Gehlen vorbeikomme, muss ich an Bächler denken. (Ein paar Schritte weiter ist das Grab von Heinz Rühmann, an den ich die besten Erinnerungen habe, und in einer Ecke liegen die sterblichen Reste des Sängers Fred Bertelmann begraben, der mit seinem Schlager »Der lachende Vagabund« einmal der Schwarm meiner Tanten war.) Es bedurfte all meiner Überredungskunst, Bächler zur Aufgabe zu bringen. Misstrauisch öffnete ein bärtiger Mann mit schweren Augenlidern die Tür und ließ mich ein. Er kam, wie er sagte, gerade aus Paris, wo er mit Sartre und anderen Geistesgrößen an einer neuen Friedensordnung gearbeitet habe, und berichtete haarklein von einem Essen mit Celan, mit dem ihn eine alte, feste Freundschaft verband. Nun habe er auf dem Weg nach Budapest, wo er in geheimer Mission Georg Lukács treffen müsse, in Berlin einen Zwischenstopp eingelegt und sei von Gehlens Agenten ins Visier genommen worden. Wolfgang sprach glasklar in Rätseln, er war ganz offenbar gestört. Ein Arzt wurde gerufen, der ihn beruhigte und in ein Krankenhaus brachte, ich ging in die Buchhandlung von Marga Schoeller auf dem Kurfürstendamm und kaufte mir seine Bücher, die unter Fritz Arnolds Leitung und mit dem Lektorat von Wieland Schmied bei der Insel erschienen waren. Auf den Rückseiten standen die Lobesworte von Gottfried Benn. Benn hatte nicht übertrieben, wie er es gerne tat, um sich die jungen Leute vom Hals zu halten: Bächler war ein herausragender Dichter, manche seiner oft gereimten Gedichte waren von einer ziehenden Melancholie grundiert, ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Besonders die Verse, die noch unter dem Eindruck des Krieges geschrieben waren, hatten es mir angetan. Als ich später erfuhr, dass sein Vater Landgerichtspräsident in Augsburg war, musste ich an das Schicksal von Daniel Paul Schreber denken, dessen »Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken« in unserer Familie eine große Rolle spielten; Wolfgang kannte sie nur vom Hörensagen.
Ein halbes Jahr später, ich hatte gerade mein Untermieterzimmer in Pasing verlassen und mich in der Hildeboldstraße »eingerichtet«, das heißt die Matratze ausgelegt und die Bücher in den Ecken gestapelt, rief mich Wolfgang Bächler an. Er war am Bahnhof angekommen und wolle gerne mein Angebot annehmen, mit mir bei einem Kaffee über seine Zukunft als Autor zu sprechen. Es war ein Wochenende, ich saß friedlich auf meinem Balkon und las schreckliche Manuskripte. Aber: Ein Edelmann steht zu seinem Wort, wie Lettau immer sagte, wenn es brenzlig wurde, also sagte ich: Komm vorbei.
Er kam: ein durch den Aufenthalt im Krankenhaus noch einmal gealterter, hinkender Mann, der auf meinem einzigen Stuhl saß und mit zittrigen Fingern eine Zigarette nach der andern rauchte. Ich saß ihm auf einer Truhe, in der meine Kleider und die Bettwäsche untergebracht waren, gegenüber und musste zu ihm aufsehen. Irgendwann schlief er im Sitzen ein. Bächler war nicht allein gekommen, sondern in Begleitung einer alten Aktentasche und dreier unförmiger Koffer, die nichts Gutes verhießen. Ich lief los, um etwas zu essen zu kaufen, weil der Kühlschrank noch buchstäblich leer war, und als ich nach einer halben Stunde zurückkam, hatte sich Wolfgang bereits eingerichtet, das heißt alle seine Sachen in den beiden Zimmern verstreut und sich selber auf der Matratze zu einem tiefen Schlaf niedergelassen.
Er blieb. Rauchte, telefonierte, kritzelte mit einer schönen, aber unleserlichen Schrift Worte in ein Notizbuch. Wahrscheinlich Sütterlin. Er rief Martin Walser an, Heinz Friedrich, damals Chef des Deutschen Taschenbuch Verlags, Hans Werner Richter, seinen Vater – aber auch Freunde in Frankreich und weiß Gott wo. Damals war Telefonieren noch sehr teuer, und wenn ich ihn bat, sich kurz zu fassen, schaute er mich so traurig (oder eher schelmisch-traurig) an, dass ich mir wie ein geiziger Schuft vorkam. Abends gingen wir in den »Fallmerayer Hof« oder das Rationaltheater und tranken ein Bier, da erzählte er uns, seinen mit der Zeit zahlreicher werdenden Freunden, seine Lebensgeschichte: seine Herkunft, seine Einberufung, seine Verwundung, seine Untauglichkeit, seine geschiedene Ehe in Frankreich. Und wenn er seine manischen Phasen hatte, dann drehte er hoch auf: ließ Pferde aus der Reitschule in das Café am Siegestor bringen, wo er mit Godard einen Film drehen wollte, oder er fand in seinem Mantel den vergessenen Schlüssel zu einem Hotel in der Fürstenstraße, da ging er hin und legte sich in ein Bett, das einer berühmten Schauspielerin gehörte, die nur auf Intervention von Martin Walser, den ich nachts angerufen hatte, von einer Anzeige (und einer weiteren Unterbringung in der Klinik in Haar) abzubringen war. Wolfgang kostete viel Zeit und viel Geld, viele Freunde hatte er nicht. Außer dem immer generösen Martin Walser, der ein Nachwort zu den bei Hanser veröffentlichten Träumen von Bächler schrieb und gelegentlich etwas Geld schickte, und Heinrich Böll, den man immer um Rat fragen konnte, war keiner der alten Freunde mehr erreichbar. Der jüngste Vorleser bei der Gruppe 47 galt als schwierig oder verrückt. Aber irgendwann war er dann »eingestellt« und ging »in andere Hände über«, er fand eine Wohnung, erhielt seine Kriegsversehrtenrente, ich schrieb für die Taschenbuchausgaben seiner früheren Bücher Nachworte und über neue Ausgaben Rezensionen, und ganz am Ende hat dank der Generosität von Monika Schoeller der Fischer Verlag noch seine »Gesammelten Gedichte« veröffentlicht, mit einem Nachwort des gerechten Albert von Schirnding. Und ein neuer Beruf hatte sich für ihn aufgetan: Er wurde Schauspieler. Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Peter Laemmle »buchten« ihn für kleine Rollen, und hätte er mehr Text behalten können, wäre es eine richtige Filmkarriere geworden.
Er starb 2007, drei Kilometer von mir entfernt, in der Steinheilstraße in München; zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag, zur Jahrtausendwende, schrieb ich in seinem Namen den Brief an die deutschen Akademien:
Brief des Dichters Wolfgang Bächler an die deutschen Akademien
Hohe Herren von der Akademie –
bitte erlauben Sie, dass ich mich vorstelle, bevor ich Ihnen mein Anliegen, das Sie gewiss sorgfältig bedenken werden, vortrage. Und bitte üben Sie Nachsicht. Ich verfüge über keinen Computer, sondern benutze immer noch meine alte Schreibmaschine, deren Tasten sich nur mühsam dazu überreden lassen, ordentliche Sätze zu bilden. Auch das Farbband ist rissig geworden, und der Zeilenabstand schwankt. Da ich jedoch mein ganzes Leben keinen treueren Begleiter gehabt habe als diese inzwischen in Museen als seltenes Exponat bestaunte Reiseschreibmaschine, will ich für den Rest meiner Tage nicht auf andere Mittel sinnen, um mich deutlich zu machen. Meine Handschrift will ich Ihnen nicht mehr zumuten. Als junger Mann wurde ich gezwungen, die Sütterlinschrift zu erlernen, die heute kaum einer entziffern kann; manchmal ist es mir selbst nicht mehr möglich, meine Handschrift zu lesen. Sie zerfällt. Sie kann das Leben, das ich ihr zugemutet habe, nicht halten.
Hohe Herren! Mein Name ist Wolfgang Bächler, ich bin Verfasser von 2 kurzen Romanen, eines halben Dutzends Bände mit Gedichten, zweier Sammlungen meiner Träume und einer Sammlung ausgewählter Prosastücke, die teils im Auftrag von Zeitungen und Rundfunkstationen, teils ohne Auftrag entstanden. Mein erster Gedichtband erschien 1950 im Bechtle-Verlag in Esslingen. Er trug eine Einbandzeichnung von Martin Andersch und kostete DM 2,50. Gottfried Benn mochte ihn, Oda Schaefer lobte in der FAZ seine »kühnen Vergleiche und mutigen Aussagen«, Ernst Penzoldt forderte in der Süddeutschen Zeitung dazu auf, ihn zu kaufen. Die Widmungsgedichte in der »Zisterne« verraten meine frühen Freundschaften: Günter Eich, Hans Georg Brenner, Stephan Hermlin, Hans Werner Richter. Ich gehöre zu den sog. Gründungsmitgliedern der Gruppe 47. Als kürzlich deren 50. Geburtstag gefeiert wurde, hieß es von ihren Gegnern, die Mitglieder hätten das geistige Klima der Nachkriegszeit bestimmt und sich gegenseitig alle bedeutenden Literaturpreise zugeschanzt. Das gilt nicht für mich. Tatsächlich habe ich nie einen der mehr als dreihundert verschiedenen Literatur- oder Kulturpreise erhalten, die jährlich vergeben werden. Seit 1950, also seit 50 Jahren, wurde ich mit schöner Regelmäßigkeit nicht berücksichtigt. Natürlich fragt man sich, wenn man nun bald 75 Jahre alt wird, wie es kommt, dass andere Dichter, Mitglieder oder Nichtmitglieder der Gruppe 47 oder anderer Gruppen, bis zu fünfzehn Preise im Leben einheimsen konnten, während man selbst immer leer ausging. Gab es künstlerische oder politische Gründe? Auf jeden Fall wurde noch nie eine Rede auf mich gehalten. Noch nie hat mir ein Kulturdezernent einen Scheck übergeben. Nie durfte ich als Preisträger neben der Frau des Bürgermeisters sitzen. Noch nie ist einer meiner Verlage in die Verlegenheit gekommen, eines meiner Bücher mit einer Bauchbinde versehen zu müssen: Benn-Preis, Büchner-Preis, Kaschnitz-Preis, Nossack-Preis. Ich musste, mit anderen Worten, meinen dunklen Anzug nur zu Beerdigungen aus dem Schrank holen.
Mein zweiter Gedichtband – »Lichtwechsel« – erschien fünf Jahre später, wieder bei Bechtle. Er war, wie es damals modern war, aus der halbfetten Futura gesetzt und enthielt einige Tuschen von hap Grieshaber. Auf der hinteren Klappe ermunterten mich Thomas Mann, Gottfried Benn, Karl Krolow und Wieland Schmied, aber offenbar waren die Mitglieder der Preisjurys nicht so weit gekommen. Ich war inzwischen dreißig Jahre alt. Geboren wurde ich in Augsburg (übrigens an Goethes Todestag, deshalb mein Vorname), die Schule habe ich in Memmingen besucht, Hitler hat mir einen kleinen Teil der Welt gezeigt und mir dafür bis heute den Schlaf geraubt, studiert habe ich in München, aber nicht lange. Ich bin 1956 nach Paris gegangen, später habe ich im Elsass gelebt (und geheiratet: meine beiden Töchter leben in Frankreich), als geschiedener Mann bin ich 1967 zurückgekehrt nach München, wo ich seither mich aufhalte.
Mein dritter Gedichtband hieß »Türklingel« (1962) und enthielt ein langes Poem über Budapest, in dem der ungarische Philosoph Georg Lukács eine Hauptrolle spielt. Ich war der tollkühnen Ansicht, dass wir den Kalten Krieg so schnell wie möglich beenden sollten. Vielleicht war das der Grund für meine Zurücksetzung?
1963 erschien bei der Insel in Frankfurt mein Gedichtband »Türen aus Rauch«; später hat sich der S. Fischer Verlag meines Werks angenommen und die alten und neuen Gedichte und den Roman »Einer, der auszog, sich köpfen zu lassen« in gebundenen und broschierten Ausgaben zugänglich gemacht, zum Teil mit ehrgeizigen und schönen Nachworten von Peter von Becker und Michael Krüger. Sogar mein kleiner Roman »Der nächtliche Gast« hat es seit seiner ersten Auflage 1950 in der Eremitenpresse zu einigen Nachdrucken gebracht, obwohl sein Held ›Ritschi‹ Katzeck so gar nicht in das Milieu der älter werdenden Bundesrepublik passte.
Und schließlich muss ich noch meine Traumprotokolle erwähnen, die in zwei Bänden vorliegen. Der erste erschien, mit einem Nachwort meines Freundes Martin Walser 1972 in der Reihe Hanser, der zweite unter dem Titel »Im Schlaf« 1988 bei S. Fischer. Herr Walser schrieb in seinem bis heute lesenswerten Nachwort: »Es gibt über den sogenannten Literaturbetrieb der letzten 20 Jahre kein realistischeres Buch als diese Sammlung aufgeschriebener Träume.«
Das, hohe Herren von der Akademie, war der kurze Überblick über mein in Büchern veröffentlichtes Werk. Die unzähligen Arbeiten für die Presse und den Rundfunk ergeben sicherlich noch einmal denselben Umfang, nicht zu reden von den Korrespondenzen, die ich seit Kriegsende mit unzähligen Schriftstellern und anderen Geistesschaffenden geführt habe, die aber leider nie in eine lesbare Ordnung überführt worden sind. Sie dürften, in einer strengen Auswahl, die sich nach der Interessenlage der gegenwärtigen Generation zu richten hätte, gut und gerne 3-4 Bände ergeben. Es wäre lobenswert, wenn die den deutschen Akademien zur Verfügung stehenden Publikationsabteilungen eine solche Edition mit Briefen von Persönlichkeiten wie Paul Celan, Johannes Bobrowski oder Jean-Paul Sartre (Frankreich) der Öffentlichkeit zugänglich machen würden.