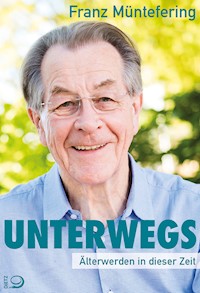
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Älterwerden heißt leben. Das ist eine spannende Sache. Und für die meisten von uns geht sielänger als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. So ergibt sich Gelegenheit, unterwegs zu sein, sich einzumischen, Mitverantwortung und Selbstverantwortung zu übernehmen und zusagen, wohin die Reise geht. Das Alter und die Älteren, ein Problem? Sie sind auch die Lösung. Franz Müntefering schreibt unbeschwert, aber nachdenklich über das alltägliche Leben im Älterwerden, über Mobilität und Begegnung, über Gesundheit und Sterben, über Solidarität zwischen Menschen, über Europa und unsere Demokratie und, mit besonderer Dringlichkeit, über die Frage, wie wir den künftigen Generationen die Welt hinterlassen. Sein Buch ist getragen von der Zuversicht, dass Dinge gestaltbar sind, abhängig von der Bereitschaft zum Engagement und vom Mut zum Handeln – in der Politik, in der Gesellschaft und persönlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
FranzMüntefering
UNTERWEGS
Älterwerden in dieser Zeit
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8012-7015-5 (E-Book)ISBN 978-3-8012-0543-0 (Printausgabe)
Copyright © 2019by Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbHDreizehnmorgenweg 24, 53175 Bonn
Cover: Birgit Sell, KölnUmschlagfoto: Michael GottschalkSatz: just in print, BonnE-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, 2019Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet: www.dietz-verlag.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
I.
ÄLTERWERDEN IN DIESER ZEIT
II.
AKTIV UND ENGAGIERT BLEIBEN
III.
STAATSANGEHÖRIGKEIT: DEUTSCH
IV.
SOZIALDEMOKRAT WERDEN UND SEIN
V.
BÜCHERFREUND AB 16
VI.
LEBENSLANGE TÜFTELEI MIT WORTEN
VII.
STERBEN ALS TEIL DES LEBENS
VIII.
UNTERWEGS MIT ZUVERSICHT
Über den Autor
das Leben ist für jeden Menschen die einmalige Chance, aus ihm was zu machen, dieses Leben nicht mehr oder weniger ungeliebt und ungenutzt verstreichen zu lassen, auch nicht zum Ende hin. Ob das gelingt, hat nicht nur mit seiner Dauer zu tun. Denn wie immer: Quantität ist nicht garantiert auch Qualität. Aber hinreichend lange zu leben vergrößert doch die Chancen. Das gilt und spornt an, älter zu werden und dabei lebendig zu sein.
Wir leben deutlich länger, als Menschen vor unserer Zeit es getan haben. Im Durchschnitt. Aber doch viele – und viel mehr als früher, in Deutschland zum Beispiel. Und zwar relativ gesund. Wohlstand und Hygiene und Hochleistungsmedizin und Frieden spielen dabei eine große Rolle.
In so großer Zahl länger zu leben, älter zu werden und alt zu sein, ist ein neues Stück Menschengeschichte, denn das gab es so noch nie. Gerontologen und Soziologen, Philosophen und Allgemeinmediziner, Psychologen und Pflegefachkräfte finden hier ein breites Arbeitsfeld. Auch die Politik. Auch die Gesellschaft, und – in ihr – die Familien. Die Kommunen.
Ich stehe mit 79 Jahren nicht mehr wirklich in der Mitte meiner Lebenszeit, habe aber doch noch einige Jahre vor mir, hoffe ich (man kann sich ja nie sicher sein). Jedenfalls bin ich mit Zuversicht unterwegs. Das Leben bleibt interessant, jeden Tag, persönlich und privat, gesellschaftlich und politisch.
Von Hannah Arendt stammt das Wort von der »Politik als angewandte Liebe zum Leben«. Ich finde, da ist viel dran, an der Liebe zum Leben und an der Rolle, die das Miteinander dabei spielt, also auch das Politische. Im Staat und in der Gesellschaft. Und darum geht es in diesem Lesebuch. Um das einzelne Leben und das eigene Leben und das Leben miteinander.
I. ÄLTERWERDEN IN DIESER ZEIT
»Älter wird man von alleine, darüber muss man sich keine Gedanken machen.« – Das Bonmot ist nicht neu, aber falsch wie eh und je. Älter werden wir vom ersten Lebenstag an, und wir machen uns auch Gedanken darüber, sonst gäbe es weder Kindergarten noch Schule noch Ausbildung noch Studium noch Weiterbildung. Wir machen uns Gedanken bis zum Berufsende. Danach ist weitgehend offenes Feld. Wird sich schon finden. Nichts tun müssen ist doch einfach. Aber das stimmt so nicht. Und das ist wichtig für die, die schon älter sind, und für die, die es werden.
Lassen Sie uns darüber ein wenig nachdenken und reden.
Es ist nicht egal, wie wir älter werden. Und die meisten von uns werden tatsächlich alt. Die Lebenserwartung liegt bei rund 80 Jahren, bei Frauen höher als bei Männern. Sie wird bald zwischen 83 und 85 Jahren liegen, und der Zenit ist auch damit noch nicht erreicht.
Die meisten von uns werden relativ gesund alt. Es kommen richtig gute Lebensjahre obendrauf. Lebensqualität im Älterwerden und im Altsein ist möglich. Auch im Sterben. Und wir haben Einfluss darauf. Wir sind nicht allmächtig, aber auch nicht ohnmächtig. Wenn man das Leben mag, und man sollte es mögen – denn wir sind hier alle mutmaßlich nur dieses eine Mal dabei –, dann macht es Sinn, aufs eigene Leben Einfluss zu nehmen.
Bevor man aus dem Berufsleben ausscheidet, sollte man wissen, wie man in Zukunft leben will. Vorläufig. Variieren kann man ja immer noch. Jede und jeder hat Prioritäten. Nichts mehr wollen vom Leben wäre die schlechteste aller möglichen.
Wir lernen gerade, auch als Gesellschaft, mit dem Älterwerden umzugehen. Nur unsere Sprache hat sich noch nicht so richtig darauf eingestellt. Wann werden wir älter und wann sind wir alt? Heute sind in Deutschland rund 5 Millionen Menschen älter als 80, um die Jahre 2035/2040 werden es 10 Millionen sein. Die allermeisten davon so fit, dass sie alleine für sich sorgen können, autonom. Unsere Hochleistungsmedizin hat da eine wesentliche Rolle, aber auch der relative Wohlstand, die Hygiene, der Arbeitsschutz wirken sich aus. Kinder sterben nicht mehr als Säuglinge, Mütter nicht im Kindbett, Männer nicht an gefährlichen Maschinen, viel weniger Menschen im Straßenverkehr. Und seit nun rund 74 Jahren gab es an dieser Stelle, in Europa, keinen Krieg, anders als in den Jahrhunderten zuvor. Ja, Europa!
Unsere Sprache fremdelt. Die Jungen wollen gerne als 17-Jährige schon bei den Senioren spielen, denn die Senioren sind die Vollwertigen. Mit 32 bis 35 beginnt beim aktiven Fußball der Trend zu den »alten Herren«. Mit vierzig wollen alle wieder jung sein, und so ab 50 werden wir älter, aber möglichst nicht alt. Es könnte dem Sprachsinn nach ja auch sein, dass die Älteren älter sind als die Alten, aber das ist nicht gemeint. Die, die älter sind als die Alten, das sind die Hochaltrigen, und die werden ja auch noch älter. Wir haben, ziemlich lange in unserem Leben, die freie Wahl, wo wir uns selbst einordnen.
Wann ist man alt?
Ich bin 1940 geboren, 79 Jahre alt. »Wie alt fühlen Sie sich«, fragen hin und wieder die Leute. Wie 79, ich kenne ja meinen Geburtstag. Fühlen Sie sich nicht etwas jünger, vielleicht 75? Nein, ich verlasse mich aufs Wissen und ich weiß, dass ich 79 bin. Fühlen Sie sich alt? Nein – ich bin alt, 79 ist alt. Und so ähnlich. Dieses Sich-jünger-fühlen-Sollen mag ich nicht, denn es überdeckt, dass man 79 und relativ gut drauf sein kann. Ich bin ja nicht versehentlich 79, sondern absichtlich.
Manche mögen das Wort Senioren nicht, wissen aber auch kein anderes. Wenn ich zu der Seniorin Alte sage oder zu dem Senior Alter, sind die meistens nicht begeistert. »Alter Schwede« ist erlaubt, aber da fängt die Kumpelei an, die alles erlaubt. Schließlich könnte man das Älterwerden und Altsein subjektivieren – und jede und jeder hätte so sein eigenes Alter. Aber was wäre dann mit Schulpflicht, Führerscheinerlaubnis, Wahlrecht und Renteneintrittsalter? Das ist eine hübsche Frage fürs Konversationslexikon. Aber jetzt geht es weiter mit dem Älterwerden in dieser Zeit.
Ansprechpartner zum Thema »Älterwerden« sind der Staat, die Gesellschaft und wir jeweils als Einzelne.
An den Staat haben wir die Erwartung, dass er Gerechtigkeit und Freiheit garantiert, Gerechtigkeit auf gutem Niveau und Freiheit auch als umfassende Sicherheit. Wir wollen uns auf die sozialen Sicherungssysteme für Gesundheit, Rente und Pflege verlassen können. Der Staat muss das organisieren. Aber Versicherung heißt hier: Die Jungen zahlen für die Alten, die Gesunden für die Kranken, die Fitten für die Pflegebedürftigen. Jeder Mensch, der einzahlt, ist potenzieller Empfänger.
Aber es geht nicht nur um die Zuverlässigkeit der sozialen Sicherungssysteme. Viel hängt ab von der Entwicklung unserer Kommunen, der großen und der kleinen, einschließlich der Kreise und der zivilgesellschaftlichen Präsenz. Am ehesten hier – vor Ort – kann man die nötigen strukturellen Lösungen erwarten. Der 7. Altenbericht, der von der damaligen Bundesregierung erst spät beantwortet wurde und dessen Beratung und Umsetzung hoffentlich bald auf die Tagesordnung dieses Bundestages kommt, bietet gute Ansätze und Vorschläge zum Thema. »Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften«, so lautet der Titel des Altenberichts. Es geht da um den Auftrag, »Merkmale einer zeitgemäßen, aktivierenden lokalen Seniorenpolitik« herauszuarbeiten. Die Befunde und Vorschläge zur Umsetzung sind interessant bis dringend empfehlenswert. Die alte Bundesregierung – unter der Federführung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen, Jugend – hat sachlich klare Position zu den Forderungen des Altenberichts bezogen, der feststellte, »dass starke, handlungsfähige Kommunen von zentraler Bedeutung sind, um im demografischen Wandel die Politik für ältere und mit älteren Menschen vor Ort wirkungsvoll weiterzuentwickeln«.
Die Quartiersentwicklung, die sich an vielen Orten zeigt, ist ein guter Ansatz. Seniorenbeiräte, Mehrgenerationenhäuser, lokale Allianzen für Menschen mit Demenz, Hospiz- und Palliativvereine und -dienste auch. Und manches andere mehr. Es geht um die Frage, ob es ein Grundangebot im Bereich Seniorenpolitik geben sollte, das für jede Kommune verbindlich ist, unabhängig von ihrer eigenen finanziellen Kraft. Das könnte bedeuten, die Altenhilfe (wie es die Kinder- und Jugendhilfe seit Langem sind) zu einer kommunalen Pflichtaufgabe zu machen und so auch ein kommunales Basisbudget für die gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit zu erreichen. Es könnten den Kommunen auch speziellere Aufgaben zugeordnet werden. Auf jeden Fall müssten sie dafür mit Handlungsmacht und Finanzen ausgestattet sein. Das wiederum ginge nur im Gleichklang von Bund und Ländern, was die Sache in der Regel nicht einfacher macht. Dass die Aufgabe anstrengend wird, darf nicht dazu führen, sie auf die lange Bank zu schieben oder den ganzen 7. Altenbericht ins Museum zu stellen.
Was immer passiert: Die aktive Teilhabe und Teilnahme der Älteren muss ermöglicht und gesucht werden. Es geht nicht um verstaatlichte Altenpolitik, sondern um die Ermöglichung selbstbestimmter lokaler Altenpolitik. Das Potenzial vor Ort ist groß. Von den 30 Millionen ehrenamtlich aktiven Menschen in unserem Land sind zahlreiche im Seniorenalter – erfahren, qualifiziert, unermüdlich. Daraus kann man eine wirklich gute zeitgemäße Seniorenpolitik in jeder Kommune, in jedem Stadtteil entwickeln. Am Engagement der haupt- und ehrenamtlich aktiven Senioren wird das nicht scheitern. Sie werden auch in hohem Maße sachkundig mitwirken können, wenn es darum geht, neue Impulse für eine lokale Altenpolitik zu geben. Gleichwohl ist erkennbar, dass bestimmte Voraussetzungen unverzichtbar sind, die obligatorisch werden sollten – eben zu Pflichtaufgaben der Kommunen. Damit es da kein Missverständnis gibt: Kommunen sollen nicht ihre Stadtwerke zu Altenwerken machen oder Vereine kommunalisieren. Die Kommunen sollen aber die Grundbedarfe einer zeitgemäßen Seniorenpolitik sichern, auch unter Beachtung von und im Zusammenwirken mit den Verbänden, Vereinen, Institutionen, Initiativen, die im Seniorenbereich aktiv sind.
Was immer man da erwähnt, wird man zur Antwort bekommen, dass es das schon gibt, zum Beispiel die Mehrgenerationenhäuser. Das stimmt. Es gibt zurzeit zwischen 450 und 500. Wir bräuchten aber zwanzig- bis dreißig Mal so viele. Wir sind ein Land der Modellprojekte. Fast alles Gute ist schon einmal gedacht und in kleiner Auflage praktiziert worden. Aber das löst nicht das Problem der Ungleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Pflegestützpunkte, Mittagstische, spezialisierte Hospiz- und Palliativdienste, lokale Allianzen für Menschen mit Demenz, qualifizierte interessenneutrale Information und Beratung jederzeit bei Fragen zu Pflege, Formen niedrigschwelliger Hilfe, Vermittlung von Bedarf und Angebot ehrenamtlicher Hilfe – das ist alles irgendwo vorhanden. Aber an noch viel mehr Stellen fehlt es.
Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für gute Lebensqualität im Älterwerden. Von der guten Begehbarkeit des öffentlichen Raumes, über ein verlässliches ÖPNV-Angebot bis zu Bürgerbussen und nutzbaren öffentlichen Toiletten. Auch die Möglichkeiten der digitalen Welt müssen in realistischer Weise einbezogen und in den höheren Altersklassen stärker verbreitet werden.
Die Daseinsvorsorge generell (und besonders im Gesundheitsbereich) muss sichtbar, ausreichend und für alle erreichbar sein. Bundesdurchschnittlich kann man sich da nicht beklagen. Aber was hat man vom Durchschnitt, wenn man deutlich außerhalb von ihm wohnt?
Zu uns selbst: Der Schatz der Älteren ist die Zeit. Auch wenn wir mit Augenzwinkern immer behaupten, nun gar keine Zeit mehr zu haben: Wir haben Zeit, wir sind die Zeitreichen, und mit Zeit kann man was bewegen.
Zeit zum Ausruhen, zum Nachdenken, zum Reisen, zur Muße, zum Bei-sich-Sein, das steht oben auf der Liste. Keine Hetze. Aber ein paar Stunden jede Woche sind frei fürs gesellschaftliche Miteinander, im Größeren oder Kleineren. Und Gutes für den eigenen Körper tun. Bewegung? Ja, Bewegung.
Wer lange keinen Bewegungssport mehr gemacht hat, hat mit 65 plus Hemmungen, neu einzusteigen. Die Pfunde wackeln. Das Verletzungsrisiko wird zum Thema, eine Blamage befürchtet. Trotzdem ist es nie zu spät, langsam wieder anzufangen. Anfangen beginnt im Kopf, der im Übrigen zum Körper voll dazugehört und partizipiert, wenn was passiert. Die Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Auch Radfahren, Rudern, Schwimmen oder Tanzen tun das. Für jede und jeden gibt es Passendes.
In vielen Sportvereinen gibt es geschulte Trainerinnen und Trainer, die den Neustart Älterer sachkundig begleiten. Wenn es das vor Ort bisher nicht gibt, kann man selbst die Initiative ergreifen, es anregen und gleichzeitig anbieten, jede Woche ein paar Stunden für die Organisation einer Senioren-Bewegungssportgruppe zur Verfügung stehen. Dass die Gruppe sehr sinnvoll ist, wissen alle Vereinsvorstände, aber die meisten von ihnen sind noch im Beruf und mit Arbeit für den Verein schon voll ausgelastet.
Also kann man Organisationshilfe anbieten, um sachkundige Beratung bitten, vielleicht auch Kurse dazu belegen, die von den Landessportbünden (LSB) angeboten werden. Die zahlreichen Mitglieder des Vereins über 40 und über 65 Jahre anzuschreiben und zum Mitmachen einzuladen, ist sicher auch eine gute Idee. Ich kenne die Aktivitäten des LSB Nordrhein-Westfalen, der zeigt, was man tun kann. Man erreicht nicht alle, aber doch eine große Zahl.
Wir Älteren haben meist tagsüber Zeit für eine Walk- oder Schwimm- oder Fahrradgruppe. Dann also los und im Verein die Versicherungsfragen klären. Zweimal die Woche zwei Stunden oder so ähnlich. Jedenfalls regelmäßig und nicht zu selten. Ist keine Halle verfügbar? Dann einfach ab nach draußen. Und wenn es regnet? Auch! So ungesund ist Regen denn doch nicht. Und einmal im Quartal sollte man mindestens auch Rollatoren-Rennen veranstalten.
Wir Älteren lehnen leicht ab: Da gehe ich nicht hin, die sind alle so alt. Wenn man uns dann dazu bringt, in den Spiegel zu blicken, haben die meisten eine Erkenntnis. Aber das nächste Argument zur Ausrede kommt schnell: Ältere sind oft so komisch. Am besten zugeben, dass das so ist. Früher gab es wenige Alte, die konnten ungebremst Weisheit vortäuschen. Aber bei uns vielen Älteren und Alten ist unübersehbar, dass wir nicht sonderlich weise sind, sondern manchmal sonderlich. Da hilft nur die Offensive. Besser mit solchen sonderlichen Älteren walken oder schwimmen, als alleine zuhause im Liegestuhl liegen, Gesundheitspillen schlucken, Kreuzworträtsel lösen oder Serie gucken und einsam sein.
Manche haben ein Einsehen und machen mit. Und dann muss man Aktivität richtig dosieren und irgendwann zum Training für das bronzene Sportabzeichen einladen. Nächstes Jahr vielleicht. Mal sehen. Kein übertriebener Ehrgeiz, nirgendwo. Es geht nicht um Sieg und Niederlage, nicht um besondere Leistung oder das Tragen der olympischen Fahne. Es geht um Bewegungssport nach individuellem Vermögen.
Auch mal Zeit haben für Gruppenstunden bei Kaffee und Bier. Denn außer dass der Körper einschließlich Kopf von der Bewegung profitiert, wachsen ja auch neue soziale Kontakte. Und die sind für uns Ältere nicht weniger wichtig als die Bewegung. Eher noch wichtiger.
Wir müssen der Isolation und Vereinsamung vorbeugen, Bekanntschaften suchen und pflegen. Soziale Kontakte helfen dabei, die Sicherheit in der eigenen Wohnung zu erhöhen, vor allem bei Menschen, die in ihrem Ein-Personen-Haushalt leben. Und davon gibt es mehr als je zuvor. Ihre Zahl nimmt zu, auch bei Älteren. Das spricht nicht gegen Notrufanlagen und Ähnliches, aber soziale Kontakte haben doch ihren eigenen Wert.
Es gibt noch ein Argument, das für solche Bewegungssportgruppen oder vergleichbare Ansätze bei Reisen, Kinobesuchen, VHS-Kursen etc. spricht: Die medizinische Grundlagenforschung muss bisher leider immer wieder melden, dass noch kein Mittel gefunden ist, Alzheimer-Demenz zu verhindern oder zu heilen oder wenigstens auszubremsen. Was sie aber immer wieder betont: Bewegen, bewegen. Das ist gut für den Kopf. Nochmals: Bewegung der Beine ernährt das Gehirn. Das ist keine Garantie, aber eine Tendenz, vielleicht eine kleine Chance. Und in der Tat haben wir ja im Bereich Bewegung ein riesiges Defizit. Schlimmer noch: Wir werden gerade zu einer Bewegungsverhinderungsgesellschaft, im körperlichen Stillstand weltweit unterwegs. Unsere Vorfahren mussten täglich eine Menge Kilometer laufen, um Nahrung zu finden. Wir steigen ins Auto, fahren zum Supermarkt, da steht viel zu viel in den Regalen, und wir kaufen es und essen es auch noch. Vernünftig ist das nicht. Körpergerecht auch nicht.
Es beginnt damit, dass wir die Bedeutung der Alltagsbeweglichkeit aus Bequemlichkeit unterschätzen. Treppen sind eben kein Hindernis, sondern eine Chance. Wer sie auslässt und dabei besonders konsequent ist, schadet sich selber. Weshalb sollte man sich freiwillig schaden?
Morgens eine Viertelstunde Gymnastik im Badezimmer ist doch leicht. Nicht schlimm, wenn man komisch aussieht bei Kniebeugen, Rumpfbeugen, Händerecken, Auf-einem-Bein-Stehen und Tiefdurchatmen. Die Regelmäßigkeit macht’s. Jeder Tag hat einen Anfang. Und ins Badezimmer gehen die meisten von uns ohnehin sowieso.
Individuelle Gymnastik ersetzt aber nicht die Bewegungsgruppe. Und weil der innere Schweinehund doch immer wieder den Start verschiebt, ist es besser, sich selbst in ein Reglement mit anderen Interessierten zu begeben, das spornt an und diszipliniert und hat auch andere gute Folgen, siehe oben.
Die Ernährung spielt eine Rolle, und sie verdient noch ein Wort. Manche essen aus Langeweile ganztags. Da hat sich was vererbt. Nach 1945 haben wir aus Hunger so viel gegessen, wie zu bekommen war. Aber es war nur wenig zu bekommen. Wir gingen als Kinder nicht selten ohne Pausenbrot in die Schule – nicht weil unsere Eltern uns keines geben wollten, sondern weil sie keines hatten. Wir gingen mit Kochgeschirren in die Schule, weil uns dort Quäkerspeise hineingefüllt wurde. Bis hin zu 1950 gab es Lebensmittelkarten, mit denen man sich eine magere Ration Brot holen konnte. Und etwas dunklen, feuchten Zucker. Und was in der grünen Spitztüte beim Umstülpen vom Zucker hängenblieb – meine Mutter stülpte ganz vorsichtig um –, gehörte mir. Das waren meine ersten Pralinen sozusagen. Und als sich mit der freien Marktwirtschaft und der D-Mark bald die Geschäfte wieder füllten, futterten alle los, als ob morgen die nächste Hungersnot ausbrechen würde. Das war verständlich. Viele wurden bald wieder rund und strahlten. Ludwig Erhard und andere lebten es vor. Aber inzwischen stellt sich das Problem andersherum.
IN FORM ist eine Aktivität der BAGSO (der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e. V.), wo in Seminaren sachkundig und interessenneutral über die Bedeutung richtiger Ernährung und ausreichender Bewegung informiert wird. Andere bieten Vergleichbares an. Man muss sich nur umhören.
Wer 60 wird, sollte sich – spätestens – informieren und Konsequenzen ziehen. Das zahlt sich aus. Und für Bewegung und Ernährung sind wir in hohem Maße selbst verantwortlich. Es ist kein Muss, sich darum zu kümmern, aber es ist klug und eine Chance.
Das gilt im Übrigen auch für die berüchtigten Stolperecken in der eigenen Wohnung. Solche Barrieren sollte man wegräumen, bevor man selbst wackelig wird. Im Älterwerden nehmen Kraft, Tempo und Ausdauer ab. Beim Sportabzeichen kann man sich das alle paar Jahre in Sekunden und Kilos ansehen. Das ist die ballistische Kurve des Lebens und ganz normal. Auch die Fähigkeiten in puncto Koordination schwinden. Das ist vielleicht sogar die wichtigste Veränderung. Man stößt eher irgendwo an, wackelt beim plötzlichen Drehen, beim Aufstehen vom Stuhl, beim Richtungswechsel, ist unsicher auf Treppen ohne Geländer. Alle kennen das aus Bus und Bahn. Die Älteren, die stehen, halten sich fest, wenn gebremst oder durch Kurven gefahren wird. Die Jungen stehen ungerührt daneben und pendeln die Situation problemlos aus. Deshalb ist das Tanzen eine so nützliche Form der Bewegung. Man muss sich dabei auf die Gruppe, den Partner oder die Partnerin einstellen, muss sich seitlich vorwärts und seitlich rückwärts bewegen, sich wenden und drehen. Das ist gut für den Kopf und eine prima Sturzprophylaxe, die sehr wichtig ist.
Im Jahr 2017 gab es in Deutschland 8.400 Sturzunfälle in Wohnungen und Häusern. Viele davon sofort oder bald danach mit tödlichem Ausgang. Meistens waren ältere Menschen beteiligt. In vielen Wohnungen wurden die Barrieren nicht rechtzeitig aus dem Weg geschafft. War ja noch immer gut gegangen. Dann nicht mehr.
In Deutschland kommen inzwischen deutlich mehr Menschen bei Unfällen in der eigenen Wohnung und im Haus ums Leben als bei Verkehrsunfällen. Die katastrophalen Zahlen Mitte der 1970er-Jahre – 17.000 Tote jährlich allein in der Bundesrepublik – konnten auf etwa 3.500 im ganzen Land gesenkt werden. Nicht von alleine übrigens. Die Anschnallpflicht traf zunächst auf wütenden Protest, das Alkoholverbot am Steuer wurde ignoriert. Die gute Einsicht wuchs mit den Sanktionen und der Zeit.
Bei Maßnahmen in Wohnungen ist die Einsicht von Vornherein höher. Da geht es um die Tür zum Bad und zur Toilette, die nicht breit genug ist für den Rollator und die möglichst nach außen aufgehen sollte. Da ist die sperrige Badewanne, die noch nicht durch eine bequeme, ebenerdige Sitzdusche ersetzt worden ist. Da fehlt die elektronische Hebeanlage für die Jalousien. Man klettert auf Stühle und Schemel, um ans oberste Fach des Schrankes zu kommen, weil da Dinge deponiert sind, die man alltäglich braucht. Wenn man ein wenig beweglicher bleibt und wenn die Barrieren in der Wohnung entfernt werden, sind viele Risiken gebannt. Solche kleinen Anpassungen der Wohnung an die Vernunft sind nicht sehr teuer und werden teils gefördert. Ein auf einige Jahre ausgelegtes Investitionsprogramm von Bund und Ländern könnte aber mit begrenzten Mitteln die Risiken deutlich reduzieren. Natürlich sind hier auch die Wohnungsbaugesellschaften angesprochen.
Zustimmung findet man dafür leicht. Nur eines wird gerne noch eingewandt: Unser Teppich, der ist so schön, der war so teuer. Der bleibt. Gut, der Teppich soll bleiben, wenn er unentbehrlich ist. Aber nagelt ihn bitte an die Wand. Das ist für alle gut, und dem Teppich ist es recht.
Das Thema Mobilität geht natürlich weit über das Gesagte hinaus. Das eigene Auto bleibt nützlich, wenn man es noch sicher im Verkehr bewegen kann. Aber es ist keine Schande, sich selbst einzugestehen, dass auch diese Fähigkeit abnimmt, was mit Reaktionsschnelligkeit, Abstandsgefühl und Komplexität mancher Verkehrsführungen zu tun hat. Wenn dann Merkfähigkeit, Sehschärfe, Reaktionsfähigkeit oder Gedächtnis abnehmen, kann das Autofahren zum Risiko werden. Das alles entwickelt sich individuell sehr unterschiedlich. Fahrtüchtigkeit hängt nicht vom Alter ab. Aber beim Älterwerden steigen die Risiken irgendwann, beim einen später, beim anderen früher.
Und immer wieder kommt in diesem Zusammenhang der Einwurf: Man weiß doch gar nicht so genau, wie das bei einem selbst ablaufen wird. Richtig. Aber die eigene Mobilität tatenlos riskieren, das ist wahrlich leichtfertig.
Bürgernahe Kommunen sorgen dafür – und viele sind bürgernah, mein Lob für die Kommunen! –, dass auch ihre älteren Bürgerinnen und Bürger sich frühzeitig und immer wieder informieren können über all die Dinge in ihren Gemeinden, die für Seniorinnen und Senioren besonders wichtig sind. Volkshochschulen spielen da eine positive Rolle, Seniorenbüros und Seniorenräte, Pflegestützpunkte und die erwähnten Mehrgenerationenhäuser. Auch die Informationsarbeit von Verbänden und Organisationen, in Veranstaltungen, gedruckt oder digital, bietet alle wichtigen Informationen zum Älterwerden. Guter Rat ist nicht teuer. Es liegt an uns selbst, ob wir ihn nutzen und wie.
In einigen Städten gibt es spezielle Bildungseinrichtungen für ältere Semester, auch an Unis. Und dass in den allermeisten Medien, in Zeitungen und im Radio, im Fernsehen, in Zeitschriften und Büchern das Thema vergessen würde, kann man nicht ernsthaft behaupten. Sicher, perfekt ist das noch nicht, und der Bedarf wächst. Da ist noch Luft nach oben. Ein bisschen mehr Heim-Volkshochschule fürs Älterwerden bei den Öffentlich-Rechtlichen wäre tagsüber möglich, höre ich.
Das gilt auch für alles, was mit Gesundheit und Pflege, mit Demenz und mit dem Sterben zu tun hat. Themen, über die man nicht jeden Tag reden muss, die man aber möglichst früh im Älterwerden ernsthaft und von Zeit zu Zeit bedenken und besprechen sollte. Einsichten können sich ändern. Niemand hat seine Gesundheit selbst voll im Griff, irgendwas kann jederzeit passieren, getreu Erich Kästner: »Wird’s besser, wird’s schlimmer, fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich.« Alles nicht neu. Mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sollte man nicht bis ins hohe Alter warten. Es schadet ja nicht, wenn die Menschen, die mir am liebsten sind, im Falle des Falles meine Meinung kennen, falls ich selbst nicht mehr entscheidungs- und handlungsfähig bin. Die Vorsorgevollmacht klärt verbindlich, wer in einem solchen Fall an meiner statt Entscheidungen treffen darf. Das Paar, das am 75. Geburtstag festlegt, »das machen wir, wenn wir 90 werden«, ist spät dran und leichtsinnig.
Auch die Neuen Medien liefern wichtige Informationen zur Gesundheitsversorgung, meistens auch zu Angeboten vor Ort. Ein Grundkurs, der sicher macht in der Nutzung digitaler Angebote, ist empfehlenswert. Bekanntlich auch für eine »Standleitung« zu den Enkelkindern.
Längst nicht alle Älteren werden lange und/oder schwer pflegebedürftig. Die meisten sogar nicht. Aber auch hier gilt: Niemand ist davor sicher. Kann solche Pflege zuhause erfolgen? Viele wünschen sich das, aber wer kann das übernehmen? Partnerin oder Partner? Oder wer sonst? Die meisten Pflegebedürftigen bleiben – mindestens auf längere Zeit – zuhause, und die meisten von ihnen werden von den Angehörigen gepflegt, oft ohne professionelle Fachkräfte. Man muss das sorgfältig abwägen. Pflegen ist keine Kleinigkeit, »die doch jeder kann«. Pflegen ist, zumindest für bestimmte Stadien, eine Herausforderung, die man »können« muss, die hohe berufliche Qualifikation erfordert.
Priorität sollte die Antwort haben auf die Frage, wo die Pflege genau für diesen Menschen und genau für dessen Bedürftigkeit am besten möglich ist. Und dabei ist die Grenze der Belastbarkeit der pflegenden Angehörigen wichtiger Teil der Antwort. Auf jeden Fall sollte von Anfang an der Sachverstand von Fachkräften einbezogen werden, und/oder es sollten die Pflegenden die Gelegenheit suchen und nutzen, bei Sachkundigen eine »Grundausbildung« zu bekommen.
Die Herausforderung für Pflege zuhause ist besonders groß bei Menschen mit Demenz, und gerade hier glauben viele Paare, es sich gegenseitig schuldig zu sein, ein Verbleiben zuhause möglich zu machen. Das ist vor allem im fortgeschrittenen Stadium nicht immer vernünftig. Die Pflegenden sollten sich und die Betroffenen nicht überfordern, das wäre leichtfertig und keineswegs Ausdruck einer ethischen Handlungsweise.
Bei Hinweisen auf Demenz gibt es oftmals noch ein Verstecken und Zögern, mit der Mutmaßung sinnvoll umzugehen. Dazu wird dann auch darauf verwiesen, dass es eine Heilungschance bisher nicht gibt und deshalb eine klare Diagnose weder zur Heilung noch zum Stopp der Krankheit führen wird. Wozu dann eine Klärung der Situation? Etwa zwei Drittel der Demenzen sind genetisch bedingte Alzheimer-Erkrankungen, die bis heute offensichtlich nicht heilbar oder entscheidend eindämmbar sind. Rund ein Drittel der Demenzen aber ist anderen Ursprungs und – in Maßen – behandelbar, wenn auch nicht kurierbar. Schon um hier keine Chance zu verpassen, ist eine zügige und eindeutige Diagnose sinnvoll, und zwar vom Spezialisten.
Klar ist auf jeden Fall: Auch Menschen mit Demenz sind keine Kategorie. Sie bleiben Individuen. Sie sind in ihrer Demenz so unterschiedlich wie die Nicht-Dementen auch. Jeder Mensch ist und bleibt ein Unikat. Menschen mit Demenz können Orientierung und Sprachfähigkeit verlieren, aber das Gefühl bleibt.
Die Zahl der Menschen mit Demenz nimmt zu, auch weil die Zahl der Alten und Hochaltrigen zunimmt. Es ist eine Krankheit, die mit dem Älterwerden schrittweise deutlich häufiger auftritt.
In Fachartikeln wird eine Demenzrate von 1 bis 2 Prozent bei 60-Jährigen genannt, bei den 90- bis 95-Jährigen eine von 35 Prozent plus. Bei der letzten Zahl rutscht man leicht in den Sessel. Muss man aber nicht. Wir sind ja noch nicht 90 plus. Und zweitens hat man auch dann immer noch eine Chance von 2:1, nicht betroffen zu sein. Nicht für vieles im Leben dieser Altersklasse stehen die Chancen so gut.
Auch bei Demenz ist Unabänderlichkeit nicht zwingend. Die Grundlagenforschung muss nachdrücklich vorangetrieben werden. Das geht auch nicht nur Deutschland an, sondern die ganze Welt. Denn die Lebenserwartung steigt überall. Wir können mit unserer Hochleistungsmedizin heute Dinge tun, die vor 50 Jahren noch undenkbar waren: Herzen transplantieren und Lungen. Neue Kniegelenke und Hüften sind fast zur Routine geworden. Vor 30 oder 40 Jahren konnte man befürchten, HIV werde in naher Zukunft den Großteil der Menschheit hinwegraffen – Entwarnung. Versprechen kann man zwar nichts. Aber aufgeben dürfen wir Menschen den Versuch nicht, vorbeugende oder eindämmende oder heilende Wege auch für die Demenz zu finden.
Der Pflegebedarf je Person steigt. Die Zahl der Pflegebedürftigen auch. Die Zahl der ausgebildeten Pflegekräfte steigt aber nicht entsprechend mit. Dies alles kommt nicht plötzlich und unerwartet. Es ist ein Beispiel für die Neigung, erkennbare demografische Entwicklungen zu ignorieren, statt rechtzeitig zu handeln. Motto: Wir wissen Bescheid und warten mal ab! Bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Am Arbeitsmarkt. Am Wohnungsmarkt. Zwischen den Regionen. Und beim Pflegebedarf.
2018 hat das Thema zusätzliche Aufmerksamkeit und hoffentlich auch nachhaltigen Rückenwind bekommen. Der Start von KAP (Konzertierte Aktion Pflege) durch die Bundesregierung ist gut, aber nun muss in der vereinbarten Zeit, in 2019, auch einiges passieren. Ein Anfang ist immerhin gemacht. Mehr noch nicht.
Bei der Pflege und bei den anderen Bereichen massiven Wandels wäre Angstmache unverantwortlich. Wir haben in Deutschland das Potenzial, die nächsten dreißig Jahre gut zu bestehen und zu erleben, wie dann die demografischen Verschiebungen sich zurückentwickeln und sich wieder ausgeglichene Relationen bilden. Die Babyboomer sind dann zwischen 85 und 100 Jahre alt. Aber diese zuversichtliche Perspektive gilt eben nur, wenn rechtzeitig, also zügig und zielgerichtet, gehandelt wird.
Das Miteinander der Generationen muss garantiert sein. Wir Älteren dürfen nicht versuchen, Vorteile für uns auf Kosten der nachfolgenden Generationen zu erzielen. Umgekehrt natürlich auch nicht. Wir sitzen in demselben Boot. Das heißt Bildung und Ausbildung, gute Lebenschancen für alle Kinder und Jugendlichen sind unverzichtbar. Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den Städten und Regionen muss beachtet werden. Es geht nicht um platte Gleichheit, natürlich nicht. Aber wo die Bedingungen für Lebensqualität, auch im Älterwerden, sich so verschieben, dass vermeidbare drastische Mängel auftreten, kann das nicht weiter hingenommen werden. Das heißt aber, rechtzeitig zu handeln und vorzubeugen. Und rechtzeitig, das ist jetzt.
Die Rolle der Kommunen muss gestärkt werden. Sie müssen Handlungsmacht und -pflicht haben und die nötigen finanziellen Bedingungen, um für alle, auch für die Älteren und Alten, eine gute Lebensqualität vor Ort zu ermöglichen. Es reicht nicht, mit sinnvollen Bundes- und Landesgesetzen passable Durchschnittswerte zu erreichen. Die solidarische Gesellschaft entsteht und wächst vor Ort und in der Region. Wenn sie gelingen soll, braucht sie handlungsfähige Kommunen. Und das ist auch eine Bewährungsprobe für unsere Demokratie. Dass das Kooperationsverbot zwischen Bund und Kommunen inzwischen wieder gelockert wurde, ist sicher ein richtiger und nützlicher Schritt, darf aber nicht der letzte sein.
Viel spricht dafür, dass diese Herausforderungen, die die Kernfragen der demografischen Entwicklungen (Lebenserwartung, Altersstrukturen, Binnen- und Außenwanderungen) sowie die Aspekte der Integration umfassen, am besten in Form einer Gemeinschaftsaufgabe zu lösen sind, an der Bund, Länder und Kommunen in verbindlicher Form und eben gemeinsam mitwirken. Das würde vom Löcherstopfen befreien, dem Handeln eine klare Richtung geben und sicher auch Europa interessieren.
An dieser Stelle möchte ich noch eine kurze Anmerkung machen, die mir besonders wichtig ist. Hier und fürs Älterwerden und das Leben insgesamt.
In Gesprächen zur Pflege und zum Sterben begegnet mir manchmal die harsche Antwort, man werde sich nicht helfen lassen. Her mit der Spritze – oder ich fahre in die Schweiz.
Man werde sich auf keinen Fall von Fremden waschen und säubern lassen. Das berühre die persönliche Würde. Man muss das respektieren, muss aber gleichwohl auch sagen: Helfen und sich helfen lassen – das ist menschlich. Wir alle sind aufeinander angewiesen. Von der Geburt an bis zum Ende. Die Illusion, souverän zu sein und unabhängig von aller Hilfsbereitschaft anderer zu existieren, ist eine Verklemmung, die tagtäglich von der Lebenswirklichkeit widerlegt wird. Unser Leben besteht aus helfen und sich helfen lassen. Weshalb nicht auch im Fall von Krankheit und Sterben?
Gründlicher ansprechen will ich aber in diesem einführenden Kapitel zum Älterwerden noch die Zukunft in unseren Familien und zu unserer Rolle, die wir Älteren dabei haben.
Dass drei oder gar vier Generationen unter einem Dach wohnen, war in meiner Jugend nicht so selten, wird dies aber immer mehr. Die Familien – Ehen und Partnerschaften – haben im Schnitt weniger Kinder als früher, ein oder zwei meistens. Es gibt verbesserte Schulbildungschancen, und viele junge Menschen gehen zur Fachhochschule oder Universität. Längst nicht alle kommen zurück ins Elternhaus. Das hat Vorteile und Nachteile, das ist hier nicht unser Thema. Aber wenn im Älterwerden bei den Großeltern oder Eltern Pflegebedarf entsteht, sind keine jüngeren Familienangehörigen im Haus, die Pflegeaufgaben übernehmen können. Immer mehr ältere Paare wohnen alleine und ohne engere Verwandtschaft in ihrer Wohnung, letztlich bleiben immer öfter – nach dem Tod von Partner oder Partnerin – Ein-Personen-Haushalte übrig. In manchen Städten gibt es bis zu 40 Prozent Ein-Personen-Haushalte. (Nicht alle sind ältere Menschen, das ist wahr, aber doch nicht wenige.)
Damit kein falscher Eindruck entsteht: Die Familien sind der stabile Kern unserer Gesellschaft. Man hat und hält Kontakt. Man tauscht sich aus. Man kümmert sich. Man hilft sich, so gut man kann. Aber in zahlreichen und immer mehr Fällen lebt man nicht im selben Haus oder so dicht beieinander, dass man sich alltäglich konkret unterstützen kann. Das hat erhebliche Konsequenzen. Auch weil, deutlich öfter als in den Generationen davor, Frauen und Männer berufstätig sind und sie mindestens schwierigere Phasen bei pflegebedürftigen Anverwandten nicht oder nur bedingt helfend begleiten können. Oder – auch das ist ein wachsendes Problem – sie versuchen, Beruf und häusliche Pflege, beides, bewältigen zu können, und riskieren selbst Überlastung und gesundheitliche Schäden. Bei der laufenden Debatte zur KAP (Konzertierte Aktion Pflege), die im Sommer 2019 Handlungsvorschläge vorlegen will, ist das Problem im Mittelpunkt, die Pflegeberufe aufzuwerten und zu stabilisieren und genügend Nachwuchs zu gewinnen für eine Aufgabe, die unverkennbar stark wachsend ist.
Dieser Ansatz ist zentral. Er muss aber ergänzt werden um bessere Bedingungen für die häusliche Pflege. Ein großer Teil der Pflege erfolgt nämlich zuhause. Wenn dieser Bereich deutlich schrumpft, weil die infrage kommenden Personen dies faktisch nicht mehr leisten können oder es sie in den Familien überhaupt nicht mehr gibt, wird die Pflege in Heimen oder durch ambulante Dienste vor zusätzlichen riesigen Herausforderungen stehen.
Die Aufgabe, die diesbezüglich dringend angegangen werden muss: Pflege zuhause mit wesentlichem Einsatz von Verwandten oder nahen Bekannten muss im Sinne von »Familien-Pflegezeit« stabilisiert werden. Das ginge mit einem verbindlichen Rechtsanspruch, für begrenzte Zeit, für Frauen und Männer, auf Freistellung oder Teilzeitbeschäftigung und einem angemessenen staatlichen finanziellen Ausgleich für diese Zeit. Dem Sinn nach vergleichbar der Kindererziehungszeit für Eltern.





























