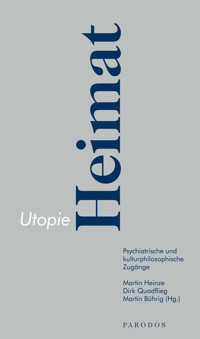
Utopie Heimat E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Tagungsband macht es sich zur Aufgabe, das Thema Heimat im Trialog zwischen Philosophie, Psychiatrie und Kulturtheorie auszuleuchten. Allgemeine Begriffsbestimmungen stehen hier neben Beiträgen, die „Heimat“ im weiteren Bedeutungsumfeld von Zuhausesein und Herkunft, aber auch im Lichte von Gegenbegriffen wie Fremdheit und dem Unheimlichen betrachten. Dass dabei Psychiater literarische Texte interpretieren und psychiatrische Themen aus philosophischer Sicht behandelt werden, ist Ausdruck des aktiven Versuchs, über die jeweiligen Fachgrenzen hinaus zu denken. Die psychiatrischen Texte des ersten Teils stellen z.B. Fragen nach der Psychiatrie als (neuer) Heimat selbst, nach der urbanen Psychose oder nach dem Verhältnis von Heimat(verlust), psychischem Leiden und künstlerischer Schaffenskraft. Die philosophischen Beiträge widmen sich Phänomenen wie Heimweh, Fremdsein oder auch dem Konflikt zwischen Wohnen und Gehen. Aus gemeinsamen Workshops der Tagung sind weitere Beiträge zur künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema in Film, Tanz und Literatur hevorgegangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Heinze, Dirk Quadflieg und Martin Bührig (Hg.)
Utopie Heimat
Psychiatrische und kulturphilosophische Zugänge
Impressum
Beiträge der Gesellschaft für Philosophie und Wissenschaften der Psyche Band 6 (2006)
© (Print) Parodos Verlag, Berlin 2006
© (E-Book) heptagon Verlag, Berlin 2024
Alle Rechte vorbehalten
ISBN der Print-Ausgabe: 978-3-938880-02-9
ISBN der E-Book-Version: 978-3-96024-057-0
https://parodos.de
Einleitung
Wenn der Begriff ‚Heimat‘ zum Ausgangspunkt eines Trialogs zwischen Philosophie, Psychiatrie und Kultur(theorie) genommen wird, bedarf dies sicherlich zunächst einer kurzen Erläuterung. Wer sich heute emphatisch auf die Heimat beruft, diesem deutschen Wort, das sich nur schwer in andere Sprachen übersetzen lässt, dem wird tendenziell eher eine konservative Geisteshaltung unterstellt. Abgesehen von ganz persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen steht Heimat allgemein für die Verbundenheit mit einem Landstrich, das Bewahren von Brauchtum und die Rückwendung ins Überschaubare, Althergebrachte. Diese einseitige Besetzung des Heimat-Begriffs liegt in seiner jüngeren Geschichte begründet. Als Antwort auf die Industrialisierung und ihre Folgen wird Heimat bereits im 19. Jahrhundert zum Gegenkonzept einer auf ständigen Wandel ausgerichteten, somit zunehmend unbehausten Welt. Politisch vereinnahmt und völkisch aufgeladen avanciert sie dann zum Schlagwort des Nationalismus im beginnenden 20. Jahrhundert und stellt ein zentrales Versatzstück der nationalsozialistischen „Blut und Boden“-Mythologie dar. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verliert der Bezug auf Heimat zwar den kämpferischen und exkludierenden Unterton, erlebt gleichwohl in der Zeit des politischen und großen wirtschaftlichen Wandels der 50er Jahre eine Renaissance, die sich massenkulturell im Genre des Heimatfilms niederschlägt. Dessen Rückgriff auf vormoderne soziale Ordnungen bedient die Sehnsucht nach einer überschaubaren, intakten Welt ebenso wie den Wunsch vieler, die Schrecken der jüngsten Vergangenheit wenigstens kurzzeitig vergessen zu machen. Die Aufnahme des Heimat-Motivs durch die Massenmedien hat schließlich nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass Heimat heute vor allem mit bestimmten volkstümlichen Klischees und Stereotypen verbunden wird, die das Repertoire für eine nach wie vor höchst populäre Unterhaltungsindustrie liefern.
Die skizzierte Begriffsgeschichte lässt, so könnte man meinen, das Thema Heimat für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung wenn nicht gewagt, so doch zumindest anachronistisch anmuten. Gleichwohl stellt sich gerade in einer Zeit der wirtschaftlichen wie kulturellen Globalisierung und ihres Imperativs der Flexibilität erneut die Frage nach dem, was uns als Einzelne ausmacht, wohin wir gehören, wo wir zu Hause sind. Darauf bieten weder nationalistisch gefärbte Heimatbestimmungen noch die Schablonen des Heimattümlichen eine befriedigende Antwort. Dagegen scheint jener Topos von der verlorenen Heimat, wie ihn etwa die Dichter der Romantik beschworen haben, das Bedürfnis nach einer Verortung besser zu treffen: nicht als Erinnerung an eine vergangene Erfahrung, sondern als der Entwurf von Geborgenheit und Vertrautheit mit der Welt. In diesem Sinn kann Heimat utopisch werden, zu einem Ort, der noch nicht ist und den es herzustellen gilt.
Für einen solchen utopischen Heimatbegriff lassen sich u.a. zwei Fürsprecher anführen, die erstaunlicherweise gerade in dem Moment darauf zurückkommen, als das Wort Heimat durch die nationalsozialistische Ideologie vollends diskreditiert scheint: Theodor W. Adorno und Ernst Bloch. Während Adorno in der mit Max Horkheimer gemeinsam verfassten „Dialektik der Aufklärung“ noch ein wenig kryptisch formuliert: „Heimat ist das Entronnensein“, wird für Bloch in den Schlusssätzen von „Das Prinzip Hoffnung“ Heimat explizit zum Namen einer Utopie, in welcher der Mensch „das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet“. Beiden bedeutet Heimat ein noch ausstehender Fluchtpunkt, in dem die Entzweiung von Mensch und Natur aufgehoben wäre.
Freilich ist uns gegenwärtig auch dieses Versöhnungspathos fremd geworden. Von der Denkbewegung her aber lösen Adorno und Bloch den Begriff aus einer rückwärts gewandten Bindung an eine feste Örtlichkeit und öffnen ihn für eine zukünftige Neubesetzung, ohne den Anklang der emotionalen Geborgenheit aufzugeben. Für die heutige Zeit, in der das Zurückweichen der Ortsgebundenheit durch neue Verkehrsmittel, globale Massenkommunikationsmedien, Telefon und Internet immer offensichtlicher wird, scheint ein utopischer Heimatbezug bereits vielfach das reale Erleben von Menschen in den westlichen Industriestaaten zu treffen: Wahlheimaten treten an die Stelle des Wohnortes aus Kindheitstagen, und ein bewegliches Beziehungsgeflecht von Freunden ersetzt zunehmend die Bindung an die Herkunftsfamilie, die ihrerseits – angesichts hoher Scheidungsraten und alternativer Familienmodelle – immer weniger dauerhafter Garant für Stabilität und Zuflucht zu sein beansprucht.
Damit soll jedoch keineswegs vorentschieden sein, was eine utopische Perspektive auf das Heimatliche in der Tat bedeuten kann. Der vorliegende Band macht es sich zur Aufgabe, die Möglichkeiten und Grenzen für eine Utopie Heimat aus verschiedenen Blickwinkeln auszuleuchten. Neben dem seit nunmehr zehn Jahren von der „Gesellschaft für Philosophie und Wissenschaften der Psyche“ geförderten Dialog zwischen Philosophie und Psychiatrie kommen hier als weitere Gesprächspartner der künstlerische Bereich und insbesondere die Literatur hinzu. Dass dabei Psychiater literarische Texte interpretieren und psychiatrische Themen aus philosophischer Sicht behandelt werden, ist Ausdruck des aktiven Versuchs, über die jeweiligen Fachgrenzen hinaus zu denken. Die Bandbreite der jeweils behandelten Aspekte und die verschiedenen Ansätze, mit denen sich die Autorinnen und Autoren dem Thema Heimat nähern, spiegelt die Vielschichtigkeit der möglichen Zugänge wider. Neben eher allgemeinen Versuchen einer Begriffsbestimmung stehen daher zahlreiche Beiträge, die sich um Einzelfragen der jeweiligen Disziplin bemühen und diese im weiteren Bedeutungsumfeld von Zuhausesein und Herkunft, aber auch im Lichte von Gegenbegriffen wie Fremdheit und dem Unheimlichen betrachten.
Der erste Teil des Buches versammelt Zugänge zum Thema Heimat vornehmlich aus dem Bereich der Psychiatrie. Der Beitrag von Martin Heinze eröffnet die Diskussion mit der Frage, inwieweit Heimat einen sinnvollen Begriff innerhalb der Psychiatrie als Institution darstellen kann. Ian Prenelle betrachtet Besonderheiten von ‚urbanen Psychosen‘, indem er sie im Lichte von Walter Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen als das Auseinanderfallen von eigenen Erinnerungen und einer kohärenten zeitlichen Ordnung interpretiert. In ihren aufeinander bezogenen Beiträgen nähern sich Klaus Leferink und Christian Kupke der Dimension des Bewahrens und des Zuhauseseins ausgehend von dem so genannten „Vermüllungssyndrom“. Während Leferink das zwanghafte Sammeln und Aufbewahren von scheinbar wertlosen Gegenständen aus einer semiotischen Perspektive aufschlüsselt und die gesammelten Objekte als Identitätszeichen versteht, betrachtet der Text von Kupke das psychopathologische Phänomen der Verwahrlosung vor dem Hintergrund von dezidiert zeitphilosophischen Überlegungen und deckt darin eine eigentümliche Dialektik von Heimat und Heimatlosigkeit auf.
Im zweiten Teil des Bandes sind Beiträge aus dem engeren Bereich der Philosophie zusammengestellt. Rudolf Bernet macht am Phänomen des Heimwehs deutlich, dass Heimat in erster Linie eine nachträgliche Konstruktion darstellt. In ihrer phänomenologisch-begrifflichen Bestimmung von Heimat verweist Karen Joisten auf einen produktiven Konflikt zwischen Wohnen und Gehen, der den Menschen als ein Wesen auszeichnet, das stets auf dem „Heim-Weg“ ist. Inwiefern auch das Unheimliche zum Ursprung von Heimat werden kann, zeigt Dirk Quadflieg in seiner Auseinandersetzung mit Heidegger und Freud. Der Beitrag von Andreas Kriwak verortet das Motiv vom Verlust der Heimat innerhalb der lacanianisch-psychoanalytischen Terminologie und bestimmt davon ausgehend diesen Verlust selbst als Ursache unseres Begehrens. Dem Gegenbegriff zu Heimat, der Fremde, geht Susanna Kahlefeld in ihrer Rekonstruktion von Julia Kristevas Text „Fremde sind wir uns selbst“ nach.
Der dritte Teil des Bandes schließlich dokumentiert ausgewählte literarische und künstlerische Zugänge zum Thema Heimat. So findet Johann Pfefferer-Wolf im Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ der Gebrüder Grimm ein Vorbild dafür, wie eine verlorene Heimat zu einer neuen, handlungsleitenden Perspektive werden kann. Uwe Gonther rekonstruiert Hölderlins Schaffen unter dem Stichwort der Sehnsucht nach Heimkunft, und Helmut Haselbeck schreibt über die ambivalente „Beheimatung“ Robert Walsers in der Psychiatrie. Für Franz Anton Cramer stellen Tänze eine verleiblichte Heimat dar. Edgar Reitz’ monumentales Filmwerk zur Heimat steht im Mittelpunkt der Überlegungen von Hinderk Emrich. Abschließend gehen Martin Bührig und Inge Buck anhand von zahlreichen Beispielen der Frage nach, auf welche Weise das Thema Heimat Eingang in die moderne Lyrik findet.
Die Texte dieses Bandes dokumentieren die Tagung „Utopie Heimat“, die im Mai 2005 in Bremen stattfand. Die Herausgeber danken allen Referentinnen und Referenten der Tagung für ihre Beiträge und den Teilnehmenden für die lebhaften Diskussionen, dem Klinikum Bremen-Ost für seine Gastfreundschaft sowie den Sponsoren aus dem Bereich der pharmazeutischen Industrie. Ein besonderer Dank gilt Ulf Heuner vom Parodos Verlag, der uns bei der Erstellung des Manuskriptes tatkräftig unterstützt hat.
Bremen, Mai 2006
Martin Heinze, Dirk Quadflieg und Martin Bührig
Martin Heinze
Heimat und Sozialpsychiatrie?
Im Dialog zwischen Philosophie und Psychiatrie wird mit dem Thema Utopie Heimat ein genuin sozialpsychiatrischer Topos angesprochen. Heimat ist ein durchaus ambivalent besetzter Begriff. In unserer modernen Zeit ist der Verlust von Bindungen und eines heimatlichen Ortes für viele der Beginn eines psychischen Leidens. Andererseits werden Heimat und Familie von heutigen Menschen auch negativ erfahren, indem sie persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Freiheiten einschränken. Die Sozialpsychiatrie begegnet dem Entfremdungserleben vieler Menschen und dem Verlust eines heimatlichen Ortes mit vielen Angeboten und Projekten: mit Wohngruppen, Begegnungsstätten und Ähnlichem. Dennoch stellen sozialpsychiatrische Angebote immer nur so etwas wie eine „Ersatzbeziehung“ oder „Ersatzheimat“ für psychisch Kranke dar. Auch schon früher hatten Langzeitbereiche der Nervenkliniken in anderer Weise eine solche Funktion.
Hier stellen sich allerdings viele Fragen: Ist institutionelle Heimat mit persönlicher Heimat vergleichbar? Kann eine Institution fehlende soziale Bindungen korrigieren oder gar ersetzen? Ist der Staat hier in einer besonderen Verpflichtung oder muss er mehr an die Selbstheilungskräfte anderer sozialer Institutionen und der Familien appellieren? Oder auch: Reproduziert die institutionelle Abhängigkeit nicht in verschärftem Maße die pathologische Struktur unseres Gemeinlebens?
Somit ist das Thema Heimat auch eines der Psychiatrie. Geläufiger als der Heimatbegriff sind den Psychiatern allerdings die Gegenbegriffe: Ausgrenzung, Isoliertheit, Verlust von Identität usw., die zum Grundkanon der sozialpsychiatrischen Theoriebildung gehören und auch die psychiatrische Ätiologie als krankheitsbedingend bereichern. Mit der Gegenseite tut man sich schwerer. Obwohl viele sozialpsychiatrische Institutionen durchaus so etwas wie eine Heimat für ihre Patienten sein wollen und obwohl das Heimatthema in der aktuellen kulturpolitischen Diskussion aufkommend ist, sowohl im Sinne der verlorenen Identität (Heimatvertriebene) als auch im Sinne des Wunsches nach Sinn (religiöse Neuorientierung), ist doch die erste Reaktion von Sozialpsychiatern auf das Thema Heimat eine negative.
Peter Lösche schreibt in seiner Rezension zu Bernhard Schlinks Buch "Heimat als Utopie": „Was ist Heimat? Eine Utopie? Man stutzt, fühl sich provoziert, vielleicht auf die Schippe genommen. Wenn Heimat eine Utopie ist, dann existiert sie nicht, ist ein Nichtort, ist nirgendwo und doch Realität: Man erlebt sie nämlich dann am intensivsten, ... wenn man fort ist und sie einem fehlt. Heimat wird in Abwesenheit mit Hoffnung, Sehnsucht, Traum, Unerfülltheit und Unerfüllbarkeit verbunden, scheint etwas Melancholisches mit sich zu führen, ist verbunden mit den Erfahrungen von Verlust, Suche und Heimatlosigkeit ... Indes geriert ‚Heimat‘ sich auch ganz konkret, handfest, anschaulich, nämlich als Kiez, Stadt, Landschaft, in denen wir leben – gegenständliche Orte also.“ (Lösche 2000, B22)
Das Provokante und Unernsthafte des schillernden Begriffs Heimat basiert auf einem unterschwelligen Misstrauen der Rechtslastigkeit des Begriffs. Der Heimatbegriff sei rückwärtsgewandt, mit ihm lasse sich keine Zukunft denken, er sei ideologisch belastet, Heimattümelei – in jedem Fall gehöre er eher in den Wortschatz der Konservativen, nicht zum Vokabular der Sozialpsychiatrie. Dies alles mag wichtige Aspekte des Heimatbegriffes treffen, überlässt das Feld aber schon einer bestimmten Interpretation, nämlich der, dass Heimat quasi Natürliches repräsentiere, Vorfindliches, pathologischen Zwang zur Identität, von dem man sich loslösen müsse. In jedem Fall repräsentiere der Begriff nicht etwas, was sich konkret zu bewahren oder gar allererst herzustellen lohne.
Gegen ähnliche Argumente haben sich bereits in einer Zeit, die der unseren durch das Vorherrschen eines entglittenen Profitstrebens und der Dominanz des Bürgerlichen vergleichbar ist, die Autoren der "Dialektik der Aufklärung" gewandt:
Heimweh ist es, das die Abenteuer entbindet, durch welche Subjektivität, deren Urgeschichte die Odyssee gibt, der Vorwelt entrinnt. Daß der Begriff der Heimat dem Mythos entgegensteht, den die Faschisten zur Heimat umlegen möchten, darin ist die innerste Paradoxie der Epopoe beschlossen. Wenn die feste Ordnung des Eigentums, die mit der Seßhaftigkeit gegeben ist, die Entfremdung der Menschen begründet, in der alles Heimweh und alle Sehnsucht nach dem verlorenen Urzustand entspringt, dann ist es doch zugleich Seßhaftigkeit und festes Eigentum, an dem allein der Begriff von Heimat sich bildet, auf den alle Sehnsucht und alles Heimweh sich richtet. Die Definition des Novalis, der zufolge alle Philosophie Heimweh sei, behält recht, nur wenn dies Heimweh nicht im Phantasma eines verlorenen Ältesten aufgeht, sondern die Heimat, Natur selber, als das dem Mythos erst abgezwungene vorstellt. Heimat ist das Entronnensein. (Adorno und Horkheimer 1944, 86)
Auf diesen Gedanken, dass Heimat etwas noch nicht Existentes ist, welches es der bloßen Natur allererst abzugewinnen gilt, will ich meine weiteren Ausführungen stützen. Mit Adornos und Horkheimers Aussage ist das Feld der sozialen Politik eröffnet, in das sich soziale Psychiatrie einzuordnen hat. Es ist ein Feld voller Arbeitsaufträge und ein Feld utopischer Wünsche. U-Topos bedeutet als Negativum zunächst "ohne Ort" – steht also zum Heimatbegriff in kontradiktorischem Verhältnis. Wir alle verstehen Utopie als etwas Wünschenswertes für die Zukunft als einen Noch-nicht-Ort, der zu einem Ort werden soll. Auch Heimat kann man in einer starken Form so lesen: als eine, die noch werden kann und soll.
Das Unbehagen im Hinblick auf den Heimatbegriff besteht dennoch. Zu schwer sind die Bedenken der rückwärts gewandten Ideologie. Daher ist eine einfache Inanspruchnahme des Begriffes durch die Sozialpsychiatrie nicht möglich und es gibt sicher keine konsistente Theorie zu "Heimat und Sozialpsychiatrie". Um dennoch einen engeren Bezug herzustellen, werde ich mich dem Thema von verschiedenen Perspektiven her nähern, zum Teil ausgehend von Gegenbegriffen: von einer historischen Perspektive (Beheimatung und Wandel), von einer des Betroffenseins (Fremdheit und Entfremdung), von einer der Psychopathologie (Leiden und Freisein) und schließlich natürlich von der der Utopie. Dies ist notwendig eklektisch.
Beheimatung und Wandel
Als die Psychiatrie zu ihrem Begriff fand und sich Institutionen schaffte, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurden allerortens Irrenanstalten gegründet. In Beschlüssen zu solchen Gründungen heißt es wiederkehrend, man wolle den Irren eine Heimstatt schaffen. Tatsächlich wurden die Anstalten den Verrückten Wohnort. Eine Einweisung in sie bedeutete in der Regel ein lebenslanges Verweilen dort.
Dies hatte durchaus gute Absichten: Der Vereinzelung und der Ausgrenzung von psychisch Kranken in der kaiserlichen Gesellschaft wollte man entgegentreten und angesichts des scheinbar unabdingbaren Schicksals der Irren diesen wenigstens ein die Gesundheit förderndes Milieu schaffen. In der Gründungszeit war dies Ausdruck einer sozialen Psychiatrie, eines politischen Wollens zur Verbesserung der Verhältnisse. Dementsprechend schreibt der Architekt Theodor Goecke: „Soll man schon für den Gesunden und Heilen so bauen, dass er sich glücklich fühle im Hause, um wie viel mehr muss man dies thun für den Kranken und Gebrechlichen, der sein Unglück im vielfältigen Spiegelbilde von Seinesgleichen sieht.“ (Goecke, zit. nach Hübener 2003, 14). Dieser guten Absicht schlug die ihr eigene Dialektik im Sinne eines Wollens des Guten, welches stets das Böse schafft, nach nur wenigen Jahrzehnten entgegen. In der vorgeblichen Heimat entsteht eine Entrechtung; eine Rückkehr in die normale Welt ist bald nicht mehr möglich. Und dann, im Nationalsozialismus, bedeutet in diesen Anstalten zu wohnen den Tod.
Statt dem zukunftszugewandten trat in dieser Zeit ein rückwärtsgewandtes Heimatdenken in den Vordergrund. Dieses analysiert Ernst Bloch in seiner Schrift "Erbschaft dieser Zeit", die 1935 im Schweizer Exil erscheinen konnte. Er verdeutlicht, dass eine Gesellschaft, die das Spannungsverhältnis zwischen Heimat und Fremde mittels eindeutiger Bestimmungen zu einer Seite hin aufzulösen versucht, den Geschichtsprozess leugnet. Eine solche Gesellschaft tendiere dazu, an falschen Heilsversprechen festzuhalten, was sich in einem gegenüber der realen gesellschaftlichen Entwicklung rückwärtsgewandten Bewusstseinszustand kenntlich mache. Für die psychisch Kranken bedeutete dies damals, dass sie zum Wohle der Heimat ihre ihnen eigene Heimat verloren, dass sie von der Gemeinschaft der Heimat ausgeschlossen und anschließend getötet wurden. Hitler datierte seinen Tötungsbefehl auf den 1. September 1939, damit andeutend, dass zur Verteidigung der Heimat der Tod psychisch Kranker Kosten sparen und den gleichzeitig dringend benötigten Lazarettraum schaffen sollte.
Zu Recht hat die Sozialpsychiatrie nach den Erfahrungen der Geschichte einen Neuanfang gewagt. Sie hat in ihrem Denkgebäude der Heimatproblematik Rechnung getragen und das Thema wiederum nach vorne, in Richtung Zukunft gewandt. Es ist eine ihrer Einsichten, dass das Bedürfnis nach kultureller Geborgenheit als soziale Forderung unabhängig von der Abwegigkeit des Verhaltens ist, und damit für psychisch Kranke genauso ein zu realisierendes Bedürfnis wie für Gesunde. (Nur nebenbei sei hier gesagt, dass die Metapher "abwegig" für psychisch Kranke erneut eine Heimatmetapher ist. „Wohin gehen wir denn? Immer nach Hause“ (Novalis) – der Abwegige aber hat sich verirrt.)
Die Sozialpsychiatrie zog aus den entrechteten Zuständen in der Langzeitpsychiatrie die Konsequenz, diesen Teil der psychiatrischen Institutionen aufzulösen und andere Versorgungsstrukturen zu schaffen. Anstelle der alten Orte wurden neue Orte für psychisch Kranke geschaffen: Wohngemeinschaften, Tageskliniken, Nachtkliniken, Heime, Werkstätten. Dennoch ist die Gefahr des Rückwärtsgewandtseins nicht behoben, stellen solche Räume doch nur eine andere Form, aber eben keine prinzipiell andere der Institutionalisierung dar. Heute sind die sozialpsychiatrischen Institutionen alt geworden und haben sich in der Bequemlichkeit des wirtschaftlichen Erfolges gut eingerichtet; die Aufenthaltszeiten von psychisch Kranken in diesen Institutionen nehmen zu trotz aller Ausrichtung auf mehr Selbständigkeit des Kranken.
Finanzielle Abhängigkeiten und das Fortbestehen der kapitalistischen Seite der psychiatrischen Versorgung, nämlich dass der Patient eine Ware ist, die Geld bringt, oder neudeutsch ein Kunde, lassen vermuten, dass im Hinblick auf die Beheimatung von psychisch Kranken die Adornosche Utopie einer der Vorwelt entrinnenden Subjektivität für psychisch Kranke keineswegs umgesetzt ist. Allerdings: Eine ähnliche Kritik wie an der Anstaltspsychiatrie regt sich heute trotz solcher Bedenken nicht. Dies liegt sicher an der besseren Qualität und der Überschaubarkeit der neuen Institutionen, es könnte aber auch daran liegen, dass die Sozialpsychiatrie ihre eigene Kritikfähigkeit angesichts ihrer selbst verloren hat. Und dies hätte erneut mit dem Thema einer verlorenen Heimat zu tun.
Als letzten Punkt der historischen Betrachtung stellt sich die Frage, wo denn die Psychiater ihre Heimat im historischen Geschehen gefunden haben. Die Anstaltspsychiatrie war nicht nur Heimatort für psychisch Kranke, sie war es auch für die Psychiater. Das Wohnen in der Anstalt war nicht nur eine Frage der Versorgung, es war auch eine der Hingabe. Viele Psychiater haben ihren Tisch mit psychisch Kranken geteilt, wie im Falle des vielleicht bekanntesten Beispiels Eugen Bleulers. Sie haben damit auch eine Lösung für ihre eigene Biographie gefunden und nicht nur die Aufgaben ihrer Zeit, sondern auch Aufträge ihres sozialen Umfeldes und ihrer Familie gelöst. Bleulers Hingabe arbeitete zeitlebens auch die Tatsache ab, dass seine Schwester an Schizophrenie erkrankt war. In der Auseinandersetzung mit psychischem Leiden fühlt sich der Psychiater oft heimatlos und hierin liegt eine Gefahr. Der Kontakt zum Patienten kann als Substitut der eigenen Entwurzelung auftreten, der eigene Narzissmus kann sich an der Beziehung zum Patienten befrieden und die Frage nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens über therapeutische Beziehungen geklärt werden. Die Psychoanalyse hat sich, die Anstaltspsychiatrie vor Augen, dieser Dramatik, die auch eine Dramatik des Beheimatetseins ist, gestellt und mit der Theorie der Abstinenz der Psychiatrie eine Warnung gegeben. Ob solche Mechanismen in der Sozialpsychiatrie überwunden sind, bleibt noch zu klären. Aber eine weitere Facette der Frage nach der Beheimatung des Psychiaters ist die, wo denn der neue Typ des Psychiaters, der Sozialpsychiater, seine Heimat hat oder ob er jemals eine hatte. Die historische Heimat der sozialpsychiatrischen Bewegung ist die Kritik an der Anstaltspsychiatrie. Kritik aber ist wenig sinnlich und für die Beheimatung ein schwieriges Feld.
Fremdheit und Entfremdung
Ein Gegenbegriff von Heimat ist der der Fremde. Es ist eine alte Volksweisheit, dass Fremdsein und psychisches Leiden in engem Zusammenhang stehen: „Innsbruck ich muss Dich lassen, ich fahr dahin mein Straßen ... wo ich im Elend bin.“ Wäre dementsprechend Fremdsein Leiden und Zuhausesein Glück? Ganz so einfach sind die Verhältnisse nicht, und über so eine Zuordnung lässt sich die Widersprüchlichkeit des Heimatbegriffes leider nicht auflösen.
Im Assoziationsbereich des Fremden steht der Begriff Entfremdung, der in sich selbst sperrig und verdreht ist. Ursprünglich aus der mittelalterlichen Theologie stammend, gilt Entfremdung heute als Begriff der sozialkritischen Philosophie. In der Theologie, für Bonaventura, realisierte sich aber zunächst das Bewusstsein der Gegenwart Gottes in der gewünschten Entfremdung von der Sinnenwelt. Entfremdung ist somit ursprünglich etwas Gutes – nämlich eine Abkehrbewegung vom Fremden, hier in der theologischen Sprache eine Abkehr vom Verhaftetsein an der der Nähe zu Gott abträglichen Sinneswelt. Die Sinneswelt ist zwar Natur des Menschen, zugleich aber das seinem Wesen, insofern er als Abbild Gottes sein Heil in der Entsagung der Natur finden muss, fremdeste.
Entfremdung kann so einerseits bedeuten, dass Fremdes aufgegeben wird und wieder so etwas wie ein Zuhause entstehen kann. Andererseits steht aber in der modernen Sozialtheorie gerade der Entfremdungsbegriff paradigmatisch für den Prozess des zunehmenden Verlustes der sozialen Kontexte und heimatlichen Orte. Dass dies eine Entfremdung ist, die letztlich dem Wohle des Menschen dient, verstehen wir nur, wenn diese Verhältnisse selbst, die allgemeinen Lebensumstände in der kapitalistischen Gesellschaft, als bereits fremd oder dem Menschen nicht angemessen angesehen werden. Die Aufhebung der Entfremdung wäre dann ein Prozess der Annäherung an ein anderes Fremdes, welches dem Unwahren der natürlichen quasi-heimatlichen Verhältnisse entgegentritt und sich als neue Möglichkeit abzeichnet.
Die Psychoanalyse hat diese Dialektik gesehen, von Freuds "Unbehagen in der Kultur" bis hin zur Lacanschen Unmöglichkeit von Heimat, die den Wunsch nach Unendlichkeit repräsentiere, die den Menschen als sterbliches Wesen nicht zukomme. So gegen falsche Utopien gewappnet, formuliert die Psychoanalyse ihre eigene Utopie, dass der Mensch eins mit sich selbst sei oder Herr im eigenen Hause. Dies unterstellt zunächst, dass der Mensch an dem ihm nächsten heimatlichen Ort, im eigenen Hause, eben nicht zu Hause ist und nicht der Herr. Auch die Psychoanalyse will Heimat schaffen – auf einer neuen Ebene, auf der der Selbstbestimmung und Selbstmächtigkeit. In der psychoanalytischen Theorie begegnen wir dann aber auch dem Umschlag der Selbstbestimmung in den Narzissmus. Gesteigerte Individualität und gesteigertes Selbstsein haben in der Moderne gezeigt, dass sie nicht zur Geborgenheit, nicht zu einer neuen Beheimatung des Menschen führen. Entfremdung führt zu keinem Ziel, das Leiden an der entfremdeten Welt wächst an und die Psychiatrie fasst dies als Pathologie.
Leiden und Freisein
An psychopathologischen Phänomenen wird deutlich, dass Heimat vielleicht an äußeren Orten festzumachen ist, Heimatlosigkeit aber eher einen inneren psychischen Zustand bezeichnet. Christian Scharfetter führt die Begriffe Sucht und Heimat eng zusammen:
Sucht, Addiction, Verhaftet- und Verfallensein an ein Suchtobjekt oder ein süchtig vollzogenes Tun – leitet man etymologisch von siech, krank ab ... Ein Charakteristikum der Sucht ist doch ein bestimmtes Suchen, Gieren nach Einem, Fixiertsein auf ein Objekt oder Tun. Wann wird das Suchen zur Sucht? Es ist einmal das Übermaß, die Einseitigkeit, Ausschließlichkeit des süchtigen Fixiertseins, Verfallenseins, die den Süchtigen schließlich infirm, dysfunktionell, krank macht. Es ist weiter das verfehlte Suchen: nicht das eigentliche, Heilsame suchen, welches Ruhe, Einmittung, Frieden, Heimat vermittelte. Der Süchtige strebt nach dem Uneigentlichen, dem Rausch, der Betäubung, nach dem Ersatz, der Ablenkung: Flucht und Selbsttäuschung Woran mangelt es der Person des Süchtigen, was ist gefährdet: sein Ich, Selbst, seine Person – und damit die ihm zugehörige, von ihm mitkonstituierte individuelle Welt. ... Wenn Sucht Ausdruck eines Siechtums des Ich/Selbst ist, kann man formulieren: Jede Sucht ist eigentlich ‚Ich-Sucht‘. Ein narzisstisches Phänomen sowohl bei den kohäsiven wie bei den non-kohäsiven Selbstpathologien. Sucht sucht eine Bestätigung des Ich, sucht Identität, Struktur, Halt, Wert, Überdecken oder Ausblenden der Leere. ... Der Mensch ist ein suchtanfälliges Wesen, sein Ich ist gefährdet, verletzbar, fragil, instabil, fluktuierend, schwankend. Der Mensch findet sich im unbehausten ewigen Wanderer Ahasver, im menschenfernen Kaspar Hauser als ausgesetzt, ungeborgen, heimatlos gespiegelt Sucht erscheint in dieser Sicht als Flucht vor dem Leiden ei gentlicher Heimatlosigkeit: nicht in sich selbst zur Ruhe kommen können. (Scharfetter 2000, 77)
Heimatlosigkeit hat so in der Psychopathologie der Sucht – man kann dies vermutlich auf alle Psychopathologien übertragen – seine Ursache in einem gescheiterten Selbstverhältnis. Heimat ist zwar auch äußere Struktur, Heimatlosigkeit aber ein inneres Getriebensein. Deswegen setzt Scharfetter als positives therapeutisches Angebot das Wiedererfahren von Heimat:
Eigentliche Heimat kann nur im Eigenen erfahren werden, im Selbst, wozu auch der eigene Leib gehört. In der äußeren Heimat kommt nur zur Ruhe, zu Friede, Gelassenheit, wer die innere Heimat gefunden hat. ... Innere Heimat heißt im eigenen Wesen stehen , den je eigenen Weg suchen, finden, gehen. Es ist der Weg vom unechten Selbst hin zur Authentizität der eigenen Wesensart, mutig und gefasst das eigene Vermögen unter Berücksichtigung von Schwächen und Fehlern zu leben. (Ebd., 78)
Für den Psychopathologen tut sich somit eine weitere Dimension des Heimatbegriffes auf. Nicht nur muss er als dauernder Prozess verstanden werden, als fortwährende Suche nach Geborgenheit. Sondern die Suche nach der Heimat ist auch eine Reise ins Innere und eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst und der eigenen leiblichen Verfasstheit. Wenn uns heute dieses Beheimatetsein in der eigenen Leiblichkeit nicht mehr möglich ist, so erhält die Psychiatrie auch hieraus einen Auftrag. Nämlich den, zu fragen, wie die Zielsetzung von Therapie in einer Weise zu verstehen wäre, dass diese Übereinstimmung beim Patienten wieder entstehen kann.
Ich habe an anderer Stelle (Heinze 2002) ausgeführt, dass im Rahmen einer Theorie menschlicher Subjektivität Psychopathologie als empirische Wissenschaft des Phänomenbestandes der freiheitlichen Beziehung zur Um- und Mitwelt verstanden werden kann. Im Lichte dieser Definition zielt Therapie auf die persönliche Freiheit der Menschen. Natürlich kann Freisein in verschiedener Weise verstanden werden und wir haben von Scharfetter schon die Warnung vor der narzisstischen Selbstisolierung des Menschen in der Moderne zitiert. Versteht man dagegen Realisierung von Subjektivität als eine Selbstwerdung, die Abhängigkeit von anderen und anderem als ihre eigene Voraussetzung berücksichtigt, so entsteht eine andere Vorstellung von Freiheit. Daran orientierte therapeutische Praxis zielt auf die Wiederherstellung einer Subjektivität der Patienten, in der die eigene und notwendige soziale Eingebundenheit akzeptiert wird. Das heißt Menschen werden als Teil einer sozialen Welt angesehen, in deren Zusammenhang persönliche Autonomie zu entwickeln ist. Sowohl Autonomie, also die Fähigkeit frei zu handeln, als auch die Sicherheit des sozialen Verbundenseins sind gleichberechtigte und wesentliche Ziele von Therapie. Insbesondere das zweite ist heute bedroht. Daher muss Sozialpsychiatrie vor allem auf die Wiederherstellung einer umfassenden Teilhabe am sozialen Leben zielen, soziale Integration und Geborgenheit im menschlichen Miteinander im Auge haben. Selbstverwirklichung mit Hilfe einer therapeutischen Erfahrung ist dann nicht nur ein Freiwerden von der eigenen Natur zugehörigen Zwängen aus Herkunft und Erfahrung, sondern ein Freiwerden zum Aufbau einer neuen Heimat in neuen sozialen Kontexten.
Utopie
Bevor wir abschließend dem Utopischen des Heimatbegriffes nachgehen, können wir zunächst resümieren: Im Kontext der psychiatrischen Theoriebildung kann der Heimatbegriff destruktiv sein, wenn er rückwärtsgewandt ist. Dagegen kann er zukunftsgewandt zum Verstehen psychiatrischer Therapie fruchtbar gemacht werden, wenn die Orientierung an Heimat als Prozess verstanden wird, der in Situationen der Ausgrenzung und Isolation, aber auch pathologisch gesteigerten Selbstbezuges, neue soziale Heimaten entwickeln will. Für die Sozialpsychiatrie bietet der Heimatbegriff ein Potential zur fortwährenden Selbstkritik an den eigenen Institutionen und Haltungen.
Das berühmte Schlusswort von Ernst Bloch in "Prinzip Hoffnung" ist dem Eingangszitat von Adorno und Horkheimer nicht unähnlich:
Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, d.h. sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat. (Bloch 1959, 1628)
In der Blochschen Philosophie ist die Utopie vom Umbau der Welt in Heimat eine Chiffre der gelungenen Vermittlung von Subjektivität und Welt. Die Zielrichtung dieser Hoffnung drückt Bloch durch den Begriff der Heimat aus. Heimat meint nicht Herkunft, sondern Utopikum, oder, mit einer Marxschen Formel, die Naturalisierung des Menschen und die Humanisierung der Natur. An anderer Stelle führt Bloch aus:
Nicht nur wir, sondern die Welt selber ist noch nicht zu Hause; aber Erkenntnis, am Fluß des Vorhandenen ... orientiert, zum Zuhausesein tendierend, kann unbestechlich Helferin sein in einer schweren Geburt. Heimat, dies prozeßhaft Vermittelbare, doch Ausstehende, Unnachlässliche hat zuerst die letzthinnige Evidenz von Wahrem an sich, in sich; zentral problemhaft wohnt Angelangtsein utopisch im Kern von guten Möglichkeiten, in der Treue dazu. (Bloch 1975, 60)
Der utopische Gehalt des Heimatbegriffes, so mit Bloch verstanden, gemahnt dann auch die soziale Psychiatrie, sich am arbeitenden und schaffenden, um Humanisierung der Natur bemühten Menschen zu orientieren. Er fordert reale Demokratie und den Aufbau gerechter Gesellschaftsverhältnisse, die noch nicht vorhanden sind. In dieser Utopie kann auch der heute vielleicht etwas orientierungslose Sozialpsychiater wieder Orientierung und Heimat, angelehnt an die eigene Herkunft, finden. Denn das kritische Bewusstsein Blochs erinnert an die Anfänge der sozialpsychiatrischen Bewegung. Man kann sich an ein Zitat von David Cooper von 1977 erinnern:
Die Psychiatrie und sämtliche Formen psycho-technischer Unterdrückung und Ausgrenzung sind die historischen Erfindungen des Kapitalismus seit dem 18. Jahrhundert. In einer sozialistischen Gesellschaft ist kein Platz für die Psychiatrie, obwohl der antipsychiatrische Kampf in ihr fortgesetzt werden muss. In der klassenlosen Gesellschaft, in der die Entfremdung in ihren hauptsächlichen Strukturen überwunden wäre, bestünde kein ‚Bedürfnis‘ nach Verrücktheit, diesem verzweifelten Versuch der Ent-Entfremdung. ... Jede Form von Abweichung könnte sich dann in Kreativität verwandeln. Normalität wird stets im Interesse der Herrschenden definiert – sie ist ein Ausschließungs- und Einschließungs-Begriff. Verrücktheit ist einer der Auswege auf der Suche nach Autonomie. (Cooper 1977, 37)
Die mit dem Heimatbegriff möglich werdende Orientierung der Sozialpsychiatrie macht den politischen Gehalt des sozialpsychiatrischen Projektes wieder deutlich: dass eine Besserung der Umstände des psychischen Leidens nur durch Veränderungen des gesamtgesellschaftlichen Kontextes zu erwarten ist und sich die Psychiatrie dieser politischen Reflexion nicht entziehen darf. Zuviel dagegen gibt es falsche, da verhärtete und nicht mehr im Prozess stehende Heimaten in den Institutionen auch der Sozialpsychiatrie und im privaten Narzissmus des Therapeuten. Heimat, zukunftsoffen verstanden, mahnt dagegen zur dauerhaften Selbstkritik in eigener Sache.
So kann man das Fazit zum Thema Heimat und Sozialpsychiatrie ziehen, dass die Heimat des Sozialpsychiaters im kritischen Denken liegen sollte – in einem Streben nach einer gerechteren und freieren Lebenswelt. Utopie ist die ständige, schwierige und selbstkritische Aufgabe der Reflexion in der Psychiatrie, und die Heimat des Psychiaters sollte der Ort sein, an dem der ständige und schwierige Vermittlungsprozess stattfindet.
Literatur
Adorno, Theodor W. und Horkheimer, Max (1944): Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a.M. 1986.
Bloch, Ernst (1938–1947): Das Prinzip Hoffnung, Gesamtausgabe Bd. 5, Frankfurt a.M. 1959.
Bloch, Ernst (1935): Erbschaft dieser Zeit, Gesamtausgabe Bd. 4, Frankfurt a.M. 1962.
Bloch, Ernst (1975): Experimentum Mundi. Frage, Kategorie des Herausbringens, Praxis, Gesamtausgabe Bd. 15, Frankfurt a.M.
Cooper, David (1977): Psychiatrische Repression. Überlegungen zur politischen Dissidenz, in: David Cooper u.a. (Hg.): Der eingekreiste Wahnsinn, Frankfurt a.M. 1979.
Heinze, Martin (2002): Psychopathologie als Wissenschaft des leidenden Subjektes, Fundamenta Psychiatrica 16, 38–47.
Hübener, Dieter (2003): Die Architektur soll die erziehliche und ärztliche Thätigkeit unterstützen ... – Der Baumeister Theodor Goecke, in: Landesklinik Teupitz (Hg.), Landesklinik Teupitz, Berlin.
Lösche, Peter (2000): Rezension zu Bernhard Schlinks "Heimat als Utopie", Süddeutsche Zeitung v. 18.10.2000, B22.
Scharfetter, Christian (2000): Was weiß der Psychiater vom Menschen?, Bern u.a.
Ian Prenelle
Memory, Modernity and Urban Psychosis. The Spectacular Aesthetics of Madness
A Klee painting named ‘Angelus Novus’ shows an angel looking as though he is about to move away from something he is fixedly contemplating. His eyes are staring, his mouth is open, his wings are spread. This is how one pictures the angel of history. His face is turned towards the past. Where we perceive a chain of events, he sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet. The angel would like to stay, awaken the dead, make whole what has been smashed. But a storm is blowing from Paradise; it has got caught in his wings with such violence that the angel can no longer close them. This storm irresistibly propels him into the future to which his back is turned, while the pile of debris before him grows skyward. This storm is what we call progress.
Walter Benjamin. Theses on the Philosophy of History. IX. 1940.
In this paper I will review two radical critics of modernity, Walter Benjamin and Guy Debord, in order to reflect on the predicament of people with a history of psychosis in the modern, spectacular city, dispossessed not only materially but also of the autonomy to assert their own memory of themselves over the dominant narratives of madness. This dispossession is not simply a matter of stigma but a complex constellation of a culture conditioned by capitalism into passive consumption; the reification of symptomatic biographical details into ‘branded’ consumable narrative commodities and the demand placed on those individuals to conform to a version of their personal history which presents a one dimensional continuum of pathology.
In the Society of the Spectacle Guy Debord wrote, “everything that was once directly lived moves away into representation,” describing the alienation of people from their own experiences, organized and commodified into aestheticised spectacles by capitalism. In a society which, through the media, internet, advertising and architecture, saturates us with imagery, the capacity to retain even the illusion of a stable, integrated self image or social identity is bombarded and fragile. History and memory are somehow separated and viewed retrospectively, personal narratives can appear, as to Benjamin’s Angel of History, like a pile of debris. This debris, a kind of anti-aesthetic is, at times, all that may stand out as intelligible in a life story containing abuse, trauma or psychosis. Here, I am not intending to elaborate another nuance of the social construction of madness. Rather I aim to expand on themes usually discussed in terms of labelling and stigma by using the Situationist concept of the ‘spectacle’ and Benjamin’s critique of historicism to explore how psychotic experience can be aestheticised and reified to the status of commodity and occupy a disproportionately preeminent position in a persons autobiography and its translation by acute psychiatry.
Louis Sass argues in Madness and Modernism that ‘madness’ is not caused by modernity or capitalism but that the experiences of hyperreflexity, thought alienation and hearing voices parallel the alienation inherent in modernity and the artistic and aesthetic products of modernism. If, according to Benjamin, “… every image of the past not recognized by the present as one of its own concerns threatens to disappear irrevocably” then the present, being modernity, will draw out and retain from a life story, those episodes which resonate most with that which concerns modernity; the alienation of experience. For people who have had psychosis this process is often mediated by the prejudicial restriction of access to other social modes that usually contribute to a sense of identity, belonging and multi-dimensional personal narratives. This occurs through direct material deprivation, the closing down of opportunities in employment, leisure and social relationships, the popular dominance of negative stories of mental illness and the overwhelming power of the psychiatric narrative. The relative vividness of psychotic experiences can stand out against a background of urban squalor and impoverishment. That psychosis has been and continues to be readily aestheticised in books, magazines, films and news stories sets the scene. These form a powerful, collective historical continuum which subsumes the individual history. At this point the ability of the individual to maintain a view of themselves distinct from the image offered to them by the spectacle begins to fade.
The Society of the Spectacle and the psychotic event as a consumable autobiographical milestone
Guy Debord and the Situationist International were part of the 20th Century modernist avantgarde milieu which included Dada, Surrealism and Lettrism and whose project was the development of Marxist theory through an attempt to merge art and politics. Whilst Marx had focused on the factory and production, the Situationists were concerned with the city and social reproduction. For Debord, modern life in the media age had become an “immense accumulation of spectacles”; commodified images and experiences, forming a simulation of reality and a version of the world which obscured the true nature of the power of capitalism and the mental and material deprivations that persisted behind the seamless façade of consumer gadgets, sports, media culture, pornography, urban and suburban architecture, education and the appearance of democratic politics.
In the spectacular society, wrote Debord, individuals became passive consumers, alienated from their own experiences, separated from real life or its active construction. For Marx the organization of labour in capitalism and the redirection of desire towards commodities transformed Being into Having. In the society of the spectacle the mediation of the experience of the world through layers of imagery lead Debord to describe a further transformation from Having into Appearing. In this ‘aesthetisization of everything’, the status of an object relies more on its symbolic image than on its actual use value. Debord, goes further, to say that this hierarchy of the signifier over the signified constitutes a new form of experience. In this ever-changing never-changing world of saturated imagery and the perpetual reproduction and consumption of spectacles which are different but the same, the greatest separation is from history itself. The status of history is ambiguous and consists not only of events that have occurred but of someone’s representation of those events. The endless bombardment of information and images in an urbanized, technologised world is described by Jean Baudrillard as an “ecstasy of communication” which generates “more and more information and less and less meaning”. Simulation is pervasive and representations stack up to form an impenetrable semantic crust with a diminishing relationship to the ‘original’. Even human beings are commodified; politicians, Madonna, mass murderers, athletes, paedophiles, philosophers, pop idols and big brothers, naked bodies and of course not least, psychotics. The image-commodity is recognized and acts as a system of exchange of aesthetic value that penetrates throughout society. To a lesser or greater degree the modern subject is held in the gaze of their own fragmented image reflected back from the spectacle. This is how they know themselves and are known. The risk for people with psychosis is that the full complexity of their memories of themselves are fractioned and distilled leaving only the most potent of images to represent them. This happens in reality on many levels but I will explore in more depth what happens to the patient’s life story in the acute psychiatric setting.
Taking the patient’s History (away)
The practice of assessment, of listening to the biography, is referred to as taking the history. This is the first ‘skill’ taught to medical students and a large part of the training of psychiatric doctors involves the honing of this ability into a highly efficient information extraction process. The ‘patient’s history’ is institutionalized and stereotyped, structured into simplified categories which partition areas of the person’s life story. So ‘personal history’ is separated from ‘alcohol history’ and from ‘psychosexual history’ etc. The emphasis is on ‘reconstructing’ the person’s life in such a way that will reveal the diagnosis and aetiology of their psychopathology. The past is viewed with the lens of the present, which can focus only on those images which are relevant to its present concerns, that is pathology. This is not to say that only pathological or traumatic elements are included but that only those events which seem relevant to solving the problem of pathology, either as causative or protective factors are perceived.
In this scheme the patient’s history forms a continuum with their diagnosis, creating a functional narrative. In the view of history as a continuum, the present is viewed simply as the inevitable price paid for the past. This arbitrarily categorises all parts of the life story in their relation to some assumed pathological reference point and then proceeds to deduce (diagnose) the nature of this reference point itself from the assembled parts. The history is documented and kept on record to inform other professionals, who will in future use it as the source of information on the patient’s life story.
The problem is not simply that the biography is constructed but the notion that it is being reconstructed. The medical history taker does not perform in the full knowledge of their role as constructor of a new story, taken from selected fragments and quotations of the patient storyteller. This consciousness is, in a political sense, crucial and is perhaps the equivalent of the insight that is often thought to be lacking in the psychotic patient. The inequalities in power ensure that the individual’s own ideas, thoughts and explanations for experiences are often degraded, seen as of lower value or symptomatic of the illness itself. The patient’s version of history is devalued and the possibility that their story in their words, rather than the psychiatric translation, has meaning is too often disregarded.
Irving Wohlfahrt describes Benjamin’s discovery as being, “that historical knowledge is not a knowledge of the past but a recognition of the now in which the historical moment flashes up. Instead of cutting out the subject’s own moment (in a fake objectivist quest) the moment itself becomes a medium of understanding.” Psychiatric methodology often represents just such a fake objectivist quest.
According to Benjamin, “To articulate the past historically does not mean to recognize it ‘the way it was’”. This would require a “blotting out of everything known about the later course of history”, implying a naïve belief that some kind of return to past mind states is possible and deny the historical selectivity of ‘recognition’. Rather it means “to seize hold of memory as it flashes up at a moment of danger,” as if at the moment of waking from a dream, a moment of disruption. Here the past “has moved up from its existence-at-that-time into a higher concretion of existing-now (being awake).”
I recently treated a female patient who was compulsorily detained in a psychiatric hospital. She appealed against her detention and at the appeal hearing I gave evidence to support her continuing detention. These appeal tribunals have a legalistic and ritualistised structure and the main participants; judge, lay-member, psychiatrists, patient, stick to a fairly rigid script. This, however, does not make them safer. There is tension and vigilance, everyone is under scrutiny, the issues at stake are power, freedom and risk. In one sense this heightened awareness reflects onto the script which at other times binds the doctor and patient into a ritualized dialogue in which meaning may or may not be present even if power always is. After this particular tribunal, meaning rapidly returned. The angry patient burst into another meeting I was in, shouted at me aggressively and spat in contempt at the floor in front of me. She stormed out shouting that I didn’t know her, I wasn’t intelligent enough and I’d only learnt a technique which anybody could learn. This was a moment of danger and represented a crisis in our dialogue. She was right. I, as the history taker had emptied meaning from her story using technique and power to construct a biography of hospital admissions, mental illness and an uncertain personal identity based largely on the fact that she had received multiple diagnoses over the years. The psychiatric version of history had won.
In her attempt to take back some of her story she appeared to become more psychotic. In part I think this simply reflected her distress and disappointment at being kept in hospital. However, perhaps there was also a response to the fact that only those parts of her self were recognizable to herself and to the hospital staff which somehow accorded with the representation of her as psychotic. Paradoxically by being more visible, more recognizable she became less present as herself. She also had learned a technique, one which paralleled my own and which in the end colluded with the victors’ history.
Benjamin identifies two models of history. One which is “additive; mustering a mass of data to fill the homogeneous, empty time”. This refers to a view of history encompassed by Enlightenment ideas of progress as a unilinear continuum and which Benjamin refers to as the victors’ version of history. The other he termed an “interruptive philosophy of history” in which “thinking suddenly comes to a stop in a sudden constellation saturated with tensions. It gives that constellation a shock, by which thinking is crystallized into a monad.” Perhaps this was such a moment, the sudden flash of recognition which passed from the patient to myself in a moment of extreme conflict. However this was also the moment of its passing, unsustainable in the aggression which had produced it.
For Benjamin, “The true picture of the past flits by. The past can be seized only as an image that flashes up at the moment of recognizability, and is never seen again.” This demands a disruptive process of critical reading. A hitherto unseen image of reality may become visible in the present, emerging from the debris of history as a clash of a moment of the past and a moment of the present. From their dialectical coming together arises a new image of reality and this is a dialectical image. Thus “the phenomena of waste and decline are the harbingers, in a certain sense the mirages, of the great syntheses that will follow them.” The disruptive synthesis involves a process of surrealist juxtaposition akin to photomontage, in which apparently banal images can be combined to reveal a constructed image of tremendous force and vividness. Unlike photomontage this does not claim to create a relationship between past and present which is stable over time but one which is historically truthful at only one moment in time.
Contrary to Karl Jaspers’ claim that schizophrenic experiences are incomprehensible and beyond interpretation, I would argue that within this context they become the most comprehensible, not necessarily in content but in form, language and gesture. Within the culture of the mental health system they exert a colonizing or viral effect on the systemic communication between patient and professionals. To act as if interpretation is impossible is to deny and obscure that it is occurring anyway. This is psychiatry’s lack of insight. In this framework interpretation is vital, it interrupts the continuum and creates a space for listening out for fragments of an alternative biography; the debris. By debris I do not refer to the obvious traumas, symptoms or life events, but to the lost and fragmentary truths which lay hidden. The small things.
Benjamin excavated the markets and arcades of Paris, searching for nineteenth century phantasmagoria. He believed that these small, banal objects and images from the past unlocked something of the truth from history through the strangeness they acquired by juxtaposition in the present. History is not revealed by the momentous events but by the ones that lay hidden in their shadows. This is what brings alive the past in the present, shifting the lens from the subject of history to the history of the subject.
As the themes of this book are heimat and utopia I thought I would add some remarks about the intrusion into psychiatry of the idealized fantasy of the home.
Heimat – the hearth of a hearthless world?
Marx’s well known description of religion as the heart of a heartless world could alternatively refer to the idea of home; those interiors which we live within and which live within us. Home occupies a dual position. A utopian fantasy of family life, attachments, the nest, the warm hearth, the sanctuary, the origins or roots, the place personally identified as a venue for life, for rituals and gatherings and a base camp from which to take one’s place in the productive process.





























