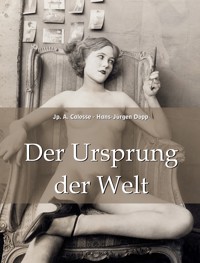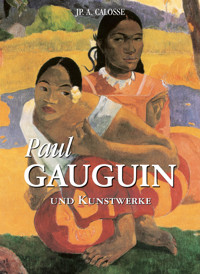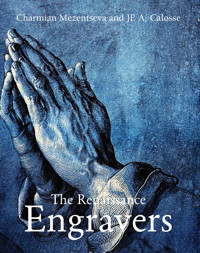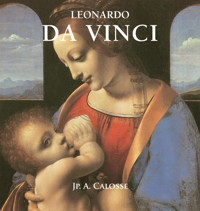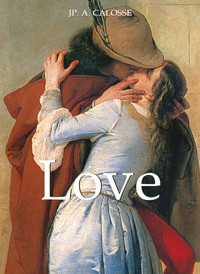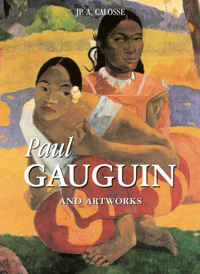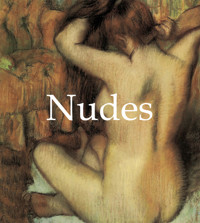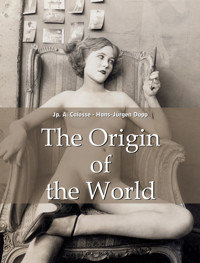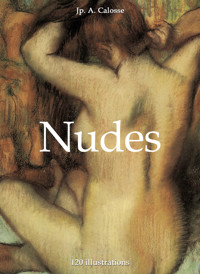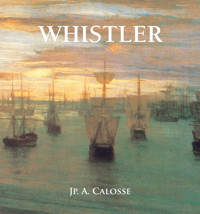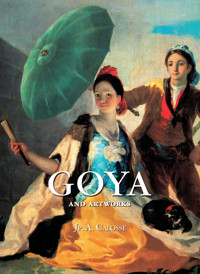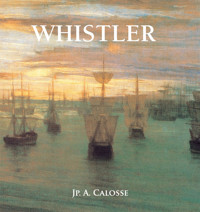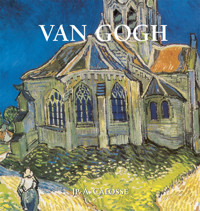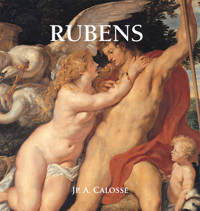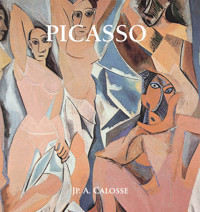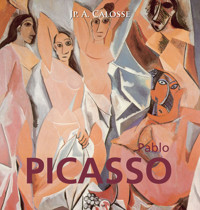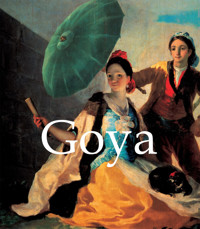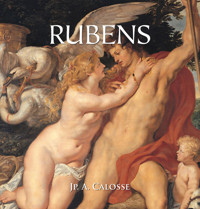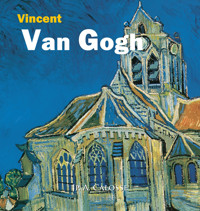
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Parkstone International
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jenseits der Sonnenblumen, der Schwertlilien und des Porträts von Doktor Gachet befindet sich ein Mensch, Vincent van Gogh (geboren 1853; gestorben 1890) mit all seiner Begabung und Zerbrechlichkeit. Der Post-Impressionist van Gogh übte mit seiner Kreativität und seiner Technik einen enormen Einfluss auf das Verständnis der Malerei des 19. Jahrhunderts aus. Er war Vorläufer der Expressionisten, der Fauvisten und der modernen Kunst überhaupt. Heute jedoch wird van Gogh vor allem als das Symbol des von Krankheit, anderen Menschen und vor allem seinen eigenen Dämonen gequälten Malers wahrgenommen. Die Autorin dieses Ebooks befasst sich sowohl mit van Goghs Briefen als auch seinen Gemälden, die eine völlig neue Herangehensweise an die Farbe verkörpern. Die Legende steht dabei häufig in unmittelbarer Nachbarschaft mit Banalitäten, und das große künstlerische Genie wird mit der kleinlichen Wirklichkeit des Lebens konfrontiert. Trotz all seiner Ängste spürte van Gogh die Wichtigkeit seiner Arbeit und beharrte auf seinem Recht, anders zu sein. Die Zukunft gab ihm Recht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Autor: Jp. A. Calosse
Layout: Julien Depaulis
© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
ISBN : 978-1-78160-726-8
Weltweit alle Rechte vorbehalten
Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen.
Jp. A. Calosse
INHALT
Wie durch einen Spiegel im dunklen Wort ...
Holland, England und Belgien - 1853 bis 1886
Pflanzstätte von Ideen Paris - 1886 bis 1888
Ein richtiges KünstlerhausArles - 1888 bis 1889
Ich bin alles, was verrückt und verkehrt ist.Arles 1889
Saint-Rémy - 1889 bis 1890
Aber dieser Tod hat nichts TraurigesAuvers-sur-Oise 1890
INDEX DER WERK
ANMERKUNGEN
1.Selbstbildnis(Paul Gauguin gewidmet),Arles, September 1888,
Öl auf Leinwand, 62 x 52 cm,
Fogg Art Museum, Havard University,
Cambridge (Mass.).
2.Van Goghs leerer Stuhl (Arles),Dezember 1888,
Öl auf Leinwand, 93 x 73,5 cm,
National Gallery, London.
Wie durch einen Spiegel im dunklen Wort ...
Leben und Werk sind bei Vincent van Gogh so eng miteinander verwoben, dass es kaum möglich ist, seine Bilder zu betrachten, ohne darin die Geschichte seines so oft beschriebenen und verfilmten Lebens, das sich längst zu einer Legende verdichtet hat, zu lesen. Van Gogh ist zum Inbegriff des leidenden, unverstandenen Märtyrers der modernen Kunst geworden, in dem sich das Bild des Künstlers als gesellschaftlichem Aussenseiter manifestiert. Welche Rolle die Lebensgeschichte van Goghs für das Verständnis seines Werkes spielt, zeichnete sich schon früh ab. Der erste Artikel über den Maler erschien im Januar 1890 imMercure de France. Van Gogh befand sich zu dieser Zeit in der Nervenheilanstalt von Saint-Rémy, er hatte sich ein Jahr zuvor ein Stück seines rechten Ohres abgeschnitten. Der Autor des Artikels, Albert Aurier, stand mit Emile Bernard, einem Freund van Goghs, in Kontakt und war daher über die Ereignisse informiert. Ohne seinem Leser die biographischen Hintergründe darzulegen, überträgt Aurier sein Wissen um den „angeblichen“ Wahnsinn van Goghs auf seine Bildbeschreibungen: Da ist von „...leidenschaftlicher Besessenheit“[1], von „Zwangsvorstellung“[2]die Rede. Van Gogh sei ein „...schreckliches, halbtolles Genie, oft erhaben, zuweilen grotesk, immer fast ans Krankhafte streifend“[3]. Aurier sieht in dem Maler den „...Messias [...], der unsere greisenhafte Kunst, ja vielleicht unsere ganze greisenhafte, schwachsinnige industrialistische Gesellschaft erneuert“.[4]Mit dem Entwurf des verrückt-genialen Künstlers bereitete der Kunstkritiker, der nicht geglaubt hat, dass van Gogh je von einem großen Publikum verstanden werde, den Boden für einen van-Gogh-Mythos, der bald nach dem Tod des Malers begann.
Wenige Tage nach der Beisetzung van Goghs in Auvers-sur-Oise schrieb Dr. Gachet, der Arzt, der den Maler zuletzt betreut hatte, an dessen Bruder Theo: „Diese souveräne Verachtung des Lebens, zweifellos ein Ausfluss seiner ungestümen Liebe für die Kunst, hat etwas Außerordentliches. [...] Würde Vincent noch leben, würde es noch Jahre und Jahre dauern bis zum Triumph der menschlichen Kunst. Mit seinem Tod dagegen gibt es eine Art Weihung als Ergebnis des Kampfes zwischen zwei entgegengesetzten Prinzipien, dem Licht und der Dunkelheit, dem Leben und dem Tod.“[5]Weder verachtete van Gogh das Leben, noch war er in ihm souverän.
In seinen Briefen, von denen rund 700 veröffentlicht worden sind, schreibt er immer wieder von seiner Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit: „Ich möchte gern einmal bei einer Frau sein, ich möchte nicht leben ohne Liebe, ohne Frau.“[6]Van Goghs durchaus bürgerliche Träume von Heim und Herd erfüllten sich nicht. Seine erste Liebe, Eugénie Loyer, heiratete einen anderen. Seine Cousine Kee, bereits verwitwet und Mutter, lehnte eine Bindung unter anderem aus materiellen Gründen ab, weil van Gogh nicht in der Lage war, für eine Familie zu sorgen. Das nicht nur idyllische Zusammenleben mit der Prostituierten Sien beendete er auf Druck seines Bruders Theo, von dem er finanziell abhängig war. Van Goghs letzte Liebe zu der 21-Jährigen Marguerite Gachet ist nur gerüchteweise bekannt. Nicht nur um die Liebe der Frauen, auch um die Liebe und Anerkennung seiner Familie und Freunde warb van Gogh, ohne sie in dem Maße zu gewinnen, wie er es sich gewünscht hatte. „Wie durch einen Spiegel in einem dunklen Wort – es ist so geblieben“[7], resümiert er im Juni 1890 wenige Tage vor seinem Freitod. Diesen Vergleich entlehnte der Pfarrerssohn der Lobpreisung der Liebe aus dem 1. Korintherbrief: „Denn wir sehen jetzt nur wie mittels eines Spiegels in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich völlig erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin.“Die Sehnsucht nach dem Aufgehobensein in einer Gemeinschaft und das Ringen um ein Erkanntwerden sind zwei Motive, die sich durch van Goghs Leben ziehen.„Nirgends fühle ich mich so sehr als Fremder wie in meiner Familie ...“
3.Das gelbe Haus(Das Haus vonVincent in Arles), Arles, September 1888,
Öl auf Leinwand, 72 x 92 cm,
Rijksmuseum Vincent van Gogh,
Vincent van Gogh-Stiftung, Amsterdam.
4.Der Garten von Presbytère im Schnee,Nuenen, Januar 1885,
Öl auf Holz, 53 x 78 cm,
The Armand Hammer Museum
of Art, Los Angeles.
5.Die Kartoffelesser, Nuenen, April 1885,
Öl auf Leinwand,
81,5 x 114,5 cm, Rijksmuseum
Vincent van Gogh, Amsterdam.
Holland, England und Belgien - 1853 bis 1886
Am 30. März 1853 brachte Anna van Gogh einen gesunden Sohn zur Welt, der auf den Namen Vincent getauft werden sollte. Auf den Tag genau ein Jahr zuvor hatte Pastor van Gogh die Geburt und den Tod eines Sohnes gleichen Namens angezeigt: Vincent van Gogh, geboren am 30. März 1852, wurde auf dem Dorffriedhof begraben. Später, als Kind, las dort der zweitgeborene Vincent seinen Namen auf dem Grabstein. In seinen letzten Lebensmonaten erinnert sich van Gogh sehr oft an die Orte seiner Kindheit und nennt dabei immer auch den Friedhof von Zundert. Über das Kind Vincent ist wenig bekannt. Eine Nachbarstochter beschreibt ihn als „gutherzig, freundlich, lieb, mitleidig“[8]