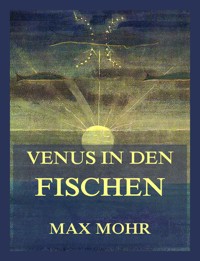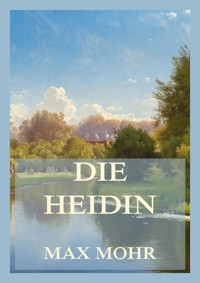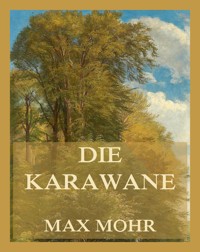Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schauplatz in diesem satirischen, gesellschaftkritischen Roman ist das Berlin der späten 20er Jahre. Eine Villa wird zur Medizinisch-astrologischen Heilanstalt; gegründet, um der großbürgerlichen Oberschicht mit fragwürdigen Methoden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Über Geburtshilfe, von Astrologie, Scharlatanerien und Ärztehierarchien wird erzählt. Auch von einem Mord und von der Liebe. "Mohr zeichnet das Bild einer starken, autonomen Frau, der die Männerwelt unterlegen ist. Außerdem stellt Mohr ein vom Materialismus bestimmtes, unheilvolles Leben in der anonymen Großstadt einem harmonischen, glücklichen Leben in der ländlichen Natur gegenüber." "Venus in den Fischen" steht in einer Reihe mit Kästners "Fabian".Mohr gehörte zu den erfolgreichen Autoren der Weimarer Republik. Geprägt waren seine Werke vom Zwiespalt zwischen Technik und Natur und von einer kritischen Distanz zur Haltung seiner Zeit, die er als materialistisch, oberflächlich und kulturlos empfand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Erster Teil
1 Die weiße Zyklame
2 Die tibetanische Milch
3 In den Fischen
4 Der letzte Fimmel
5 Die Kontrollgans
6 An der Reling
7 Die gebackenen Seezungen
Zweiter Teil
1 Zwei Fragen und eine Antwort
2 Die Treppe
3 Die Tanten - „mit“
4 Die Tatze
5 Die Tanten - „ohne“
6 Der alte Plantagenknecht
7 Brot und Wein
Dritter Teil
1 Der Straßenköter im Paradies
2 Der Knabenchor
3 Das feuerrote Fragezeichen
4 Die vier Worte
5 Der Rüpel
6 Bald wird es schnei’n
7 Das grüne Land
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag (Auswahl):
E-Books Edition Loreart:
Max Mohr
Venus in den Fischen
Erster Teil
1 Die weiße Zyklame
Ein junger Mann mit einer großen schweinsledernen Handtasche drängte sich als letzter in ein Nichtraucherabteil der Untergrundbahn Berlin, Richtung Westen. Das Abteil war überfüllt, es war gerade Geschäftsschluss. Das Abteil war überhitzt, es war ein warmer April. In dem Abteil quetschten sich aneinander und belästigten sich gegenseitig siebenundvierzig Menschen: zwölf Konfektionäre, fünf Herren von der Lebensmittelbranche, vier Herren von der Autobranche, ein höherer und zwei mittlere Staatsbeamte, ein Friseur, ein Dozent für Mittelhochdeutsch, ein Zahnarzt, ein Journalist, zwei Kellner, der junge Mann mit der großen schweinsledernen Handtasche, sechs Bürodamen, eine ältere und zwei junge Gattinnen, eine Lehrerin für moderne Gymnastik, zwei unverheiratete Tanten, eine ältere Individualistin aus der Provinz und drei Verhältnisse.
Der Wagen fuhr an und zog dahin durch seine schwarze Röhre. Darüber das tosende Zentrum der Stadt, darüber die elektrischen Lichter des zwanzigsten Jahrhunderts, darüber die ersten Himmelslichter der jungen Nacht. Im Südhimmel stand das Sternbild des Löwen, es bildete gerade das Asyl für den langsam weiterwallenden Neptun. Der große Drache raste durch den ganzen Nordhimmel und bäumte sich neben dem Kleinen Wagen bis zum Rande der Milchstraße empor, um zu zerbersten vor der sanften und unerschrockenen Vega. Der Mars war durch eine kleine einsame Wolke verdeckt, und die Venus ging gerade unter und sank dahin ins Tränenmeer des Westens.
Die große schweinslederne Handtasche geriet zwischen den Beinen des Friseurs und den Beinen der Individualistin ins Gedränge. Sie bildete auf diese Weise eine lebendige Brücke zwischen einer frisch gebügelten Normalhose und einem schwarzsamtenen Eigenkleid. Bei der nächsten Station gab es Platzwechsel, jetzt waren es die durchtrainierten Schenkel der Gymnastiklehrerin, welche sich gegen die große schweinslederne Handtasche pressten. Später geriet noch das jüngste Verhältnis daneben. Ganz gewiss hätten diese Damen lieber die starke Tuchfühlung vergröbert, die sie von der anderen Seite her durch die Herren der Konfektion erlitten, und wären alle etwas weiter von der Handtasche abgerückt, hätten sie deren Inhalt geahnt. So aber drängten sie ahnungslos ihre schmucken Glieder gegen eine ganze Welt des Schreckens, die mit ihnen unter der Lichtreklame der Stadt und unter der Lichtreklame der Ewigkeit, dahinfuhr. Gegen viele blanke scharfe böse Messer und Sägen und Haken und Zangen und Meißel und Nadeln, gegen ein geburtshilfliches Besteck modernster Konstruktion, für alle Möglichkeiten einer schweren Menschengeburt berechnet, nach der letzten Wissenschaft zusammengestellt, aber trotz aller technischen Verbesserungen noch mittelalterlich genug, um davon abzurücken, wenn man Individualistin oder Verhältnis ist.
An der Endstation stieg der junge Mann aus und wurde von dem Chauffeur eines großen offenen Luxuswagens angerufen. Er bejahte und stieg ein und fuhr jetzt ganz allein dahin, die Handtasche auf seinem Schoß und alle Himmelslichter über seinem breiten und ziemlich abgegriffenen Hut aus schwarzem Velours.
Die Villa des Warenhausbesitzers Benno Trillke war festlich erleuchtet, als der junge Mann vorfuhr. Das ganze Souterrain war erleuchtet, mit allen Wirtschaftsräumen: die gekachelte Küche, der Maschinenraum I mit den Heizmaschinen, der Maschinenraum II mit den Waschmaschinen und Spülmaschinen, der Maschinenraum III mit den Trockenmaschinen und Bügelmaschinen, der Gang zu den Konservenkammern und Weckgläserdepots, der Gang zu den Dienerschaftsstuben und Dienerschafts-WCs. Das Entree war erleuchtet, die Halle, das ganze Parterre. Der Architekt, der diese Räume im vorigen Herbst umgebaut hatte, hatte hier ein Meisterstück neuer Sachlichkeit vollbracht. Der Speisesaal war vollkommen leer, hinausgeworfen der echte Renoir und der unechte Kaiser-Augustus-Kopf, hinausgeworfen die echten Teppiche Persiens und die unechten Tanzmasken der Südsee, hinausgeworfen aller sonstiger Krimskrams aus Silber, Wolle, Holz und Porzellan, und außer dem langen Tisch mit den Stühlen in Reih und Glied und außer dem Geist des Architekten, der in aufdringlicher Weise den nackten Raum durchschwelte, war nichts mehr da. Auch der Musiksaal nebenan stand auf der Höhe seiner Zeit. Das Elektrola, das Pianola, der Lautsprecher, zwanzig schlichte Sessel, fertig. Und keine Büste Beethovens mehr, kein Bild mehr von Mozart auf der Reise nach Prag, nichts lenkte mehr Herrn Trillke und seine Gäste ab, wenn sie Bachs Fugen und den letzten Nachdichtungen chinesischer Märchen und den letzten Börsenberichten aus Frankfurt lauschten.
Auch der Wintergarten dieses sachlichen Parterres war erleuchtet: die snobistischen Kakteen, die romantischen Kamelien, die zarten Zyklamen. Und hier spielte sich gerade, auf einer weißen Zyklame, eine jener großen Tragödien der Gattung ab, wie sie jeder April milliardenfach mit sich bringt. Eine weibliche Kreuzspinne, weiß Gott woher verirrt in diesen hygienischen Palast, wiegte sich lüstern in ihrem kleinen Netz. Das weiße Kreuz ihres Rückens tanzte lockend auf und ab, lockend auf und ab auf der weißen Zyklame, lockend, lockend. Ein Kreuzspinnenmännchen kam, es kam von einer prunkvollen Hortensie aus der anderen Ecke des Wintergartens, es hatte sich einen langen Faden gesponnen, eine Leiter zum Balkon seiner Julia. Aber dieser Romeo weiß seit Jahrtausenden, dass seine dünne Liebesleiter zu doppeltem Zwecke dienen muss. Zum süßen Nahen und zum entsetzten Aufunddavon. Denn das große Kreuzspinnenweibchen frißt, wenn irgend möglich, das kleine Kreuzspinnenmännchen sofort nach der Paarung auf - wie es ja auch die Heuschreckenweibchen tun, die Weibchen der Gottesanbeterin, der Prophetin oder Prego dion, die Weibchen der Wasserspinne und manche Eheweibchen der menschlichen Gesellschaft. Das Kreuzspinnenmännchen kam trotzdem, es kam trotz besserem Wissen und trotz besserem Instinkt, es tanzte an und es erhitzte sich, und es berauschte sich, es paarte sich und wandte sich danach sofort zur überstürzten Flucht. Jedoch es wurde trotz der vorbedachten Rückzugssicherung von seiner schnelleren Gattin eingeholt. Erwischt, gepackt, zerrissen, aufgefressen. Von seiner kannibalischen Julia, im Liebesnetz auf der weißen Zyklame, im Wintergarten dieses sachlichen Parterres.
Erleuchtet war vor allem der ganze erste Stock dieses Hauses. Doch während die anderen Räume ihre Festbeleuchtung nur der Nervosität der gesamten Dienerschaft verdankten, brannten hier die Lampen mit gutem Grund. Hier sollte Frau Anna Trillke ihr erstes Kind zur Welt bringen. Hierher führte man den jungen Mann mit der Handtasche.
Herr Trillke empfing ihn in der Bibliothek. Es war eine blödsinnige Nacht für Herrn Trillke. Diese ganze Geburtsgeschichte ging ihm auf die Nerven. Er beherrschte das kleine und das große Einmaleins der Börse, das alte Testament der Nachfrage und des Angebots, das neue Testament der Mode und der Gesellschaft, den Katechismus des Sports und des Flirts und die Grammatik der dazugehörigen Presse und Literatur - aber heute versagte das ganze ABC seines Lebens. Er kam sich vor wie ein Schlemihl, der etwas angestellt hat und jetzt zusehen muss, wie die anderen Menschen die Suppe für ihn ausfressen. Dieser rüstige vierzigjährige „Wöchner“ liebte die verwöhnte dreißigjährige Wöchnerin, die sich in der Wochenstube nebenan in Schmerzen wand. Seine seelischen Zahnschmerzen konnten mit Anna Trillkes Geburtswehen konkurrieren, ebenso wie vor fünf Jahren sein eigenes Vermögen mit der Mitgift der schweren Bankierstochter hatte konkurrieren können. Er hatte das Telephon ausgehängt, um die ewigen Nachfragen der Verwandten und Bekannten abzustellen. Er hatte es satt, immer wieder die gleiche Antwort herunterplappern und die gleichen Glückwünsche hinnehmen zu müssen. Er ging nervös im Zimmer auf und ab. Er suchte sich eine geeignete Lektüre für diese entsetzlichen Wartestunden aus dem Bücherschrank. Es sollte in Erwägung der heiligen Nacht eine seriöse Lektüre sein. Er hatte sich gerade nach längerem Schwanken zwischen dem „Liebesleben der Ameisen“ und „Goethes Liebesleben“ für Goethes Liebesleben entschieden, als die weiß-uniformierte Magd den jungen Mann mit Handtasche ins Zimmer führte.
„Quaß.“
„Professor Lübbe hat mich informiert, habe volles Vertrauen, Doktor Quaß.“
„Besten Dank“, sagte der junge Mann und stellte die Handtasche ab. Er war bereits völlig verärgert. Die ganze Lächerlichkeit seines Daseins kam ihm in diesen pikfeinen Räumen zum Bewußtsein. Dass er vorher in die Untergrundbahn gequetscht worden war, weil man ihm das Auto nur auf halbem Weg entgegengeschickt hatte, empfand er jetzt plötzlich als beabsichtigte Demütigung. Die Magd im Entree hatte viel zu lange nach dem abgerissenen Aufhänger seines vorjährigen Sommerpaletots gesucht und war sichtlich erschrocken, als sie seinen alten Hut abnahm. Und dass dieser Herr Trillke in der gleichen Sekunde, da sein Mund von Vertrauen voll war, bereits den alten abgetragenen Sakko abgeschätzt und alles Vertrauen verloren hatte, war klar. Und schuld daran war selbstverständlich nur sein gottverdammter Brotherr und Chef, Professor Theodor Lübbe, Direktor des Lübbehauses, Modegröße für Geburtshilfe, Zauberer und Medizinmann der oberen tausend Luxuspuppen der Stadt. Dieser verkalkte Gorilla hatte ihm beim Weggehen nachgerufen: „Ziehen Sie Ihren besten Anzug an, Kollege Quaß!“ - Eine Frechheit, die bei einem dreißigjährigen Wissenschaftler von Rang genau den entgegengesetzten Erfolg bewirken musste. Doktor Quaß war im Lübbehaus untergeschlupft, um sich mittels eines schuftigen Assistentengehaltes für seine gewaltigen eigenen Forschungen zu bewahren, und nicht, um den eleganten Hausdiener mit der Geburtstasche zu mimen und sich Kleidervorschriften machen zu lassen. Jeder andere Assistent aus Lübbes Garde hätte weniger versäumt als er und hätte sich besser für diesen schmählichen Warteposten im Hause Trillke geeignet. Aber wenn es Herrn Trillke nicht paßte, dass er nun gerade seine alte, abgeschabte Arbeitsjacke anbehalten hatte, sollte er es ruhig sagen. Mit Vergnügen schob er wieder ab. Welch sinnloser Aufenthalt! Er durfte jetzt stundenlang, und wenn es schiefging tagelang, die Launen dieses Herrn und die Wehen seiner holden Dame abfangen, er durfte von Zeit zu Zeit dem vielbeschäftigten Chef den Stand der Geburt telephonieren, er durfte ihn dann zur rechten Minute herbeirufen - laut Instruktion musste es genau zwei Stunden vor der endgültigen Geburt sein -, um schließlich beim Knalleffekt untätig dabeizustehen, die Instrumente zu reichen, den alten Hokuspokus des Chefs anzusehen, die kleine Schlußnarkose à la reine zu machen und dann zum tausendsten Mal zu hören: „Ein Prinz, meine liebe gnädige Frau“, oder: „Eine Prinzessin, meine liebe gnädige Frau“, und dann zum Ende: „Jetzt kann ich es Ihnen ja verraten, und Doktor Quaß wird es bezeugen: es war außer-außer-außer-ordentlich schwer, aber jetzt ist alles-alles-alles allright, ein ganz besonders gut entwickeltes, frisches, wunderhübsches Kind -“
„Blödsinnige Sache, was?“ sagte Herr Trillke und schob Goethes Liebesleben beiseite. „Kommen sich eigentlich alle Ehemänner in diesem erhabenen Moment so lächerlich vor wie ich?“
Quaß lachte und war versöhnt. Der andere kam sich auch lächerlich vor, sie waren quitt. „Halb so schlimm, Herr Trillke“, sagte er, „Professor Lübbe hat ja heute mittag untersucht und alles in bester Ordnung gefunden, es liegt alles-alles-alles allright.“
„Unberufen“, sagte Herr Trillke und klopfte dreimal ans Mahagoni. „Wann kommt denn unser guter alter Lübbe? Ich meine - Sie werden Professor Lübbe doch ganz bestimmt zur rechten Zeit - lieber ein paar Stunden zu früh - lieber fünf Stunden zu früh, spielt ja gar keine Rolle -“ Aha, das war der abgetragene Sakko. „Es wird klappen“, sagte Quaß autoritativ.
„Lübbe hat ja selbst das größte Interesse, dass alles klappt“, sagte Herr Trillke. „Sie wissen vielleicht, dass ich einen großen Posten Lieferungen für das neue Lübbehaus übernommen habe? Und die Zahlungsbedingungen, die ich Ihrem Chef gestellt habe, ich muss ja sagen -“
„Gehen wir in die Wochenstube“, sagte Quaß und nahm seine Handtasche wieder auf.
„Einen Kognak zuvor, Doktor?“
„Besten Dank, Antialkoholiker.“
Das war eine ganz alberne Lüge. Quaß trank Wein, Bier und Schnaps. Aber er musste doch diesem verstörten Prinzgemahl irgendwie imponieren, er musste ihm doch irgendwie Vertrauen abgewinnen, vielleicht gab ihm diese kleine Farce den Glanz zurück, der durch seinen alten Sakko gefährdet war. Seine wahre wissenschaftliche Bedeutung konnte er ja diesem Warenhauskönig nicht erklären. Er konnte ihm auch nicht erklären, dass die Dame des Hauses bei ihm besser geborgen war als bei dem alten Zauberer und Scharlatan mit dem großen Modenamen.
Herr Trillke schenkte sich selbst einen Kognak ein und schien nicht besonders beeindruckt von der Originalität seines Gastes.
„Ich habe heute schon vier Geburten hinter mir“, sagte Quaß, „zwei Erstgebärende mit tadelloser Entwicklung, eine schwere Sache bei einer Achtgebärenden und eine ganz tolle Sache bei einer sehr bekannten Persönlichkeit aus der Filmwelt.“
Alles Lüge! Er hatte heute nichts weiter hinter sich wie die übliche Visite auf seiner Station im Lübbehaus und eine ganz simple Geburt auf außerdienstlicher Armenpraxis, eine rein soziale Sache, die mit seinem medizinischen Können überhaupt nichts zu tun hatte. Wenn er in diesem Tempo weiterlügen musste, um Herrn Trillke zu beruhigen, standen nette Dinge bevor. Wenn Lübbe kam, musste der erste Zufall alles aufdecken. Auch den Antialkoholiker. Denn dann wurde gewiss Sekt aufgetischt, er hatte ja schon oft genug mit seinem Chef angestoßen auf die frisch abgenabelten Prinzen und Prinzessinnen aus der goldenen und diamantenen Praxis des Lübbehäuses.
„Mein Gott“, sagte Herr Trillke, „dann sind Sie schon müde, dann sind Sie schon furchtbar müde heute nacht?“
„Im Gegenteil“, sagte Quaß, „solche Aufregungen pulvern gerade auf. Das war ja alles am frühen Vormittag. Am Nachmittag habe ich geschlafen, um für die Nacht auf dem Posten zu sein. Wie eine Ratte habe ich geschlafen, acht Stunden Schlaf habe ich schon hinter mir -“
Aber es half nichts mehr, Herr Trillke schien ziemlich enttäuscht. Dieser kindische Trotz, die alte, abgeschabte Jacke anzubehalten! Sie gingen in die Wochenstube hinüber.
Diese „Wochenstube“ nahm fast den ganzen ersten Stock des Hauses ein. Außer dem Gemach für die Königin der Nacht waren fünf Zimmer umgebaut und zur Verfügung gestellt. Man erkannte überall die weisen Ratschläge, die der Chef für den goldenen und diamantenen Teil seiner Praxis auszugeben pflegte. Außerdem erkannte man überall Herrn Trillkes großes Organisationstalent. Herr Trillke war nicht umsonst der Mann, dem die Trillke-Tage seines Warenhauses eine Popularität verschafft hatten, die sich sehen lassen konnte neben der Popularität eines Staatsmannes, eines Meisterboxers, eines Moderegisseurs oder eines Massenmörders. Quaß dachte an die Geburt, die er sich zwischen Mittagessen und Mittagsdienst abgestohlen hatte, um der Frau eines arbeitslosen Straßenbahners die Hebamme zu sparen. Der Mann hatte ihn vor der Klinik angebettelt, als er müde vom Dienst kam. Er war Arm in Arm mit dem Mann zu der Gebärenden gegangen, sie hatten zusammen die Hände der Gebärenden gehalten und der Mann hatte bei jeder neuen Wehe geschworen, dass er jetzt bestimmt wieder Stellung finden würde, um dann sofort „das grüne Kleid aus dem Ausverkauf“ für seine kleine Maus zu kaufen, mit dem ersten Vorschuß, auf Ehre und Seligkeit. Die kleine Maus war eine welke Fünftgebärende, deren vier lebende Kinder im schwarzen Flur hockten und im Takte mitwinselten, als die letzten Preßwehen einsetzten … Quaß konnte sich einen kleinen Auspuff zum Lobe der Armut nicht verkneifen. „Platz genug, Herr Trillke“, sagte er freundlich, „Platz für sieben Kaiserschnitte oder Sechsundsechzig normale Zwillinge!“ - „Malen Sie den Teufel nicht an die Wand, Herr“, sagte Herr Trillke.
Da war ein Vorzimmer für die Ärzte, in Lila, musste vor Urzeiten eine kleine Animierkneipe gewesen sein. Auf dem Rauchtisch neben dem Diwan standen außer den besten Marken der Rauchwarenabteilung des Trillke-Konzerns einige bunte Liköre für den antialkoholischen Assistenten. Am Telephon hing ein aufreizend großer Zettel mit den drei wohlbekannten Rufnummern des Chefs, ein Menetekel und Mißtrauensvotum für den alten Sakko mit der Geburtstasche.
Im Zimmer der beiden Wärterinnen stand der Wickeltisch, die Badewanne und eine duftige kleine Wiege. Sie war bereits angewärmt für das rätselhafte Menschenwesen, das aus der purpurnen Dunkelheit der Mitternachtssonnen zum grellen Licht des Tages drängte. Im nächsten Zimmer saß eine blonde junge Dame im weißen Ärztemantel und las in einem riesigen Wälzer, den Quaß sofort als Lübbes miserables „Handbuch der Geburtshilfe“ erkannte. „Fräulein Doktor Otterloo“, sagte Herr Trillke, „eine Freundin unseres Hauses, ein Familienmitglied, ist nur so da, nur zur Beruhigung, wird Ihnen nicht ins Handwerk pfuschen, Doktor.“ Das war ja heiter. Herr Trillke geriet selbst in Verlegenheit über diese Taktlosigkeit. Eine Art Oberaufsicht für den Unteraufseher des großen Chefs. Eine medizinische Kontrollgans aus der Familie. Es ging gegen die guten Sitten, ohne vorhergehende Vereinbarung einen anderen Arzt neben dem behandelnden Arzt zuzuziehen. Doktor Quaß begrüßte Fräulein Doktor Otterloo mit dem knallenden Hochmut des wahren Wissenschaftlers.
Das nächste Zimmer war ganz mysteriös. Da stand ein dicker Schreibtisch, dicke Wachskerzen darauf, ein dicker Sessel davor, ein großes Orchideenarrangement daneben, sonst nichts. Außerdem war das Zimmer auffallend überheizt. Herr Trillke erwartete hier noch einen Gast, einen „sehr bemerkenswerten und interessanten Gast“, eine großartige Überraschung für seine Frau. Da er dabei schelmisch lächelte, nahm Quaß an, dass wenigstens nicht noch eine zweite ärztliche Kontrolle zu erwarten war, und gab sich zufrieden. Offenbar sollte er weiter nachfragen nach diesem „bemerkenswerten“ Gast, da er sich aber bereits auf die überlegene Linie festgelegt hatte, nahm er es als selbstverständlich hin, dass man ein Neugeborenes sofort nach der Abnabelung in ein Zimmer mit Orchideenarrangements trug. Vielleicht war dies Zimmer für den Pastor oder für den Rabbi oder für den Kardinal bestimmt? Oder Trillkes gehörten einer religiösen Sekte an, die den Menschen in der ersten Viertelstunde des Lebens mit Orchideen einzusegnen befiehlt?
Aber das Badezimmer war in einen richtiggehenden Operationssaal verwandelt. Die Sublimatlösungen reichten aus, eine halbe Stadt zu desinfizieren. Die Jodlösungen reichten aus, sämtliche Lübbes und Kontrollgänse Europas zu vergiften. Und da stand ja auch schon, grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein, der „Lübbesche Gebärstuhl für alle Komplikationen“, an dessen Verkauf Lübbe mit fünfzig Prozent beteiligt war.
Hier packte Quaß seine Tasche aus, kämmte sich, wusch sich, nickte sich im Spiegel freundlich zu, reinigte sich mit einem festen Schubs Kölnischen Wassers von Untergrundbahn und sozialem Leid, vertauschte den alten Sakko mit dem blütenweißen Zaubermantel „Es-kann-nichts-passieren“, dann ließ er sich von Herrn Trillke in das Gemach der Königin geleiten.
Anna Trillke, geborene Sardowitz, war eine hübsche kastanienbraune Jüdin, sehr scharmant, sehr belesen und sehr trainiert. Da ihre Kindheit bereits in das Zeitalter des Sports gefallen war und da ihre Mama eine kluge und reiche Mama gewesen war, hatte sie schon die schmalen Hüften und die englischen Beine der jüngsten Generation zur Extramitgift erhalten. Die literarischen Seelsorger und Kostgänger des Hauses Trillke nannten sie die „Tizianlady“. Sie überragte ihren semmelblonden puritanischen Gatten beim Eislauf in St. Moritz und am Steuerrad des Autos, in der täglichen Gymnastikviertelstunde vor dem Frühstück und im Instinkt für Menschen, Tiere und Blumen. Er wiederum war der Stärkere im Verkehr mit den Dienstboten und in der Diät gegenüber Pralinen und Schlagrahm sowie im Ertragen der religiösen und sozialen Skrupel und der längeren Regenperioden auf dem Land. Es war eine harmonische Paarung. Er liebte sie, sie ließ sich von ihm lieben. Er war ein „paneuropäischer Gentleman“, solange man nicht in Geldgeschäften mit ihm zu tun hatte, sie war die „Tizianlady“, solange nicht ihre kleine fette Mama, der sie trotz allem verteufelt ähnlich sah, in der Nähe war.
Die Wehen hatten ausgesetzt, die Untersuchung ergab einen Stillstand der Geburt, Quaß machte sich auf eine lange Wartezeit gefaßt und fügte sich in sein Schicksal. Die Tizianlady faßte sofort Vertrauen zu ihm, da ihm der weiße Mantel ausgezeichnet zu Gesicht stand und da ihr Instinkt für gute Rasse und guten Geist in der Wehenpause unbeschränkt spielen konnte. Quaß genehmigte Herrn Trillke eine halbe Stunde Aufenthalt im Allerheiligsten, Quaß unterhielt sich mit den Eltern des erwachenden Fratzen über Zeit und Ewigkeit, über die Preiswürdigkeit der einzelnen Neuanschaffungen für die Geburt und über den zukünftigen Vornamen des Kindes.
„Es gibt keine vollwertigen Namen mehr“, sagte Frau Trillke.
„Weil es keine vollwertigen Menschen mehr gibt“, sagte Quaß.
„Ich bleibe bei Peter oder Ernestine“, sagte Herr Trillke.
„Ich bin noch gar nicht damit vertraut“, sagte Frau Trillke.
„Lass mal gehen, erst die Ware, dann das Inserat“, sagte Herr Trillke.
„Ausländische Namen gehen nicht“, sagte Frau Trillke, „obwohl Sven oder Daisy am besten klingt. Und allzu deutsche Namen gehen auch nicht, wir können das arme Wurm doch nicht nach meinem Schwiegervater Kuno-Ekkehard oder nach meiner Schwägerin Elfriede nennen.“
„Elfriede hat übrigens schon wieder angeklingelt“, sagte Herr Trillke, „wir sollen nicht vergessen, in allen Zimmern Kerzen und Petroleumlampen aufzustellen, das elektrische Licht könnte streiken.“
„Elfriede ist fürchterlich“, sagte Frau Trillke.
„Ich habe das Telephon schon ausgehängt“, sagte Herr Trillke.
„Alle aparten Namen sind zu apart und belasten das Kind“, sagte Frau Trillke, „alle banalen Namen sind zu banal und zu phantasielos. Und der Rest klingt entweder jüdisch oder katholisch oder nach dem Film. Es ist ein wahrer Jammer.“
„Peter Trillke, Ernestine Trillke, das klingt gut“, sagte Herr Trillke, „das klingt schnittig und solid und verpflichtet zu nichts.“
„Ich habe heute ein kleines Mädchen abgenabelt“, sagte Quaß, „das Kind eines arbeitslosen Straßenbahners, das bekam den stolzen Namen Grete-Olympia.“
„Schrecklich“, sagte Frau Trillke, „das Kind hat die Verpflichtung, eine ewig siegreiche Blondine zu werden.“
„Nach den Eltern zu schließen, wird es ein kleines schwarzes Scheusal“, sagte Quaß, „aber die armen Eltern wollten ihm doch wenigstens diese eine kostenlose Mitgift mit auf den Weg geben.“
„Arme Grete-Olympia“, sagte Frau Trillke, „wenn ihr alles schief gegangen ist, wird dieser Name den letzten Anstoß zum Selbstmord abgeben. Wie heißen Sie, Doktor?“
„Sebastian, Sebastian Quaß. Habe aber kein Talent zum Heiligen.“
„Ich glaube doch“, sagte Frau Trillke und wollte Quaß gerade mittels eines liebenswürdigen psychoanalytischen Quatsches ein Kompliment verabreichen, als die Wehen wieder einsetzten: „Oh, ah, ui ui ui uhhh!“ Herr Trillke trollte beschämt aus dem Zimmer, und Quaß bewährte sich wirklich als Heiliger, während er eine Stunde lang die Wehenwellen richtig abzufangen half. Aber dann setzte die Geburt wieder völlig aus. Peter-Ernestine schien nicht zu drängeln. Die Tizianlady schlummerte sogar ein wenig ein. Quaß übergab sie der Wärterin und telephonierte seinem Chef den Stand der Geburt. Dann ging er in die Bibliothek und riet Herrn Trillke, sich ins Bett zu legen und zu schlafen, es war noch reichlich Zeit bis zum stürmischen Teil der Nacht, er wollte ihn rechtzeitig wecken lassen. Danach ging er ins Ärzte-Zimmer, um selbst ein wenig auszuruhen.
Er hatte sich noch keine fünf Minuten auf seinem Diwan verstaut, als die „medizinische Freundin des Hauses“, die Kontrollgans, ohne Anklopfen in sein Zimmer trat. „Wie steht die Geburt?“ fragte die junge Dame. - „Sie steht still“, sagte Quaß und lümmelte sich unwillig wieder hoch. - „Sind Sie nicht der Mann mit den interessanten neuen Krebs-Theorien?“ fragte die junge Ärztin. - „Woher wissen Sie denn das?“ sagte Quaß.
Der junge Mann mit der interessanten neuen Krebstheorie und die Kontrollgans beglotzten sich feindselig.
„Es gehört doch zur Allgemeinbildung, Ihren Namen zu kennen, Herr Kollege“, sagte die junge Dame.
„Na, ich bitte Sie! Das ist doch vorerst eine ganz private Sache und steht noch völlig in den ersten Anfängen, wie kommen Sie denn darauf?“
„Na, ich bitte Sie“, äffte sie, „es wird doch nirgends so viel geklatscht wie in der Wissenschaft. Übrigens halte ich Ihre Theorie für falsch.“
„Vermutlich haben Sie keine Ahnung davon?“
„Selbstverständlich nicht! Was man halt so in den Fachzeitschriften liest und was man gelegentlich aus der Renommiererei Ihres großes Chefs aufschnappt.“
„Das wird ja der richtige Haferflockenbrei aus Klatsch und Blödsinn sein.“
„Ganz gewiss. Und ganz so dumm wie dieser Haferflockenbrei sehen Sie ja auch nicht aus. Aber trotzdem ist alles falsch, was Sie da in dem Januarheft der Londoner Medizinischen geschwefelt haben, über Krebs-Dispositionen oder wie das Zeug heißt.“
„Haben Sie gelesen?“
„Natürlich, sonst würde ich nicht darüber sprechen. Ich habe auch noch irgendwo einen anderen ziemlich falschen Aufsatz von Ihnen gelesen, über ‘Konstitutionelle Heilung der Krebsdisponierten vor Ausbruch der Krankheit.“
„Oder wie das Zeug heißt.“
„Ja, ja“, sagte die junge Dame, „alles Unsinn.“ Sie konnte ihrem Alter nach höchstens ein Jahr Ärztin sein und hatte offenbar keinen Dunst von den Dingen, über die sie sprach.
„Besten Dank für Ihr klares Urteil“, sagte Quaß.
„Bitte sehr.“
„Wie gut, dass ich Sie getroffen habe! Ich hätte tatsächlich noch ein paar Jahre an diese Sache gehängt. Ein Glück, dass ich jetzt die ganze Arbeit auf den Mist karren kann.“
„Tun Sie das“, sagte sie.
„Werde ich tun“, sagte Quaß, „morgen! Vielleicht findet eine Kollegin die bessere Lösung! Ich werde den Damen den Vortritt lassen. Schließlich ist es eine Frechheit, wenn in einem Frauenstaat ein Männchen eine epochale Entdeckung machen will.“
„Was sprechen Sie für einen komischen Dialekt?“ fragte die junge Dame, ohne auf die Frage des „Frauenstaates“ einzugehen, „sind Sie aus den Alpen?“
Aber Quaß merkte, dass ihr die Frage des „Frauenstaates“ unangenehm war und überhörte ihre Frage. „Morgen hänge ich meine ganze Arbeit an den Nagel und kehre reumütig zum niedrigen Stand der Arbeitsbiene zurück, um der Bienenkönigin nicht den Weg zu versperren. Es lebe das Vorbild der Bienen und Ameisen.“ Er hasste die Staatsordnung der Bienen und Ameisen, die von den Dichtern besungen und von den Wissenschaftlern bewundert wird. Das war gerade das richtige Vorbild für die sinnlose Organisationswut seiner Zeit. Die junge Dame schwieg, aber eine blödsinnig schulmädchenhafte Blutwelle ging über ihr Gesicht und zeigte, dass er auf dem richtigen Wege war. „Wie gut, dass Sie hier sind“, sagte er, „ohne Ihre Kontrolle hätte ich auch diese ganze Trillkesche Geburt verpatzt.“
„Erstens haben Sie mich falsch verstanden“, sagte die junge Dame, „ich kritisiere Ihren Krebsquatsch nicht, um Sie zu beleidigen, sondern um Ihnen ein Kompliment zu machen. Sie sehen gar nicht nach einem Wissenschaftler aus.“
„Das ist ein Kompliment?“
„Und ob“, sagte sie. „Ich stamme aus einer sehr berühmten Wissenschaftlerfamilie und kann das beurteilen, mein Herr. Und zweitens hat das mit männlich oder weiblich gar nichts zu tun und mit ‘Frauenstaat’ erst recht nichts. Sie haben keine Ahnung von dieser Frage, das habe ich an Ihrem Bienengeschwätz bereits bemerkt. Vor allem aber bin ich nicht zu Ihrer Kontrolle hier. Es ist albern, dass Sie sich über meine Anwesenheit ärgern. Schon vor Herrn Trillke haben Sie mich wie eine Verbrecherin behandelt. Wir beide werden doch nicht den Rahm von Herrn Trillkes Portemonnaie abschöpfen, weder Sie noch ich, sondern Ihr großer Chef, das größte Kamel, in das ich je hineingetreten bin.“
„Das stimmt“, entfuhr es Quaß.
„Gott sei Dank, dass Sie das zugeben. Ich habe Ihrem Chef in der vorigen Woche bei einer Zangengeburt zugeschaut, und ich muss sagen - ich habe ihm auch ganz offen ein paar schwere Kunstfehler zugeblinzelt.“
„Er wird sich gefreut haben. Wie lange sind Sie denn Ärztin?“
„Zwei Jahre. Ich empfehle jetzt allen Frauen, die mich zuziehen, Professor Sperlich.“ Sperlich war Lübbes große Konkurrenz. Offenbar stimmte das mit dem „Familienmitglied“ nicht ganz. „Aber diese Trillkes“, sagte sie verächtlich, „diese Leute stehen ja mit Lübbe in Geschäftsverbindung, da war nichts zu machen. Ist ja auch ganz egal hier, alles in Ordnung, Professor Lübbe kann das Kindchen hier mit seinem reinen Priestertum zur Welt bringen. Ich denke aber, er wird überhaupt nicht dazu kommen, diese Geburt hier zu machen, glauben Sie nicht auch?“
„Wieso?“ sagte Quaß. Ihr letzter Satz klang völlig rätselhaft. „Sind Sie nicht verwandt mit Trillkes?“
„Nein“, sagte sie und lachte.
„Sie sind doch eine Freundin dieses Hauses?“
„Ich denke nicht daran“, sagte sie und lachte sehr.
„Wozu sind Sie denn hier?“
„Zur Kontrolle.“
„Sie sagten doch selbst, dass Sie nicht zur Kontrolle hier sind.“
„Nicht zu Ihrer Kontrolle, weil Sie ganz vertrauenswürdig aussehen, trotz Ihres Krebsklimbims. Aber im allgemeinen werde ich doch zur geheimen Kontrolle der Herren Ärzte zugezogen.“
„Das ist sehr übel, meine Dame“, sagte Quaß, „es geht gegen die guten Sitten, ohne gegenseitige Vereinbarung einen Posten anzunehmen, auf dem schon ein anderer Arzt steht. Ich möchte nicht wissen, was das Standesgericht dazu sagen wird.“
„Großartig“, sagte sie. „Wollen Sie mich beim Standesgericht verpetzen? So sehen Sie aus! Mein lieber Herr, die armen Frauen sind sehr froh, wenn in ihrer schweren Stunde eine weibliche Kontrolle über die Herren Wissenschaftler in der Nähe ist. Wer sich den Luxus leisten kann, zieht mich zur Kontrolle zu, und wenn sich das Standesgericht auf den Kopf stellt. Vorerst hat auch noch keiner der Herren gewagt, mich anzuzeigen, ich werde schon seit Monaten von einer reichen Familie zur anderen reichen Familie empfohlen.“
„Sie könnten sich ja vorher mit dem behandelnden Arzt einigen, das wäre wenigstens offenes Spiel.“
„Mir macht es aber gerade so Spaß, als Familienmitglied, als medizinische Freundin des Hauses, da kann ich meinen eigenen Tarif verlangen. Und auf diese Weise sind wenigstens beide Parteien beleidigt: er, weil man ihm doch nicht so ganz vertraut, und ich, weil man mich doch so auf alle Fälle dabei stehen läßt. Das ist doch eine reizende Verschwörung zwischen der Dame des Hauses und mir gegen den behandelnden Mann, was wollen Sie! Werden Sie mich beim Standesgericht verklagen?“
„Verklagen werde ich Sie nicht, aber höchst übel finde ich diese Verschwörung, das kann ich Ihnen sagen.“
„Wieso übel? Ich brauche Geld. Ich bin aus einer sehr reichen Familie, aber ich bin von meiner Familie entlassen worden und sitze auf der Straße, ich muss Geld verdienen. Ich besitze noch nicht einmal ein eigenes geburtshilfliches Besteck, aber sagen Sie das nicht Herrn Trillke.“
„Sie sind sehr amüsant“, sagte Quaß. Er fand sie wirklich amüsant. Warum war sie von ihrer reichen Familie auf die Straße gesetzt worden? Hatte irgendein alternder Papa die große Selbstverständlichkeit ihres Wesens nicht verdaut? Sie war ja sehr sachlich, sehr hübsch, sehr deutlich. Das Zimmer nebenan, ihr Zimmer, war leer, und das zweite Zimmer nebenan, das Orchideenzimmer, war auch leer. Sollte er sie zur Strafe für ihr Attentat auf seine ärztliche Ehre und zum Lohn für seine Diskretion beim Schopf packen und abküssen, war das der Sinn ihres Vertrauens? Aber er hatte das ungefähre Gefühl, dass er dabei trotz ihrer hemmungslosen Art schwer ausrutschen könnte, das war die Sache wirklich nicht wert. Sie erriet offenbar seine Gedanken, denn sie sagte in sehr kühlem Ton: „Das geht Sie ja auch alles gar nichts an, ich werde Ihnen keinen Roman erzählen, ich werde Ihnen nicht erzählen, warum ich auf der Straße sitze, ich habe Ihnen das alles nur aus pekuniären Gründen anvertraut. Wir haben nämlich ein Geschäft zusammen.“
„Das ist mir neu“, sagte Quaß.
„Wir machen die Geburt ohne Lübbe“, sagte sie.
„Das ist ja ein reizender Plan.“
„Glauben Sie, wir können es nicht? Es liegt alles normal.“
„Deswegen ist es doch nicht! Ob normal oder nicht, spielt wirklich keine Rolle. Sie werden mir wohl Zutrauen, dass ich jeder Komplikation gewachsen bin.“
„Verzeihung, Herr Genie! Um so besser! Wir schmieren Lübbe aus.“
„Purer Unsinn, was Sie da reden, mein liebes gnädiges Fräulein. Der ganze Zweck meines lächerlichen hiesigen Aufenthaltes ist nur, den Professor rechtzeitig zu benachrichtigen.“
„Das ist es ja“, sagte sie. „Lübbe bekommt für diese glatte Sache mindestens zweitausend Mark, schätze ich. Sie bekommen gar nichts. Und mein Tarif für die geheime Kontrolle ist auf hundert Mark vereinbart. Wenn wir uns ein wenig irren über den Stand der Geburt und wenn wir vor lauter Aufregung Herrn Professor eine Stunde zu spät anfahren lassen, können wir es bequem einrichten, dass er das Nachsehen hat. Stellen Sie sich seinen Ärger vor, gerade bei dieser wichtigen Kundschaft, das ist allein unbezahlbar. Er kann uns nicht den kleinsten Vorwurf machen, wenn wir hübsch naiv tun und eine überraschend schnelle Endgeburt beschwören. Vor allem aber kann ich dann Herrn Trillke fünfhundert Mark für eine ganz und gar selbständige Geburt abnehmen, und wir können uns in den Gewinn teilen. Sehen Sie das nicht ein?“
„Vollkommen.“
„Stimmt die Rechnung nicht?“
„Aufs Haar.“
„Sind Sie reich, können Sie zweihundert Emm aus dem Fenster werfen?“
„Durchaus nicht.“
„Ist es nicht ein großartiger Plan?“
„Großartig.“
„Sind wir einig?“
„Einig sind wir. Aber ich habe mich bisher nicht von den Damen des Frauenstaates auffressen lassen, und ich habe auch nicht die Absicht, es in Zukunft zu tun. Sie sind eine ausgemachte kleine Hochstaplerin.“
„Sie sind ein ausgemachter großer Idiot“, sagte die Kontrollgans wütig und ging aus dem Zimmer. Der junge Mann mit der interessanten Krebstheorie grinste vor sich hin und verstaute sich wieder auf dem Diwan. Er wartete auf den Weckruf der Wärterin, die Wärterin war eine zuverlässige Person. Aber die nächste Wehenwelle war offenbar noch nicht zu erwarten, die Königin der Nacht schien noch zu schlafen, das ganze Haus schien zu schlafen, das Unaufhaltsame schien sich Zeit zu lassen.
2 Die tibetanische Milch
Ein langgestreckter offener Wagen rutschte langsam die nächtlichen Villenstraßen entlang. Der Scheinwerfer tastete die einzelnen Hausnummern und Straßenschilder ab, der Chauffeur fluchte dauernd vor sich hin und schien dauernd irre zu fahren. Im Fond des Wagens saß oder lag vielmehr ein herkulisch gewachsener Herr, die Arme weithin über die Rückenpolster gestreckt, die Beine rechts und links auf die beiden Seitentüren gelümmelt. Er starrte aufmerksam in den Sternenhimmel und kümmerte sich nicht im geringsten um die Irrfahrten seines Chauffeurs. Der Wagen geriet in eine Sackgasse und musste wenden - vor, zurück - vor, zurück - vor, zurück. Dann fuhr er wieder an und rollte auf den nächsten Häuserblock zu, um wieder die einzelnen Schilder mit dem Scheinwerfer abzutasten.
„Hupp“, sagte der Herkules im Fond, als eine große Sternschnuppe durch den nördlichen Himmel fiel. „Schnell eine Wunsch - och verdammt, jetzt habe ich mir eine kleine Schinkenbrötchen gewünscht anstatt fünf Milliönchen und hundert Jahren Gesundheit - schon zu spät -“ Er glitt noch tiefer in den Fond und wartete gespannt auf die nächste Sternschnuppe. Da sie nicht kam, begann er sich eins zu singen. Er quetschte die Melodie seines Liedes bis in die höchsten Kopftöne hinauf und synkopierte die Begleitung in den tiefsten Grunztönen zwischenhinein. Es klang wie das abgerissene Duo eines ganz alten und eines ganz jungen Höhlenmenschen. Plötzlich zog er das linke Bein an und versetzte seinem Chauffeur einen Tritt an die Schulter. „Alte Viechkerl, siehst du nicht die große Puff dort mit die Festbeleuchtung? Das ist es, aber ganz gewiss!“ Der Chauffeur drehte bei und ließ den Wagen auf Haus Trillke los.
„Stimmt, Herr Doktor“, sagte er, während er vorfuhr. Er sprang vom Sitz, um dem Herkules die Tür aufzureißen.
„Adios“, sagte der Herkules und rückte den zurückgerutschten steifen Hut tief ins Gesicht, während ihm sein Chauffeur einen Pelz und eine Handtasche überreichte. „Ich telephoniere, wann ich fertig bin. Geh zu Bett und schlaf deine Rausch aus.“ Der Chauffeur grinste und grüßte und fuhr wieder ab. Der Herkules wartete vor der Tür noch eine Zeitlang und spähte noch einmal aufmerksam nach dem Himmel. Aber keine Sternschnuppe fiel mehr nieder. Er drückte alarmierend lang auf die Klingel und trommelte sofort mit den Fingerknöcheln einen gewaltigen Marsch an die Vortür, bis man ihn einließ.
Quaß war noch nicht zehn Minuten eingeschlafen, als ihn eine grobe Hand wachrüttelte. „Herr Kollege, Herr Kollege, die Geburt ist schon vorbei!“ Quaß sprang auf und starrte perplex auf den Menschen, der vor ihm stand. Er sah einen weißhaarigen und äußerst elegant gekleideten Neger vor sich stehen. Kein Zweifel, dieser Herkules mit dem strahlenden Gesicht eines jungen afrikanischen Gottes und dem weißen Haaransatz eines alten europäischen Gelehrten und dem Hosenschnitt und Jackenschnitt eines großen Snob war ein Neger. - „Was ist?“ stotterte Quaß.
„Die Geburt ist vorbei, du hast alles verschlafen“, sagte der schwarze Herkules und grinste ihm freundlich ins Gesicht.
Quaß sah plötzlich das Trillkesche Hausmädchen an der Gangtür stehen und sich das Lachen verhalten.
„Du kannst gehen, du kleine Maus“, sagte der Neger zu der Magd, und das Mädchen ging.
„Was ist?“ fragte Quaß schroff.
Sein Besuch nahm sich eine Zigarette vom Rauchtisch, zündete sie an und sagte freundlich: „Sie haben die Geburt verschlafen, Herr Kollege.“
„Unsinn“, sagte Quaß.
„Unsinn?“ sagte der Neger, „ich spreche die Wahrheit. Ich bin soeben von Mama Trillke geboren worden. Ich bin die Kind.“
„Unsinn“, sagte Quaß.
„Haben Sie so was noch nicht gehört, Herr Kollege?“ fragte der Neger teilnahmsvoll.
„Darf ich Sie um Auskunft bitten“, sagte Quaß scharf. Er war überzeugt, dass der Neger kein medizinischer Kollege war.
„Auskunft? Mit Vergnügen! Es war eine ganz leichte Geburt. Gegen Schluß war es ein wenig unangenehm für mich, aber es ging sosolala. Mami schläft jetzt. Es war ja auch keine Kleinigkeit für sie. Die Wärterin wollte mich in eine Windel stecken, aber ich habe ihr auf die Finger geklopft. So eine ausgewachsene Baby wie mich steckt man doch nicht mehr in eine Windel, das müssen Sie doch selber zugeben, Herr Kollege!“
Quaß zuckte verächtlich die Schultern. Er hatte es offenbar mit einem Clown zu tun. Der Neger schien sich über diese Geste zu ärgern, denn er sagte sofort in völlig verändertem Ton, sehr selbstbewußt und fast ganz ohne fremden Akzent. „Kennen Sie mich nicht, kennen Sie mich wirklich nicht?“
„Bedaure“, sagte Quaß.
„Hat Ihnen Herr Trillke nichts erzählt?“
„Bedaure“, sagt Quaß. „Oder sind Sie vielleicht der Herr aus dem Zimmer mit dem kostbaren Orchideenarrangement?“
„Sehr nett von Herrn Trillke ist das! Eine alte heimatlose Strolch liebt diese kleine ausgerupfte Blumen. Da ist kein Wort dagegen zu sagen, mein Herr, dass in meine Zimmer Blumen stehen. Ich höre, Herr Trillke schläft noch ein bisserl, sonst hätte ich ihn schon begrüßt und mich für diese schöne Zimmer bedankt. Aber Sie sind ja auch nicht übel untergebracht! Ich werde ein wenig an Ihre Vorräte teilnehmen.“ Er schenkte sich einen Schnaps ein. „Auf eine gute Geburt, Herr Kollege!“
„Zum Wohl“, sagte Quaß. Er kam sich blöde vor. Dieser Herr hatte eine seltsam vergewaltigende Art.
„Ich bin Doktor Louis Abba, - der Name sagt Ihnen nichts, nein, wirklich nichts? Mein Gott, mein Gott, mein Gott, Sie junger Mann -“ Er schien ehrlich entsetzt über Quaß’ Unbildung. „Ist eigentlich noch jemand hier? Wann kommt die Professor? Wann ist die Geburt? Bin ich viel zu früh? Schläft die ganze Haus?“
„Hier nebenan ist noch eine Ärztin, die gnädige Frau hat gerade Wehenpause und schläft, es ist augenblicklich nichts zu tun“, sagte Quaß und ärgerte sich gleichzeitig, dass er so willig Auskunft gab.
„Noch eine Ärztin“, sagte Doktor Abba, „hier nebenan?“ Er öffnete ohne weiteres die Tür und steckte seinen Kopf ins Nebenzimmer. „Och - kennen wir uns nicht -?“
„Selbstverständlich“, hörte Quaß die Kontrollgans rufen. „Kommen Sie näher, Doktor Abba.“
„Woher kennen wir uns?“ fragte der weißhaarige Neger und blieb unter der Tür stehen.
„Wir haben uns in der vorigen Woche bei der Geburt im Hause Krugmann getroffen.“
„Darf ich rauchen?“ fragte der Neger.
„Aber bitte, Doktor Abba, treten Sie näher.“
Der Neger schritt ins Nebenzimmer, ohne Quaß eines weiteren Blickes zu würdigen. Er schloß die Tür hinter sich, und Quaß war wieder allein. Dieser verdammte Lübbe, sagte er laut vor sich hin, dieser verkalkte Gorilla! Lübbe war an allem schuld. Aber woran eigentlich? Er setzte sich auf den Diwan und horchte auf die Kollegenschaft im Nebenzimmer, die sich sehr lustig zu unterhalten schien. Aber er konnte nichts verstehen. Bevor er sich wieder auf dem Diwan verstaut hatte, kam die Wärterin und rief ihn zur gnädigen Frau.
Während er sich im Badezimmer die Hände wusch, beschloß er drei Dinge. Erstens durfte weder dieser Doktor Abba noch dieses Fräulein Otterloo das Geburtszimmer betreten. Er allein trug die Verantwortung. Wenn die Preßwehen kamen, wurde Lübbe gerufen, dann konnte Lübbe die Verantwortung übernehmen. Bis dahin waren noch viele Stunden Zeit, bis dahin war er Herr dieses Hauses und - basta.
Zweitens wollte er der armen Dame des Hauses die Geburt in brillanter Weise erleichtern. Sie sollte ihr Leben lang mit Freuden an ihn denken. Dass ein Kunstfehler unterlief, war bei seiner Schulung ausgeschlossen, aber er wollte auch seine ganze menschliche Kraft einsetzen, um ihr die schwere Stunde zu erleichtern. Er fühlte plötzlich eine tiefe Zuneigung zu der armen Mutter, zu der lieblichen Puppe aus der höheren Konfektion. „Sebastian Quaß?“ sollte sie in zwanzig Jahren sagen, „ist er jetzt so berühmt geworden? Ach ja, ein wunderbarer Mensch, hat mir bei der Geburt meiner Ernestine die schwere Stunde mit den glühenden Rosen der Menschenliebe bekränzt. Quaß for ever …“
Und drittens sollte jetzt endgültig die ganze Menschheit von der Krebskrankheit erlöst werden, dann war es aus mit den Kleidervorschriften irgendeines verkalkten Chefs, mit der dreisten Kritik irgendeiner albernen Medizinerin, mit den Clownerien irgendeines schwarzen Herkules. Er wenigstens war dann für dieses Gesindel nicht mehr vorhanden. Was dieses blonde Persönchen über seine Krebstheorie gefaselt hatte, war natürlich pure Frechheit gewesen. Trotzdem saß es, saß fester, als sie ahnen konnte. Ein kleiner Teil seines wissenschaftlichen Materials war von der internationalen Forschung anerkannt worden, aber er hatte sich doch hinreißen lassen, seine Thesen viel zu früh am Markt der Eitelkeit anzuschlagen. Es war noch ein riesenhaftes statistisches Feld durchzuackern, und die Kontrollgans hatte recht: er war kein Wissenschaftler in dieser algebraischen Zeit, in der eine Idee nur mit dem Hosenboden, nur gegen tausend winzige Schikanen der Materie und der Menschen, nur mit der Kleinarbeit vieler einsamer Jahre verwirklicht werden konnte. Und nun gerade! Er war diesen beiden Halunken gegenüber nicht sehr gewandt gewesen, er hatte nicht die richtige Antwort gegeben, aber war er nicht auch in den letzten Jahren zum Mönch geworden? Musste er nicht zum Mönch werden? Jawohl, er musste in der Zelle bleiben, bis sein Gebet erhört war.
„Doktorchen, au au au …“ stöhnte die Tizianlady, als er in ihr Zimmer trat.
„Halten Sie meine Hände fest, mein Kind“, sagte er zärtlich. Aber die Wehenarbeit war noch schwach, die Welle ging schnell vorüber. Die Tizianlady musste das Bett verlassen und einige leichte gymnastische Spezialübungen machen. Die Wärterin wurde in ihr Zimmer geschickt, um ein wenig zu rasten, Quaß übernahm selbst die Wache für die nächsten Stunden.
Er bot der Dame des Hauses den Arm und führte sie im Zimmer auf und ab. Sie durfte vorerst nicht ins Bett zurück. Gehorsam trippelte sie in ihrem gelbseidenen Zimmermantel neben ihm die Ecken des großen Zimmers aus.
„Eins zwei, eins zwei, eins zwei, nur nicht stehenbleiben, nur immer weiter, wird schon gehen. Wir marschieren jetzt durch das Tal der seligen Schmerzen. Die Marzipanbrücke hinter uns ist abgebrochen, wir können nicht mehr zurück, wir müssen durch. Der Weg ist ein wenig wild, unsere reizenden roten Pantöffelchen sind solche Wege gar nicht gewöhnt, aber auf einmal ist unser Tal zu Ende, und da hockt das Baby und ruft: How do you do, Mama?“
Die Tizianlady marschierte tapfer neben dem breitschulterigen jungen Mann auf und ab und horchte ein wenig mißtrauisch auf seine Predigt im fremdartigen älplerischen Ton.
„Meine liebe gnädige Frau, zur gleichen Stunde wie wir wirft jetzt eine kleine zarte Hirtin auf der tibetanischen Hochebene ihr Kälbchen. Das ist eine schlimme Sache, auf der tibetanischen Hochebene ein Kind zur Welt zu bringen, wenn gerade so ein richtiger Schneesturm vom Himalaja herüberweht. Kein Dach über dem Kopf, nichts zu essen, keine ausgekochten Linnen, kein Doktor, der seinen Quatsch dazu quatscht. Aber hier bei uns ist es ja eine Kleinigkeit, eins zwei, eins zwei, eins zwei. Und auf einmal ist alles vorüber, in Tibet und bei uns. Dann trinken wir ein Glas Milch, das schmeckt wie die Milch jener bekannten tibetanischen Himmelskuh. Auch unsere kleine Hirtin bekommt ein Glas Milch, man kredenzt es ihr in einem alten schmierigen Lederbecher. Die Zeit kann ja auf keinen Fall plötzlich stillstehen, weder in Tibet noch hier, das ist wissenschaftlich nachgewiesen.“
„Doktorchen!“
Eine Wehe. „Lehnen Sie sich an mich“, befahl Quaß, „ganz fest, noch nicht pressen, das kommt später, so so so -“ Sie stemmte ihre Arme auf seine Schultern, er hielt sich steif wie eine Mauer und trug ihre Last. Als er fühlte, dass die Welle vorüber war, löste er ihre Arme von seinen Schultern. „Schon vorbei, weggeschwommen, die kommt nicht wieder.“
„Ich glaube, ich kann es nicht durchhalten, Doktorchen.“
Quaß lachte. „Das sagen alle Frauen, mein Kind, das hat Ihre Mutter gesagt und hat meine Mutter gesagt, das wird in fünfundzwanzig Jahren auch wieder Ernestine sagen, Ernestine Liebling, geborene Trillke, wenn das Enkelkind an der Reihe ist.“
Sie eröffneten wieder die Promenade. Er spielte ihr wieder eine kleine sentimentale Sonate auf, um ihre Angst abzulenken. Sobald eine neue Wehenwelle kam, musste sie sich wieder an ihn lehnen. Dann hielt er still, bis die Welle abgeklungen war. Es war die seltsame Umarmung, die auf der Liste der geheimnisvollen Liebesgesten ganz am Ende steht. So stützt im Urwald auch der melancholische Menschenaffe seine kleine Äffin, wenn sie mit wildem Brüllen sich zerspalten muss.