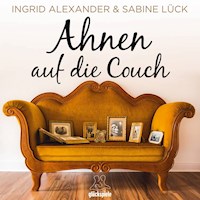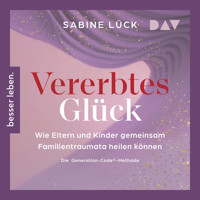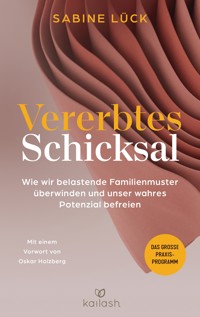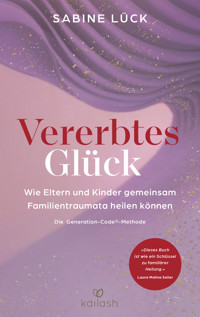
19,99 €
Mehr erfahren.
Familiäre Verstrickungen lösen und glückliche Bindungen schaffen
Die Schicksalsschläge und Überlebensprogramme unserer Ahnen beeinflussen uns bis heute und bestimmen auch den Umgang mit unseren Kindern. In diesem Buch zeigt die renommierte Psychotherapeutin Sabine Lück, wie sich Eltern destruktive Familienmuster bewusst machen und sie gemeinsam mit ihren Kindern auflösen können, um diese von der tiefen Loyalität gegenüber dem Leid ihrer Vorfahren zu entbinden.
Die von der Autorin entwickelte Generation-Code®-Methode gibt Familien von Anfang an einfache und effiziente Werkzeuge an die Hand (geeignet ab 0 Jahren), um die seit Generationen belastete Bindungs- und Beziehungsfähigkeit zu stärken und einen gesunden Umgang mit Emotionen und Bedürfnissen zu erlernen. So gelingt es, die Weitergabe von transgenerationalem Trauma nachhaltig zu stoppen und Kindern eine glückliche Zukunft ohne Erblast zu eröffnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Schicksalsschläge und Überlebensprogramme unserer Ahnen beeinflussen uns bis heute und bestimmen auch den Umgang mit unseren Kindern. In diesem Buch zeigt die renommierte Psychotherapeutin Sabine Lück, wie sich Eltern destruktive Familienmuster bewusst machen und sie gemeinsam mit ihren Kindern auflösen können, um diese von der tiefen Loyalität gegenüber dem Leid ihrer Vorfahren zu entbinden.
Die von der Autorin entwickelte Generation-Code®-Methode gibt Familien einfache und effiziente Werkzeuge an die Hand (ab 0 Jahren), um die seit Generationen belastete Bindungs- und Beziehungsfähigkeit zu stärken und einen gesunden Umgang mit Emotionen und Bedürfnissen zu fördern. So gelingt es, die Weitergabe von transgenerationalem Trauma nachhaltig zu stoppen und Kindern eine glückliche Zukunft ohne Erblast zu eröffnen.
Die Autorin
Sabine Lück ist Psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Lehrende der Systemischen Therapie. Sie leitet das Institut für Transgenerative Prozesse (ITP) in Wendeburg. Zusammen mit ihrer Kollegin Ingrid Alexander entwickelte sie 1994 den Generation-Code®, ein innovatives Therapiekonzept zur Behandlung transgenerativer Traumata. Sabine Lück ist Co-Autorin von »Ahnen auf die Couch« und Autorin von »Vererbtes Schicksal«. Das von ihr entwickelte Konzept der Spiele-Apotheke® ermöglicht ein spielerisches Eltern-Kind-Coaching zur Stärkung von Bindungs- und Beziehungsfähigkeit.
SABINE LÜCK
Vererbtes Glück
Wie Eltern und Kinder gemeinsam Familientraumata heilen können
Die Generation-Code®-Methode
Mit einem Vorwort von Laura Malina Seiler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.HinweisDie Ratschläge und Informationen in diesem Buch sind von Autorin und Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Copyright © 2025: Kailash Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtangaben nach GPSR)
www.kailash-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Martin Stiefenhofer
Coverdesign: ki 36 Editorial Design, Stephanie Reindl, München
Covermotiv: © ki 36 Editorial Design
Bildnachweis: Abb. 1: Gitte Gorzitzke, Abb. 2: Shutterstock/VectorMine, Abb. 3: Shutterstock/Rendix Alextian, Abb. 4: Sabine Lück
Gestaltung und Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32964-8V001
Inhalt
Vorwort von Laura Malina Seiler
Vorwort von Sabine Lück
Die Grundlagen: Traumata, die Generationengrenzen überwinden
Eine Wunde wird vererbt
Wie werden Traumata über Generationen weitergegeben?
Wie dir dieses Buch hilft
Kapitel 1: Wie die Vergangenheit unser aktuelles Familienleben prägt
Der transgenerationale Blick eröffnet eine neue Perspektive
Das Vergangene wirkt noch heute
Was sind Trigger und was triggert dich?
Übung 1: Deine Trigger und Glimmer
Wie sich Emotionen vererben
Vererbte Emotionen verzerren den Blick auf unsere Kinder
Kapitel 2: Das Kind als Erbe der Familienwunde
Alles beginnt schon vor der Geburt
Der Treuevertrag des Kindes
Kann man ein Geburtstrauma heilen?
Übung 2: Den Anfang heilen
Starke Wurzeln – die Heilung des Stammbaums
Übung 3: Die Wurzeln des Stammbaums heilen
Kapitel 3: Kindliche Entwicklung und transgenerationale Weitergabe
Entwicklungsphasen des kindlichen Gehirns
So reift das Gehirn unserer Kinder
Transgenerationales Trauma und Bindung
Der archaische Grundkonflikt und die scheinbare Lösung des Kindes
Die fünf Heilungswege des Kindes
Übung 4: Deine Heilungswege als Kind
Die Erfüllung der kindlichen Grundbedürfnisse
Übung 5: Auf den Spuren der Einflüsse auf dich
Übung 6: Gesunde Grenzen erfahren
Löwenzahn und Orchidee – warum Kinder so unterschiedlich sind
Übung 7: Dein hochsensibles Kind
Das omnipotente Kind und seine Mission, die Eltern zu retten
Übung 8: Der Beschluss des omnipotenten Kindes in dir
Kapitel 4: Den Teufelskreis der Weitergabe durchbrechen
Wie gibst du die Wunde weiter?
Übung 9 Teil 1: So geben wir die Wunde weiter
Übung 9 Teil 2: So geben wir die Wunde weiter
Das Heilserum für die Versorgung der Familienwunde
Übung 10: Ideale Eltern und ideale Umstände
Die Familie als dynamisches System
Übung 11: Das Familiennetz
Wie Paare sich finden – Heilserum für das Familiensystem
Übung 12: Der unbewusste Paarvertrag
Das Eltern-Kind-System
Die Ebene der Geschwister
Übung 13: Dein Geschwister-Vertrag
Übung 14: Schuldgefühle und Rollen ablegen
Kapitel 5: Befreie deine »Kellerkinder« – ein neuer Umgang mit Gefühlen
Wenn Gefühle verbannt werden müssen
Die Kellerkinder ans Licht holen
Übung 15: So geben wir unsere Ängste weiter
Übung 16: Das verletzte innere Kind trösten
Übung 17: Schamgefühle loslassen
Übung 18: Die ungeliebten Schattenseiten befreien
Kapitel 6: Kinder als Spiegel der Familienseele
Familiensysteme generationenübergreifend betrachten
Was Kinder zu sagen haben – das Erstinterview
Die Bindung stärken
Übung 19: Liebes-Schatzkiste
Übung 20: Jahrestage in der Familiengeschichte
So können wir Glück vererben
Übung 21: Der Weg zu deinem erfüllten Leben
Stärke die Resilienz und Selbstwirksamkeit deines Kindes
Kapitel 7: Gelingende Kommunikation – die Basis des Glückserbes
Erste Gespräche mit dem Kind
Kommunikation mit Einfühlungsvermögen
Übung 22: Ich spür da ein Gefühl in mir
Übung 23: Das Wutschaf
Übung 24: Sorgengrübelchen zum Mond schießen
Transgenerationales Trauma und Kommunikation
Übung 25: Quasselstrippen für den täglichen Family-Talk
Kapitel 8: Traumata in unserer Zeit
Wir entscheiden selbst, wie wir mit unserem Schicksal umgehen
Gewalt im nahen Umfeld
Flucht und Krieg
Traumasensible Begleitung von Kindern
Kapitel 9: Familie ist bunt
Adoptiv- und Pflegefamilien
Übung 26: Herzpflaster
Biografiearbeit mit Kindern
Übung 27: Das Märchen über dich
Transgenerationale Weitergabe bei Samenspende und Co.
Patchwork-Familie und ihre Herausforderungen
Regenbogenfamilien
Übung 28: Der Treuevertrag mit zwei Vätern bzw. zwei Müttern
Transgender und der Treuevertrag des Kindes
Werte, Traditionen und transgenerationale Familienmuster
Übung 29: Interview mit einem Weihnachtsbaum
Übung 30: Wickelspiele – liebevolle Reime
Übung 31: Herzensverbinder
Übung 32: Gute-Nacht-Bonbon ohne Zucker
Übung 33: Ein Haus für deinen Namen
Übung 34: Gefühle in Gläsern
Übung 35: Angsthäschen in der Grube
Übung 36: Monsterwald
Übung 37: Der Schleifenstab
Übung 38: Die Klageglocke
Übung 39: Familiengeflüster
Übung 40: Heute bin ich du
Übung 41: Körperlandschaft der Gefühle
Übung 42: Ich will das, was du da hast
Übung 43: Die Wuttreppe
Übung 44: Der Wutballon
Übung 45: Schmetterlings-Umarmung
Übung 46: Atemübung Berg und Tal
Übung 47: Storchenbein & Co.
Übung 48: Slow Motion – Wutgefühle reduzieren
Schlusswort und Dank
Zusatzmaterialien zum Download
Hilfreiche Tipps für die Ahnenforschung
Die Spiele und Übungen im Überblick
Verwendete und weiterführende Literatur
Hilfreiche Kinderbücher, Kartensets, Spiele und Podcasts
Register
Vorwort
Manchmal begegnen uns Bücher, die wie ein Schlüssel sind – Schlüssel, die uns Türen zu innerem Frieden und familiärer Heilung öffnen. Sabine Lück hat mit Vererbtes Glück genau ein solches Werk geschaffen. In ihrer tiefgehenden und einfühlsamen Weise zeigt sie auf, wie tief das Erbe unserer Ahnen in uns verankert ist und wie wir dieses Erbe aktiv gestalten können, um Glück und Frieden anstelle von Schmerz weiterzugeben.
Sabine Lück ist nicht nur eine Freundin und Mentorin, sondern für viele auch eine Wegweiserin, wenn es darum geht, uns selbst und unsere Beziehungen heilsam zu verstehen. Durch ihre jahrzehntelange Erfahrung hat sie das Wissen, den Menschen einen Zugang zu verschaffen, der den Blick für familiäre Muster öffnet und dabei hilft, sie liebevoll und achtsam zu durchbrechen. Für sie ist Familientrauma kein starres Schicksal – es ist eine Einladung zur Transformation.
In diesem Buch nimmt Sabine uns an die Hand, um das Konzept der transgenerationalen Weitergabe von Trauma und Glück zu verstehen. Durch ihre Generation-Code®-Methode zeigt sie uns, wie wir die Wunden unserer Vorfahren heilen können, ohne selbst in deren Fesseln zu verharren. Sie lädt uns ein, die unsichtbaren Verträge, die über Generationen hinweg geschlossen wurden, bewusst zu erkennen und aufzulösen. Es ist eine kraftvolle Reise, die uns befähigt, das Glück als lebendiges Vermächtnis weiterzugeben.
Vererbtes Glück ist mehr als eine Ansammlung von Wissen – es ist ein liebevoll gestalteter Leitfaden, der den Leser dazu ermutigt, mit Achtsamkeit und Mitgefühl auf die eigene Familiengeschichte zu blicken. Sabines Übungen und Rituale bieten konkrete Hilfestellungen und ermöglichen eine direkte Anwendung im Alltag. So wird jede Seite dieses Buches zu einem Werkzeug, das uns dabei unterstützt, positive Veränderungen zu schaffen und ein gesundes, kraftvolles Familiensystem aufzubauen.
Wenn du dieses Buch in den Händen hältst, dann mach es zu deinem eigenen. Lass dich von Sabines Worten und der Kraft ihrer Arbeit berühren. Lass dich auf die Übungen ein und nimm dir die Zeit, die Weisheit ihrer Methoden in deinem Leben zu verwurzeln. Du wirst sehen: Die Reise durch dieses Buch kann ein Licht auf deinen Weg werfen und dir helfen, dich selbst und deine Familie mit neuem Verständnis zu sehen.
Möge Vererbtes Glück dir die Hoffnung und Kraft schenken, die du für deinen eigenen Weg brauchst. Und möge es dir zeigen, dass wir alle die Fähigkeit haben, statt Schmerz Glück zu vererben – an unsere Kinder, unsere Enkel und darüber hinaus.
In tiefer Wertschätzung,
Laura Malina Seiler
Vorwort
In deinem Körper und in deiner Seele sind vererbte Erfahrungen, übernommener Schmerz und alte Überlebensprogramme gespeichert – aber auch das Wissen um das, was es braucht, um alte Wunden heilen zu lassen und das Hier und Jetzt aus den Verstrickungen der Vergangenheit zu befreien. So können wir Glück statt Schmerz vererben.
Sabine Lück
In den letzten Jahren hat sich das Wissen um transgenerationale Weitergabe von Traumata und Traumabewältigung rasant verbreitet. Wir können inzwischen auf wissenschaftliche Forschungen zurückgreifen und sehr differenziert nachvollziehen, auf welchen Wegen sich das Leid unserer Vorfahrinnen auf die folgenden Generationen überträgt. In den 1990er-Jahren, als dieses Forschungsfeld noch in den Kinderschuhen steckte, entwickelte ich zusammen mit meiner Kollegin Ingrid Alexander das Konzept Generation-Code®.
Wir erkannten, dass nicht nur unsere Ahnen in ihrem Wunsch nach Weiterentwicklung für die Nachkommen Botschaften und Aufträge nach vorn, in die Zukunft weiterreichen, sondern auch das Kind einen Heilungsimpuls ins Familiensystem bringt und einen unbewussten Treuevertrag mit seinen Eltern eingeht. Das abhängige Kind spürt die existenzielle Notwendigkeit, seine Eltern stabilisieren zu müssen, um selbst überleben zu können. Wenn es für das Familiensystem von Nutzen ist, dann ist es sogar bereit, seine eigene Entwicklung zurückzunehmen. Der tiefe Wunsch des Kindes, seine Eltern und Ahninnen zu heilen und sie an ihrem wundesten Punkt zu schützen, wird zu seiner lebenslangen Mission der Elternrettung. Als Erwachsene verfolgen wir, ohne es zu bemerken, dieses Lebensziel und übertragen unseren kindlichen Heilungswunsch auf Partner, Freundinnen, Arbeitskollegen und auf unsere Nachkommen. Für unsere Kinder bedeutet das, Eltern zu erleben, die in ihrem Kind die Möglichkeit einer Wiedergutmachung eigener Sehnsüchte und die ihrer Eltern und Vorfahren sehen und die zusammen mit guten Absichten auch das alte Leid übertragen. So entsteht auch in dieser neuen Generation ein unbewusster Treuevertrag des Kindes mit seinen Eltern, und der Generation-Code® setzt sich weiter fort.
Je mehr ich mich mit diesem Thema befasste, desto mehr erkannte ich bestimmte Muster und Regelmäßigkeiten hinter diesen transgenerationalen Prozessen. Ein sehr starkes Muster ist der Wunsch aller Beteiligten, etwas Gutes für die Zukunft und die nachfolgenden Generationen zu schaffen. Eltern und Großeltern wollen fast immer, dass ihre Nachkommen glücklich sind und ein besseres, erfolgreicheres Leben führen können. In diesem Wunsch verweben sich eigene Defizite, aber auch der tiefe Heilungswunsch ihrer inneren Kinder – der Teil eines Menschen, der noch immer auf liebevolle elterliche Versorgung angewiesen ist –, der sich auf die eigenen Eltern und Vorfahrinnen richtet. In ihren Kindern und Enkeln können sie womöglich etwas nachholen, wiedergutmachen, was Generationen zuvor misslungen ist. Wir wollen NICHT das Leid weiterreichen, wir wollen Glück vererben. Wieso gelingt das aber meistens nicht, und was braucht es, damit wir die Schätze der Vorfahrinnen annehmen dürfen, ohne den Preis, ihr Leid zu tragen, zahlen zu müssen?
Ich möchte Eltern, Familien und Fachleute mit diesem Buch Möglichkeiten aufzeigen, wie sie alte Verstrickungen aufspüren und verstehen können und ein Weitergeben an die eigenen Kinder verhindert werden kann. Ich möchte dir, liebe Leserin, lieber Leser, dabei helfen, diese stellvertretende »Versorgung« deines Kindes mit all dem, was dir oder deinen Eltern und Großeltern nicht vergönnt war, zu erkennen und damit den Transfer für die transgenerationale Weitergabe der Familienwunde stoppen zu können.
Nachdem ich jahrelang mit Erwachsenen zu ihren als Kind geschlossenen Treueverträgen gearbeitet hatte, drängte sich mir der Wunsch auf, bereits zu der Zeit etwas tun zu können, während der der transgenerational begründete Loyalitätsvertrag (Treuevertrag) mit den Eltern geschlossen oder vertieft wird: in der Kindheit, wenn Kinder mit uns als Eltern oder anderen Bindungspersonen zusammenleben und sich unser transgenerationales Erbe wie ein dunkler Schatten auf den Umgang mit unseren Kindern legt. Es ist die Zeit, in der unser Kind auf eine gelungene Spiegelung und eine passgenaue Beantwortung seiner Grundbedürfnisse durch feinfühlige Bezugspersonen angewiesen ist, um sich selbst erkennen zu können. Hier wirken übernommene Traumaerfahrungen unserer Vorfahren mit ihren vererbten dysfunktionalen, also nicht funktionierenden Familienmustern, die von Gewalt, fehlender Bindungsfähigkeit und einschränkenden Überlebensstrategien geprägt sind. Sie wirken wie ein täglich verabreichtes Gift und verhindern ein authentisches Miteinander. Die Übertragungen alter Glaubenssätze, die den nächsten Generationen als Garantie dienen sollten, um altes Leid nicht noch einmal erfahren zu müssen, aber auch der Wunsch nach Entschädigung und nachträglicher Versorgung blockieren die gesunde Entwicklung unseres Kindes. Wie wir das tun und was du als wichtige Bezugsperson deines Kindes unternehmen kannst, um transgenerationale Weitergabe weitestmöglich aufzulösen, ist die Kernbotschaft dieses Buches.
Wir dürfen aber nicht nur das traumatische Erbe sehen und dabei vergessen, dass wir auch Fähigkeiten, Talente und hilfreiche Überlebensstrategien mitbekommen haben. Meine größte Erkenntnis aus dreißig Jahren praktischer Arbeit ist die Entdeckung, dass wir alle gemeinsam an der Heilung alter Wunden arbeiten. Nicht immer ist das gleich zu erkennen, weil die vielen übernommenen, dysfunktionalen Überlebensmuster die gesunde Kindesentwicklung und das Familiensystem empfindlich zu stören scheinen. Vorfahren, Eltern und Kinder streben gemeinsam für die Zukunft eine Entwicklung an, die in der Vergangenheit nicht stattfinden konnte: Fehlte ein sicheres Zuhause, wird dafür gesorgt, dass unsere Kinder eines bekommen; fehlte der Vater, versucht die nächste Generation, einen Vater zu bieten, der da ist; wurde man als Kind nicht gesehen, versucht man, seinem Kind mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zu begegnen usw. Ich stellte mir die Frage, wie wir einerseits diese notwendige Weiterentwicklung unterstützen können, ohne dabei die alten Wunden weiterzureichen, und wie wir andererseits den Blick auf die tatsächlichen Bedürfnisse unseres Kindes nicht verlieren. Wenn du als Mutter oder Vater verstanden hast, welche transgenerationale Wunde du aus deiner Kindheit mitgebracht hast und wie dein als Kind geschlossener Treuevertrag mit den Eltern und Vorfahren den Umgang mit deinem Kind beeinflusst, kannst du besser nachvollziehen, wann alte Verstrickungen den Blick auf dein Kind versperren. Im Mittelpunkt steht deshalb die Auflösung dieser Treueverträge, durch die alle Generationen miteinander verwoben sind: zu erkennen, was zu einem selbst gehört und was sich durch Treue und Wiedergutmachungswünsche entwickelt hat und im Dienst der Ahnenrettung steht. Zu differenzieren, was genau dein Selbsterleben prägt, ist die Grundvoraussetzung für einen authentischen Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und denen deines Kindes. Dieses Buch soll dir eine Unterstützung sein, um positive Bindungserfahrungen mit deinem Kind zu ermöglichen, und dir dabei helfen, deine und seine Resilienz zu stärken. Indem du lernst, wie übernommenes Leid transformiert werden kann, wird der Blick auf dein Kind wieder frei und damit authentische Beziehungsgestaltung möglich.
Zunächst ist es aber notwendig anzuerkennen, dass kein Ratgeber, kein Podcast, keine liebevollen Ratschläge von Eltern oder Freundinnen, ja selbst ein Studium als Pädagogin oder eine Approbation als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin einen vollkommen auf diese Aufgabe vorbereiten können.
Wenn du als Mutter oder Vater dieses Buch liest, möchte ich dir etwas Wichtiges mit auf den Weg geben. Ich möchte mit diesem Buch erreichen, dass du dich im Umgang mit dir selbst und mit deinen Kindern befreit fühlst, entlastet von Schuldgefühlen und zu hohen Ansprüchen. Ich möchte aber auch, dass du einen Leitfaden in der Hand hältst, mit dem es dir gelingen kann, Stück für Stück die Schatten der Vergangenheit, die über der Beziehung zu deinen Kindern liegt, aufzulösen. Dieses Buch soll kein weiterer Ratgeber sein, der versucht, dir zu sagen, was richtig und was falsch ist, sondern eine Hilfestellung, die vom Anklagen zum Verstehen führt. Es soll dir dabei helfen, neue Perspektiven einzunehmen und die transgenerational geprägten Erziehungsmechanismen zu erkennen, um sie deinen Werten entsprechend zu verändern. Ich wünsche mir für dich, dass es dir gelingt, dich selbst besser zu verstehen und einen freien Blick auf deine Kinder zu bekommen. Familie ist etwas Kostbares, und wie schön wäre es, dieses Geschenk des Lebens jeden Tag aufs Neue leben zu können.
Wenn du als Fachkraft (im erzieherischen, psychotherapeutischen oder ärztlichen Bereich oder in der Sozialarbeit) dieses Buch liest, wünsche ich dir tiefe Erkenntnisse für die wertvolle Arbeit, die du jeden Tag auf deinem Gebiet leistest. Dir darf dieses Buch dabei helfen, den transgenerationalen Blick in dein bisheriges Wirken zu integrieren, um damit neue Perspektiven einnehmen zu können und bisher stagnierende Entwicklungen in Bewegung zu bringen. Mit wertvollen Impulsen, praktischen Übungen und meiner Erfahrung aus dreißig Jahren transgenerationaler Psychotherapie möchte ich dich dazu ermutigen, aus einem neuen Blickwinkel auf Familie und kindliche Entwicklung zu schauen, und dich befähigen, Kinder und Eltern besser dabei unterstützen zu können, authentische Beziehungen zu leben. Ein besonderes Anliegen meines Buches ist es zudem, dich auch selbst dazu zu inspirieren, einen Blick auf dein eigenes Gewordensein zu werfen, um die Fallstricke zu erkennen, die sich oft auf deinen professionellen Umgang mit Kindern und Eltern auswirken. Wir haben alle einen Treuevertrag mit unseren Eltern geschlossen und übertragen ihn als Erwachsene auf Menschen in unserem Umfeld. Unsere kindliche Mission, die Welt zu retten, stammt aus der Zeit, in der unsere Eltern die Welt für uns waren, und so halten wir an diesem Rettungsauftrag fest und versuchen auch beruflich, die transgenerationale Heilung unserer eigenen Ahnenlinien zu erreichen. Das führt zu Verwechslungen und Verstrickungen, die unserem Wunsch, eine professionelle Unterstützung zu sein, entgegenwirken. Ein Blick in die eigene transgenerationale Biografie ermöglicht es dir, diese Fallstricke schneller zu erkennen und deinen Blick wieder freizubekommen für die Menschen, die Hilfe suchend zu dir kommen.
Wenn du dieses Buch als Großelternteil, Lebenspartnerin oder als Freund der Familie liest, wünsche ich dir ebenfalls tiefe Erkenntnisse über dich selbst und den Umgang mit Kindern. Du hast wahrscheinlich eine ganz eigene Beziehung zu deinen Enkeln oder Stiefkindern. Vielleicht bist du bereits seit Jahren eine enge Bezugsperson oder willst die Beziehung zu den Kindern jetzt vertiefen. Es kann aber auch sein, dass du dieses Buch einfach so aus Interesse in die Hand genommen hast. Ich wünsche dir, dass deine Neugier dir einige wertvolle Möglichkeiten aufzeigen wird, die dein Leben bereichern können. Großeltern sind zudem Teil des Ahnensystems und können mithilfe der verschiedenen Beispiele in diesem Buch besser verstehen, welchen Einfluss sie selbst als Mutter oder Vater auf die Eltern ihres Enkelkindes hatten. Sie können nachvollziehen, wie ihre eigene Geschichte sich in den nächsten Generationen wiederholt und welche Folgen sich auf individuelle Weise weitervererbt haben. Dies soll dir helfen, mehr Verständnis für deine Kinder und Enkelkinder zu entwickeln und zudem deine eigene Geschichte besser zu verstehen.
Mit diesem Buch möchte ich allen, die sich im Labyrinth der transgenerationalen Verstrickungen verirrt haben, ein Licht an die Hand geben. Damit sie erkennen, wovon sie sich befreien müssen, um am Ende sich selbst und ihren Kindern neu begegnen zu können.
Ich wünsche dir beim Lesen dieses Buches all die Aha-Erlebnisse, die du dafür brauchst; bedenke dabei: Jede kleine Erkenntnis ist wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, der einen Hurrikan entfachen kann und damit transgenerationale Heilung in Gang setzen wird. Statt Leid darf sich das Glück in unseren Genen verankern und sich als freudvolle Erfahrung an unsere Kinder und Enkelkinder weitervererben.
Die Grundlagen: Traumata, die Generationengrenzen überwinden
Ich möchte dir zu Beginn eine kleine Einführung in das Thema transgenerationales Trauma, Generation-Code® und die unterschiedlichen Erklärungsmodelle für das Phänomen der Schicksalsvererbung geben.
Eine Wunde wird vererbt
Ein Trauma ist eine seelische Wunde, die durch ein einmaliges oder wiederholtes Ereignis entstanden ist, das so schmerzhaft und überwältigend war, dass es ein Gefühl größter Verzweiflung hervorgerufen hat. Nicht selten hat die traumatisierte Person Todesängste ausgestanden. Um weiterleben zu können, muss das Erlebte verdrängt oder sogar abgespalten werden. Dabei wird der Kontakt zum eigenen Körpererleben unterbrochen, und wenn der oder die Betroffene bei der Bearbeitung und Integration des Traumas nicht unterstützt wird, entstehen Folgesymptome und Überlebensmuster, die zum Ziel haben, alles, was mit dem traumatischen Erleben verbunden war, zu meiden.
Wir wissen heute, dass die Weitergabe der eigenen Verletzungen unbewusst stattfindet und sich vor allem darin zeigt, dass Eltern ihren Aufgaben als Bindungsperson nicht ausreichend gerecht werden und auf die Bedürfnisse ihrer Kinder nur unzureichend eingehen können.
Unter einem transgenerationalen Trauma versteht man die Weitergabe überwältigender, äußerst schmerzhafter und nicht verarbeiteter Erfahrungen unserer Vorfahren, die als übernommene Symptome, vererbte Emotionen und tradierte Familienmuster in den folgenden Generationen auftauchen. Manchmal scheint es, als wäre eine Generation übersprungen und das Trauma in einer sogenannten »Seelenkapsel« isoliert weitergegeben worden: Erst zwei oder drei Generationen später öffnet sich diese Seelenkapsel, und die Folgen des vererbten Schicksals zeigen sich.
Der Generation-Code®
Der Generation-Code® ist ein von Ingrid Alexander und mir entwickeltes neurobiologisch fundiertes, transgeneratives, also die Geschichte der Vorfahren einbeziehendes Konzept zur Auflösung des überlieferten, archaischen Grundkonflikts, der sich in der Beziehung zwischen Kind und Mutter bzw. Vater zeigt.
Mit der Generation-Code®-Methode lässt sich der Fokus direkt auf das zugrundeliegende Lebensthema eines Menschen und die damit in Verbindung stehende Familienwunde setzen. Wie bei einem Zahlenschloss, das sich erst öffnet, wenn alle Zahlen eingestellt sind, ermöglicht uns dieses Vorgehen, den eigenen Treuevertrag mit Mutter und Vater zu entschlüsseln und alte Verstrickungen aufzulösen. Der Treuevertrag des Kindes, so fanden meine Kollegin Ingrid Alexander und ich heraus, ist der kindliche Lösungsversuch des Archaischen Grundkonflikts. Dieser entsteht aus der Unvereinbarkeit des Überlebenstriebs und dem Drang nach Individualität und Entfaltung. Weil Eltern diesen Prozess der Autonomieentwicklung ihres Kindes aufgrund eigener Defizite nicht ausreichend unterstützen können und zudem transgenerationale Themen auf ihre Kinder übertragen, versucht das Kind mit seinem Verhalten, die Eltern emotional reifen und transgenerationale Heilung möglich werden zu lassen. Die Generation-Code®-Methode ermöglicht deshalb das ressourcenorientierte Erleben einer imaginär erlebten Ahnenversorgung, die vererbte Traumaspuren in unserem Nervensystem regulieren und befrieden kann und oft zum allerersten Mal die Möglichkeit einer eigenen (Nach-)Versorgung realistisch erscheinen lässt: Indem wir uns vorstellen, dass unsere Vorfahren die idealen Lebensbedingungen hatten, die sie eigentlich gebraucht hätten, können wir deren bisher verschüttete oder verkümmerte Potenziale sehen. So gelingt eine neue, alternative Erfahrung, die sich in unseren Gedächtnissystemen verankern kann und rückwirkend tiefgreifende Heilung und eine gesunde Ablösung von Eltern und Ahnen möglich macht.
Wie werden Traumata über Generationen weitergegeben?
Für die transgenerationale Weitergabe gibt es vier Modelle, die ich hier kurz vorstellen möchte.
Das psychodynamische Modell beschreibt, dass Eltern ihre nicht bearbeiteten Emotionen, die mit dem erlebten Trauma verbunden sind – wie zum Beispiel Angst und Ohnmacht –, auf ihre Kinder übertragen und von diesen verinnerlicht werden. Dieser Vorgang wird projektive Identifizierung genannt. Das Kind nimmt diese Anteile der Eltern (Bindungspersonen) in sich auf. Man nennt diese abgespaltenen Elternanteile auch »Introjekte«. Das Kind erlebt diese als zu sich gehörend und lernt nicht zu unterscheiden: wer bin ich und wo fängt der andere an. Personale Grenzen fehlen, und eine gesunde Autonomieentwicklung ist nur schwer oder gar nicht möglich.Das familiensystemische Modell betrachtet die Familie als ein System. Alle Mitglieder reagieren in Wechselwirkung miteinander und übernehmen eine Rolle in dieser Gemeinschaft. Die Folgen eines nicht verarbeiteten Traumas wirken sich auf alle aus und zerstören die Grenzen zwischen den Generationen und einzelnen Mitgliedern der Familie. Das haben insbesondere Untersuchungen bei extremen Traumatisierungen gezeigt, wie etwa bei Holocaust-Überlebenden und Überlebenden aus Kriegsgebieten mit Gewalt- und Foltererfahrungen. Eltern entwickeln hier eine pathologische, also ungesunde Abhängigkeit von ihren Kindern, weil sie diese für sich und ihre eigene Stabilisierung brauchen. Kinder versuchen, die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen und für Entschädigung (meist der vorangegangenen) Generationen zu sorgen. Es entsteht ein Prozess des Gebens und Nehmens, der von Loyalität und Abhängigkeit geprägt ist.Das soziokulturelle Modell kommt dir vielleicht am vertrautesten vor, denn es vertritt den Ansatz, dass die Weitergabe von sozialen Normen und Glaubenssätzen von einer an die nächste Generation durch elterliches Erziehungsverhalten und durch Lernen am Modell geschieht. Den meisten Eltern ist es nicht bewusst, dass ihre eigenen Kindheitserfahrungen einen so großen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung mit ihren Kindern haben. Wir greifen in der Begleitung unserer Kinder jedoch oft auf die Art und Weise zurück, in der unsere Eltern oder Bindungspersonen auf unsere kindlichen Bedürfnisse eingegangen sind. Spannend ist auch, dass wir selbst dann, wenn wir es unbedingt anders machen wollen als unsere Eltern und uns von ihrem Verhalten abgrenzen, trotzdem oft wiederholen, was wir eigentlich vermeiden wollten.Das biologisch-epigenetische Modell ist ein sehr aktuelles Erklärungsmodell und berichtet von bahnbrechenden Ergebnissen in der Forschung mit Tieren, die sich zwar noch nicht umfassend auf den Menschen übertragen lassen, aber in Bezug darauf, dass ein Trauma über epigenetische Mechanismen vererbt wird, sind sich inzwischen viele Wissenschaftlerinnen einig.Epigenetische Faktoren
Eine relativ neue Forschungsrichtung befasst sich damit, wie Merkmale mit Genfunktionen vererbt bzw. genetisch festgelegte Eigenschaften an- und abgeschaltet werden. Die bekanntesten und bisher am meisten erforschten drei epigenetischen Mechanismen sind folgende:
Die DNA-Methylierung: Die Methylierung der DNA ist eine Markierung, die für das An- oder Abschalten bestimmter Gene sorgt. Methylgruppen, kleine chemische Anhängsel an der DNA, steuern die Aktivität auf den Genen und können verhindern, dass diese abgelesen werden. Extreme Erfahrung wie etwa ein erlebtes Trauma verändert die Epigenetik eines Menschen und wird dann als epigenetische Markierung an die Nachkommen weitergegeben. Die Methylgruppen können auch wieder entfernt werden, etwa durch das Enzym Demethylase. Man geht davon aus, dass viele epigenetische Marker im Erbgut gelöscht werden, bevor es weitergegeben wird – aber nicht alle. Welche und warum, ist allerdings noch nicht ausreichend erforscht.Histonmodifikation: Jede Körperzelle enthält in ihrem Zellkern 23 Chromosomenpaare. Jedes Chromosom besteht aus DNA, dem Träger der genetischen Information. Diese sind um Proteine (Histone) gewickelt und werden zusammen mit der Histonspule Nukleosom genannt. Alle Nukleosome zusammen bezeichnet man als Chromatin. Die Chromatinstruktur kann locker und offen oder in einem verdichteten Zustand geschlossen sein. Durch biochemische Reste an verschiedenen Stellen der Proteine entstehen unterschiedliche Kombinationen und sorgen dafür, dass das Chromatin sich an dieser Stelle öffnet oder schließt. Hier gibt es allerdings bisher nur einige wenige Studien, und es müssen noch weitere Forschungen folgen.Nichtcodierende RNA: Während die DNA den vollständigen Bauplan für die Konstruktion und auch Funktion einer Lebensform enthält, kann die RNA unter anderem genetische Informationen übertragen und dient der Regulation von Genen.Nichtcodierende RNA hat man lange Zeit für überflüssig gehalten, doch weiß man heute, dass diese durch Umweltfaktoren, Lebensweise und traumatische Erfahrungen verändert und dann durch Eizelle und Samen weitergegeben werden. Ähnlich wie bei der DNA-Methylierung können auch die nichtcodierenden RNAs verändert sein und haben mit hoher Wahrscheinlichkeit Konsequenzen für die Aktivität eines Genoms in Bezug auf die Entwicklung von traumatischen Symptomen.
Glaubenssätze und Handlungsmuster
Wir erben jedoch nicht nur die traumatischen Erfahrungen unserer Vorfahren, sondern auch ihren Umgang damit und ihre mit diesen Erfahrungen verknüpfte Botschaft. Es werden Glaubenssätze und Überlebensmuster weitergegeben, die, ohne dass es uns bewusst wäre, auf traumatischen Erfahrungen fußen und unsere Sicht der Welt beeinflussen. Was ich über das Leben denke, ob ich anderen vertrauen kann, ob ich Gefühle zeigen darf oder Fremde als bedrohlich erlebe, liegt an den Botschaften und den vorgelebten Handlungsweisen, die uns von unseren Eltern und Ahnen mitgegeben werden. Überlebensmuster sind Fähigkeiten, die Betroffene entwickeln, um mit dem erlebten Trauma und seinen Folgen umgehen zu können. So entwickelt man beispielsweise Strategien, den Schmerz oder andere belastende Emotionen wie Trauer oder Angst nicht mehr spüren zu müssen.
Der deutsche Psychiater und Bindungsexperte Karl-Heinz Brich bezeichnet die aus einem Trauma entstandenen psychischen Widerstandskräfte auch als sekundäre Traumaresilienz: innere Wachstumsprozesse, die dafür zu sorgen scheinen, dass eine Person ein erlebtes Trauma auch ohne größeren Schaden überstehen kann. Es konnte sogar nachgewiesen werden, dass diese Überlebensresilienz ebenso an nächste Generationen weitergegeben wird wie die traumatische Erfahrung selbst.
Dieses Phänomen werde ich in diesem Buch genauer beleuchten und aufzeigen, wie du es für die Auflösung transgenerationaler Treueverträge nutzen kannst. Ich möchte dir aber auch aufzeigen, wie es zu einer möglichen Verwechslung dieser positiven Absicht in der Weitergabe von Traumaresilienz kommen kann, da unsere Kinder ja ebenfalls mit einem Heilungsimpuls reagieren und die Defizite und Verlusterfahrungen hinter den elterlichen Bemühungen erahnen. Sie stellen sich für das Gelingen der positiven Absicht der Eltern und Vorfahrinnen zur Verfügung und »heilen« auf diese Weise zeitlich rückwirkend in die Ahnenreihen.
Der hilfreiche Ansatz des Generation-Code® beinhaltet eine ressourcenstärkende Herangehensweise, die es möglich macht, die transgenerationale Weitergabe von Defiziten und destruktiven Verhaltensmustern in transgenerationale Resilienz zu verwandeln. Dabei muss genau unterschieden werden, wem ursprünglich die positiv anmutenden Wünsche und Mahnungen unserer Vorfahren an ihre Kinder und Enkelinnen gelten. So soll beispielsweise der als Kind vernachlässigte Großvater nun im Enkel noch einmal eine glückliche Kindheit erhalten, um Heilung und Reifung zu erlangen. Mit einer solchen resilienten Erfahrung hätte er seiner Tochter – der Mutter des Enkels – ein besserer Vater sein können. Doch der betroffene Enkel hat bereits Eltern, die ihn nicht vernachlässigten, und erlebt eine gänzlich andere Realität als sein Großvater damals. Der hier wirkende Treuevertrag zwischen den Generationen ist der Versuch einer transgenerationalen Heilung, bei der die Symptome des Großvaters im Enkelsohn »behandelt« werden. Es sind aber nicht seine eigenen, selbst wenn er Symptome zeigt, die eigentlich zum Erleben des Großvaters gehören. Diese Verwechslung führt dazu, dass sich alte Überlebensmuster und Schutzstrategien ebenfalls auf den Umgang mit dem Enkel übertragen und damit Realität und Bedürfnisbeantwortung verzerren.
Wie dir dieses Buch hilft
Du merkst: Dieses Thema ist umfangreich und komplex, deshalb möchte ich dir ein paar Anregungen geben, wie du am besten mit diesem Buch umgehst. Mir ist klar, dass kaum jemand noch die Zeit findet, sich ausgiebig in ein Buch zu vertiefen – doch genau dazu möchte ich dich motivieren. Das Thema der transgenerationalen Weitergabe mit seinen weitreichenden Folgen für dein Leben und das deiner Kinder macht es so wichtig, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Nur so kannst du den Schleier lüften, der auf den immer wiederkehrenden Mustern deines Lebens liegt und auch die Entwicklung deines Kindes empfindlich stört.
Wie ein Trauma transgenerational wirkt und du die Weitergabe verhinderst
In diesem Buch findest du wichtige Informationen zu den Folgen transgenerationaler Weitergabe von Traumata und Überlebensstrategien auf unser Familienleben und unsere Bindungs- und Beziehungsfähigkeit. Anhand von Beispielen aus dem Familienalltag wird der Einfluss der vererbten Familienmuster deutlich, und die Prinzipien des Generation-Code® werden verständlich. Damit du die Entwicklung deines Kindes besser nachvollziehen kannst, findest du zudem Informationen zur Gehirnentwicklung, zu den kindlichen Wachstumsphasen und den Heilungswegen des Kindes für das Familiensystem.
Wertvolle Übungen ermöglichen wichtige Schritte, sich mit den eigenen Wunden auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie du verhindern kannst, diese unreflektiert weiterzugeben. Es wird auch deutlich, was man braucht, um die Verstrickungen im Hier und Jetzt zu lösen, damit Liebe wieder fließen kann und ein erfülltes Leben für uns und unsere Kinder möglich wird. Dabei werden nicht nur die Beziehung zum Kind, sondern auch die Paarbeziehung und die Ebene der Geschwisterschaft berücksichtigt. Spiele und Rituale zur Unterstützung von Kommunikation, zum Umgang mit Emotionen und zur Stärkung von Resilienz sollen dir eine kreative und lösungsorientierte Herangehensweise aufzeigen. So kannst du zum Cycle-Breaker werden und deinen Kindern neue Zukunftsvisionen bieten.
Du erfährst in diesem Buch auch, wie das Konzept Generation-Code® in der Praxis angewendet wird, und kannst erkennen, wie das Kind als Spiegel dieser transgenerationalen Prozesse dem gesamten Familiensystem dient. Zudem erhältst du wichtige Werkzeuge zur Verbesserung der Interaktion mit deinem Kind und zur Sicherstellung des Glückserbes.
Ein weiteres zentrales Thema sind die Herausforderungen und Chancen in der Welt von heute mit ihren Krisen wie Kriege, Klimawandel und Migration. Hier wird die Brücke aus der Vergangenheit in die Gegenwart geschlagen und vermittelt, wie das Wissen über transgenerationale Prozesse uns helfen kann, bereits in der aktuellen Krise für die Unterstützung zu sorgen, die es braucht, damit Traumata und Leid nicht ungehindert weitergegeben werden.
Familie ist bunt, und dieser Tatsache möchte ich hier ebenfalls meine Aufmerksamkeit schenken. Ob Regenbogenfamilie, Adoptiv- oder Patchwork-Familie – transgenerationale Themen finden wir überall. Doch hier stellen sich besondere Fragen, und die brauchen Antworten, die ebenso bunt wie die Familien selbst sind.
Die Spiele-Apotheke®
Am Ende des Buches wirst du in das Konzept der Spiele-Apotheke® eingeführt und erhältst einen Überblick über alle Spiele, die in diesem Buch vorgestellt werden. Aufgelistet nach Alter deines Kindes und einigen bestimmten entwicklungsbedingten Herausforderungen zugeordnet, findest du auch den Hinweis, wo dieses Tool im Buch beschrieben wird.
Kapitel 1: Wie die Vergangenheit unser aktuelles Familienleben prägt
»Meine Kinder triggern mich«, sagt Ines und hofft auf einen guten Rat von mir als Familientherapeutin. Leon und Jonas sind zwei ganz normale Brüder, die gemeinsam mit ihren Eltern in einem Einfamilienhaus am Stadtrand leben. Beide Eltern gehen ihren Berufen nach und teilen sich die Erziehung ihrer geliebten Söhne. Mutter Ines berichtet davon, wie sehr sie sich getriggert fühlt, wenn die beiden Söhne, neun und zwölf Jahre alt, sich streiten. »Vielleicht bin ich harmoniesüchtig oder einfach nicht ausgeglichen genug, aber wenn die beiden richtig loslegen, sich sogar körperlich angehen, flippe ich einfach aus«, erzählt die zierliche Frau. Dabei sei ihr bewusst, wie wichtig es für die Kinder ist, alle Gefühle ausdrücken zu dürfen, und dass Jungs im Allgemeinen wenig zimperlich miteinander umgehen in diesem Alter.
Schnell wird deutlich, wie überfordert sich Ines in solchen Situationen fühlt. Sie spürt sehr genau, dass bei diesem Thema noch etwas anderes in ihr angerührt wird, dass Emotionen freigesetzt werden, die unbewusst wirken und eine große Ohnmacht auslösen. Was dann in ihr hochkommt und sie meist nicht zurückhalten kann, ist eine große, fast unbändige Wut, die sich mit Worten lautstark ihren Weg bahnt. Am Ende des Tages fühlt sich Ines wie eine Versagerin, sie hat extreme Schuldgefühle gegenüber Leon und Jonas und weint sich leise in den Schlaf.
Eine Situation, die viele Eltern kennen. Vielleicht kennst auch du solche oder ähnliche Situationen und hast dich schon ausführlich mit Ratgebern, Freundinnen und anderen Eltern ausgetauscht. Es ist ein Stück weit normal, wenn Eltern der Geduldsfaden reißt und sie sich nicht immer perfekt selbst regulieren können. Alles andere wäre unrealistisch. Doch sehr oft steckt noch mehr dahinter.
Der transgenerationale Blick eröffnet eine neue Perspektive
Lass uns einmal aus einer anderen Perspektive auf das Geschehen schauen. Was passiert hier genau? Ein Blick durch die transgenerationale Brille zeigt uns etwas Interessantes. Ines hat eine Schwester, der Altersunterschied beträgt nur etwas mehr als ein Jahr, und als Kind hat sich Ines von der Mutter zurückgesetzt gefühlt, hat das Gefühl gehabt, die Schwester sei der Mutter immer lieber gewesen. Sie erinnert sich daran, dass die Mutter sie als Vaterkind betitelte – vom Vater hatte sich die Mutter früh getrennt und keinen Kontakt mehr zugelassen. Schmerzhaft taucht eine Szene vor Ines’ Augen auf, in der die Schwester mit der Mutter kuschelt, sie selbst aber abgewiesen wird. So sei es oft gewesen, sagt Ines, und Tränen steigen ihr in die Augen. Die Schwester habe diesen Vorteil immer ausgenutzt, Ines, die Ältere von beiden, oft bei der Mutter angeschwärzt. Diese Ungerechtigkeit und der tiefe Schmerz, nicht geliebt zu sein, haben sich tief in Ines’ Seele gebrannt und ihr Selbstwertgefühl beeinflusst. Bis heute fühle sie sich weniger liebenswert als die Schwester. Die Beziehung zur Schwester blieb von dieser Tatsache geprägt und ist bis heute von Neid und Konkurrenz gezeichnet.
Als Mutter wollte sie dies unbedingt besser machen. Sie bemüht sich sehr um Gleichberechtigung zwischen ihren Söhnen. Keiner soll dem anderen nachstehen, sich weniger angenommen und geliebt fühlen. Das geht so weit, erzählt Ines, dass sie beim Wäschezusammenlegen darauf achten würde, dass die Wäschestapel beider Söhne immer gleich hoch sind. Sie lacht verlegen und kann in diesem Augenblick die große Verbindung zu ihrer eigenen Geschichte spüren. Es macht Ines wütend, wenn ihre Bemühungen, eine gerechte Mutter zu sein, offensichtlich nicht gefruchtet haben und die Kinder eifersüchtig miteinander streiten. Hier ist es der Jüngere, der sich zurückgesetzt und oft nicht gesehen fühlt.
Was noch weiter zurückliegt
Dass uns unsere eigene Biografie prägt und unsere Einstellung zur Erziehung beeinflusst, weiß heute eigentlich jeder. Diese Erklärung könnte auch schon genügen, um mehr Verständnis für sich und das eigene Verhalten zu haben. Nach meiner Erfahrung wird es jedoch nicht ausreichen, um eine nachhaltige Veränderung des eigenen Verhaltens gegenüber den Kindern zu erreichen. Deshalb schaue ich noch weiter zurück in die Ahnenreihe.
Was könnte die Mutter von Ines beeinflusst haben, weshalb zieht sie die jüngere Tochter vor?
Ines’ Mutter Angelika wächst bei liebevollen, aber schwer traumatisierten Eltern auf. Sie hat zwei Brüder, fühlt sich aber weniger wichtig als die beiden. Angelikas Mutter wiederum war Vollwaise, sie verlor den Vater mit sechs Jahren, die Mutter mit zwölf. Neben einem sechs Jahre jüngeren Bruder hatte Angelika eine ältere Schwester, die beim Tod der Mutter vierzehn Jahre jung war und zusammen mit einem Onkel die Versorgung der beiden jüngeren Geschwister übernahm. Der Onkel kam damals traumatisiert aus dem Krieg zurück und sah sich von heute auf morgen für die drei Kinder der an Multipler Sklerose verstorbenen Schwester verantwortlich. Der offensichtlich mit dieser Aufgabe überforderte Mann schlug die Kinder, vergewaltigte den Jungen, und als er seine Verlobte kennenlernte, gab er die Kinder schließlich in ein Heim. Letzteres blieb Angelikas Mutter erspart, weil sie inzwischen einen Verlobten hatte, zu dem sie zog. Der jüngere Bruder aber hatte eine schwere und von weiteren sexuellen Übergriffen geprägte Heimzeit – eine Tatsache, die bei Angelikas Mutter tief sitzende Schuldgefühle auslöste.
Auch Angelikas Vater Georg hatte eine schwere Kindheit als Kriegskind. Der erste Mann seiner Mutter und Vater der Halbschwester starb im Krieg, und seine Mutter heiratete einen Mann, der selbst traumatisiert und ebenfalls gewalttätig war. Georgs Vater missbrauchte die Halbschwester über viele Jahre, und Angelika berichtet, dass auch in ihrer Kindheit der dunkle Schatten des Großvaters über allem lag. So wurde die Tür zu ihrem Zimmer stets abgeschlossen, wenn sie zu Besuch bei den Großeltern war. Obwohl Angelikas Vater nie gewalttätig oder übergriffig wurde, litt sie unter der Beziehung zu ihm, da er sich ihr gegenüber sehr distanziert verhielt. Ich vermute, er wollte seine Tochter unbewusst vor toxischer Vaterenergie schützen. Angelikas Mutter hat ihre Söhne offensichtlich vorgezogen und auch die Beziehung von Angelika zum Vater nicht gefördert. Vermutlich wollte sie in ihren Söhnen den eigenen Bruder versorgen. Angelika wuchs mit der Vorstellung auf, dass Männer gefährlich und übergriffig sind, und wollte deshalb nach der Trennung von ihrem Mann keinen Besuchskontakt zu den Kindern zulassen. Sie blieb mit den Töchtern allein und zog in die Nähe ihrer Eltern.
Vererbte Schuldgefühle
Vermutlich tragen beide Eltern tief sitzende Schuldgefühle gegenüber ihren Geschwistern in sich und haben diese unbewusst auf Angelika übertragen. Die Bevorzugung der Brüder kann ihren Ursprung in den wahrscheinlich unbewusst wirkenden Wiedergutmachungswünschen der Mutter haben. Aus diesem Grund bekommt Angelika weniger Liebe und Aufmerksamkeit von ihr. Die distanzierte Haltung des Vaters, die wahrscheinlich als Präventionsstrategie Tochter Angelika vor Übergriffen schützen soll, verstärkt bei ihr das Empfinden, nicht richtig zu sein. Angelika hat das Gefühl, Opfer zu sein, und entwickelt narzisstische Züge, wie sie für ein ungeliebtes Kind typisch sind.
Angelikas Enttäuschung über die gescheiterte Ehe und ihre schmerzbehafteten Emotionen aus der Kindheit werden auf Tochter Ines übertragen. Diese sieht ihrem Vater ähnlich, wodurch Angelika unbewusst der Tochter eine Mitschuld an ihrer Lebenssituation gibt. Sie »bestraft« Ines mit Liebesentzug und nährt sich an der jüngeren Tochter, die sie auf ungesunde Weise an sich bindet.
Ines spürt nicht nur die Ungerechtigkeit, sondern auch die dahinter liegende Wunde der Mutter und ebenso die der Großeltern, bei denen sie aufwächst. In ihrer eigenen kleinen Familie will sie nun alles besser machen und unbewusst die AhnInnen und auch sich selbst versorgen. Sie muss eine gute Mutter sein, die nicht zulässt, dass Geschwistern ein solches Leid widerfährt, um die Familienwunde heilen zu können. Vor allem aber braucht es Eltern, die ihre Kinder nicht allein lassen, nicht sterben und nicht gewalttätig werden. Und es braucht Geschwister, die einander treu ergeben und fürsorglich sind, die vor allem nicht missgünstig sind und einander nichts neiden.
Das Vergangene wirkt noch heute
Hättest du gedacht, dass all diese Fakten unsere Reaktion auf eine harmlose Streitsituation beeinflussen? Genau deshalb fällt es so schwer, die eigenen Emotionen von der realen Situation zu trennen und entspannt zu reagieren. Noch einmal zusammengefasst: Es wird offensichtlich, welche »vererbten« Emotionen bei Ines, aber auch bei ihren Söhnen getriggert werden und welches unbewusste Rettungsprogramm hier abläuft:
Wenn Ines von der Arbeit nach Hause kommt, freut sie sich auf einen entspannten Nachmittag mit ihrer kleinen Familie. Die Söhne indes sind in einen heftigen Streit verwickelt und werden dabei auch »gewalttätig«. Ines versucht, die hitzigen Gemüter zu beruhigen, doch sie dringt nicht zu ihnen durch. Zunächst versucht sie, die beiden Streithähne zu trennen, doch als ihr das nicht gelingt, überkommt sie ein Gefühl von Ohnmacht. Die Aggression, die von beiden Söhnen ausgeht, berührt unbewusst ihre eigene Wut als Kind auf ihre bevorzugte Schwester, die sie aber damals nicht ausdrücken konnte, weil sie befürchtete, dadurch auch den Rest mütterlicher Liebe zu verlieren. Zudem wird ihre Angst vor gewalttätigen Männern, die sie aus ihrer Kindheit mitbekommen hat, getriggert. Die Tatsache, die Kinder nicht beruhigen zu können, macht sie außerdem hilflos und gibt ihr das Gefühl, als Mutter versagt zu haben. Als die Wut dann aus ihr herausbricht, kommen Gefühle von Selbstabwertung und Scham dazu, sie bricht innerlich zusammen. Die in dieser Situation ausgelösten »vererbten« Emotionen haben sie in eine Zeit zurückkatapultiert, die lange zurückliegt und die sie sogar zum Teil selbst gar nicht erlebt hat. Es werden ausgelöst:
Versagensgefühle als Mutter, die es nicht geschafft hat, dass Geschwister sich gleichberechtigt behandelt fühlen.Ohnmachtsgefühle; nichts machen zu können und einer Situation ausgeliefert zu sein.Der eigene Schmerz als enttäuschtes Kind, abgelehnt von der Mutter, die die Schwester vorzieht.Die kindliche Angst vor Aggression, die in dieser Familie als traumatische Erfahrung gespeichert wurde und die um jeden Preis verhindert werden muss.Schuld- und Schamgefühle darüber, selbst eine »gewalttätige« Mutter zu sein, die ihre Kinder anbrüllt.Schuldgefühle bei den Söhnen, die mit ihrem Streit die Mutter in eine Hilflosigkeit gebracht haben.Dieser Cocktail von Gefühlen überschwemmt Ines’ Nervensystem, und es gelingt ihr nicht, sich rechtzeitig zu regulieren. So schafft sie es auch nicht, ihre Kinder da abzuholen, wo eine bedürfnisgerechte Reaktion für deren Regulierung von Vorteil wäre. Warum das so ist, erfährst du weiter unten, doch zunächst zu der Frage, wie man in solchen Situationen reagieren kann.
Deeskalation und Beruhigung des Nervensystems
Wie könnte eine gesunde Eltern-Kind-Interaktion in einer solchen Situation beispielhaft aussehen? Unabhängig vom individuellen Erziehungsstil und den Werteeinstellungen der Eltern wäre es sinnvoll, gelassen und nicht parteiisch zu reagieren, sich emotional nicht hineinziehen zu lassen und beide Kinder im Blick zu haben. Eine gelassene Mutter strahlt etwas Beruhigendes aus und kann dafür sorgen, dass sich die Kinder ebenfalls regulieren können.
Da zwischen Leon und Jonas eine heftigere körperliche Auseinandersetzung stattgefunden hat, würde ich den Eltern empfehlen, zunächst zu deeskalieren und die beiden Jungs voneinander zu trennen. Man kann ihnen getrennt voneinander unterstützend beistehen, damit sich ihr Nervensystem beruhigen kann. Zuvor muss jedoch auch die einschreitende Person, also Ines, sich selbst regulieren. Jetzt ist nicht die Zeit zu analysieren und alte Familienmuster zu hinterfragen. Dafür muss Ines sich später Zeit nehmen. Jetzt wird gehandelt.
Ines könnte zunächst einmal die Situation für einige Minuten verlassen, um selbst zur Ruhe zu kommen. Allerdings muss sie sich vorher davon überzeugen, dass beide Kinder trotz des Streits in Sicherheit und keine ernsthaften Verletzungen zu erwarten sind. In einem solchen Fall sollte der Erwachsene sofort eingreifen und beide voneinander trennen. Sie könnten für einen kurzen Moment in verschiedenen Zimmern warten, während sich Ines Zeit verschafft, um für einen Moment in sich hineinzuspüren. Was erlebt sie gerade in ihrem Körper? Alles darf da sein und wird nicht bewertet. Vermutlich ist ihr Nervensystem von Stresshormonen überflutet, weshalb Bewegung eine gute Entscheidung ist. Falls es eine Treppe im Haus oder in der Wohnung gibt, kann sie diese hoch- und runterlaufen und dabei im wahrsten Sinne runterkommen. Dabei eine kleine Rechenaufgabe lösen oder bewusst den Ärger abzuschütteln, hilft ebenfalls als SOS-Maßnahme. In der Spiele-Apotheke® beschreibe ich verschiedene Tools, die sich zur Regulation einsetzen lassen (Übung 43–48), und empfehle, anschließend die dort ebenfalls beschriebenen kleinen Rituale zur Versöhnung und Kommunikation anzuwenden (Übung 38–44), damit sich der Streit auflösen lässt.
Was sind Trigger und was triggert dich?
Das Wort »triggern« ist aus dem Englischen übernommen und bedeutet »auslösen«. In der Traumabehandlung meint man damit einen Hinweisreiz, der vor einer möglichen Wiederholung eines zuvor erlebten Traumas warnen soll. Bestimmte während des traumatischen Erlebens wahrgenommene Reize erinnern unvermittelt an das schmerzlich Erfahrene und bringen die damit im Zusammenhang stehenden Emotionen hervor. Beispiele für diese Erinnerungsfetzen können Lichtverhältnisse, Kälte, Hitze, akustische Reize wie Stimmen, Musik, Geräusche, aber auch Gerüche, eine bestimmte Atmosphäre, Farben, Kleidung, Jahreszeiten, Tageszeiten, bestimmte Worte, Berührungen und vieles mehr sein. Den Begriff »triggern« nutzt man heute im Allgemeinen auch für alle möglichen von außen herangetragenen Reize, die ein unangenehmes Gefühl bzw. eine Emotion in uns auslösen. Das wird der ursprünglichen Bedeutung dieses Wortes nicht wirklich gerecht.
Wenn ich hier von Trigger spreche, meine ich transgenerational vererbte und durch eigene Erfahrungen abgespeicherte Erinnerungsfetzen und die daraus entstandenen Überlebensreaktionen, die unserem bewussten Handeln nur selten zugänglich sind. Vielleicht kennst du die Situation, dass bestimmte Gerüche sofort eine Erinnerung in dir wachrufen, die du aber zunächst als Emotion wahrnimmst und die, noch bevor du sie genau einordnen kannst, eine Körperempfindung auslöst: Unbewusst hat deine Psyche das damals Erlebte mit diesem Geruch verknüpft, und so erinnerst du dich unvermittelt an dieses Ereignis – wie ein bestimmtes Schlüsselwort, das du in eine Internet-Suchmaschine eingibst und das dir eine ganze Welt voller Informationen zur Verfügung stellt, die mit diesem Wort in Verbindung stehen. Aus der Epigenetik wissen wir, dass sich solche traumatischen Erinnerungen bei unseren Vorfahren ebenfalls in unseren Zellen abgespeichert haben und als Trigger in unserem Leben ausgelöst werden können.
Warum und wie Trigger funktionieren, warum sie uns so stressen und wir ihnen – zumindest im ersten Augenblick – so ausgeliefert sind, hängt mit unserem Nervensystem zusammen. Mehr dazu erfährst du unter »Wie funktioniert unser Nervensystem«.
Was sind eigentlich Glimmer?
Das Gegenteil von Trigger sind Glimmer, also positive Erinnerungsauslöser, die dich direkt mit einer angenehmen Emotion in einer vergangenen Zeit verbinden. Beides wird vor allem dann verstärkt in deinem Alltag auftauchen, wenn du Kinder bekommst, weil diese Tatsache für sich gesehen bereits ein Erinnerungsauslöser für positive wie negative Emotionen ist. Deine eigenen Kindheitserfahrungen werden wachgerufen, weil wir in dieser neuen Lebenssituation nach Vorbildern und Orientierung suchen. Mit folgender Übung kannst du dir einen Eindruck darüber verschaffen, welche Glimmer und Trigger bei dir im Alltag ausgelöst werden könnten. Glimmer kannst du außerdem »sammeln«, um sie als Ressource in schwierigen Zeiten zu nutzen.
Dein Notfallkoffer
Bevor wir mit der ersten Übung beginnen, brauchst du einen »Notfallkoffer«, damit du deinen Stressreizen, die eventuell getriggert werden, nicht schutzlos ausgeliefert bist.
Wenn du spürst, dass du zu sehr in das getriggerte Gefühl einsteigst, sag laut STOPP!Wende die Schmetterlings-Umarmung (siehe hier) an.Sag dir selbst: Es ist nur eine Erinnerung und längst Vergangenheit.Denk an einen Glimmer (siehe hier, Übung 1) und tauche emotional so tief in die Erinnerung ein, wie du magst.Pack die damit verbundenen Erinnerungen gedanklich in einen Tresor und sorge dafür, dass er sicher verschlossen ist.Übe eine entspannende Atemtechnik ein. Über bewusstes, langsames Atmen kannst du dein vegetatives Nervensystem beruhigen.Halte eine Telefonnummer bereit, unter der du eine Person erreichst, der du vertraust und mit der du über deine Probleme reden kannst.Du kannst auch die Übungen machen, die hier unter »Spiele zur Beruhigung des Nervensystems« aufgeführt sind. Sie wirken bei Erwachsenen und bei Kindern.
Übung 1: Deine Trigger und Glimmer
Art der Übung: Selbstreflexion
Ziel der Übung: Reflexion unbewusster Erinnerungsreize
Dauer: ca. 30 Minuten
Material: Blatt Papier, Stift
Triggerpotenzial: ***
Vorbereitung
Nimm dir für diese Übung ausreichend Zeit und sorge dafür, ungestört zu sein und einen Raum für dich zu haben.
Durchführung
Nimm für jede Liste ein separates Blatt Papier. Erstelle zunächst eine Liste mit Glimmererinnerungen. Wenn dir spontan nichts einfällt, geh die oben genannten Modalitäten durch: Gibt es beispielsweise einen Geruchsglimmer wie frisch gebackene Plätzchen zu Weihnachten oder eine auditive Erinnerung an eine bestimmte Melodie, das Rascheln deiner frisch gewaschenen Bettwäsche, der Geschmack eines bestimmten Gewürzes oder die zarte Berührung bei einer liebevollen Umarmung?
Deine Glimmersammlung kann dir helfen,
wenn du dich bewusst mit positiven Erinnerungsreizen verbinden möchtest,um aus einer Triggersituation schneller aussteigen zu können,um Gefühle von Glück und Dankbarkeit zu fördern,um positive Kindheitserinnerungen wachzurufen,wenn du dich mit eigenen Ressourcen verbinden möchtest.Schau nun auf deine »Trigger«, die dir im Alltag immer wieder begegnen. Das muss nicht nur dein familiäres Umfeld betreffen, auch im Job, mit Freunden oder bei bestimmten Aktivitäten können dich bestimmte Auslöser emotional aus der Fassung bringen.
Nutze die oben aufgeführten Modalitäten als Orientierung und gleiche sie mit typischen alltäglichen Momenten ab, in denen du dich spontan unwohl fühlst.
Bitte beachte für diese Übung: Vermeide es, traumatische Trigger zu intensivieren, und steig grundsätzlich nicht tiefer ein, damit du nicht emotional mitgerissen wirst!
Wenn dir der ein oder andere Ursprung eines Triggers bekannt ist, schreibe dies dazu. Nach dem Motto »Gefahr erkannt, Gefahr gebannt« wird es dir nützlich sein zu wissen, woher die plötzlichen Gefühle kommen und dass sie mit deiner heutigen Realität nicht mehr viel zu tun haben.
Wie sich Emotionen vererben
Ines aus unserem Beispiel oben ist, wie wir alle in solchen Momenten, unbewussten Mechanismen ausgeliefert. Doch das muss nicht so bleiben. Zunächst müssen wir aber verstehen, was genau hier geschieht und warum. Fachleute sprechen von transgenerational weitergegebenen Emotionen. Doch was ist das genau und wie werden sie weitergegeben bzw. vererbt?
Transgenerational vererbte Emotionen beziehen sich auf emotionale und psychologische Muster, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Diese Muster können sowohl positive als auch negative Emotionen und Verhaltensweisen umfassen, wie zum Beispiel Ängste, Traumata, aber auch Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, und Bewältigungsstrategien. Die Weitergabe erfolgt einerseits durch direkte Erziehung und Sozialisation, aber auch durch biologische Mechanismen.
Die Rolle der Epigenetik
Die Epigenetik beschreibt den Einfluss von Umweltfaktoren auf unsere Gene. In jeder Zelle eines Organismus findet sich die vollständige Erbinformation in Form der sogenannten DNA, also alle Gene, obwohl nur ganz bestimmte Gene gebraucht werden, um zum Beispiel eine Niere oder ein Auge zu bilden. Es werden daher nur bestimmte Gene »angeschaltet«. Diese Aktivierung von Genen wird als Expression bezeichnet. In wissenschaftlichen Studien konnte belegt werden, dass Veränderungen in der Genexpression vorkommen, die nicht durch Veränderungen der DNA-Sequenz selbst verursacht werden. Stattdessen beeinflussen epigenetische Mechanismen, wie Gene ein- oder ausgeschaltet werden, und diese Veränderungen können durch Umweltfaktoren, Lebensstil und sogar emotionale Erfahrungen ausgelöst werden. Solche Veränderungen in der Genexpression können vererbt werden.
Das bedeutet, dass die Erfahrungen und Emotionen