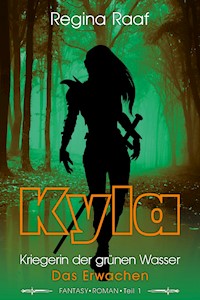7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem frostigen Wintermorgen, kurz vor der Jahrtausendwende, stand sie vor mir auf den Straßenbahnschienen. Sie lächelte mich an – dann ließ sie sich von mir überfahren. Seitdem ist nichts mehr so wie es einmal war. Meine selbst gewählte Mittelmäßigkeit ist dahin. Sie hat einem Abenteuer Platz gemacht, das eigentlich niemals hätte sein dürfen … und für das ich ihr dennoch unendlich dankbar bin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Regina Raaf
Verflochtene Leben
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Epilog
Impressum
Über die Autorin
Weitere Titel von Regina Raaf
Prolog
Wir fühlen uns immer dann bestätigt, wenn wir so sind wie alle anderen. Denn wenn wir so sind wie der Rest der meisten Menschen, sind wir normal. Normal zu sein ist gut. Es ist das einzig Erstrebenswerte. Es sei denn, wir sind besser als die anderen. Berühmter, reicher, begehrenswerter – dann ist es durchaus reizvoll, aus der Norm zu fallen.
Ich war immer nur die Norm. Nicht besser, aber auch nicht viel schlechter als die anderen. Meine schulischen Leistungen waren nicht herausragend, jedoch auch nicht unterdurchschnittlich, und so ergriff ich einen normalen Beruf. Ich wurde Straßenbahnfahrer.
Es gab nicht viel Unvorhergesehenes in meinem Arbeitsalltag. Ich fuhr Leute von A nach B. Eigentlich dachte ich nicht einmal großartig an die Menschen, die auf die Straßenbahn angewiesen waren. Für mich war es immer eher die Bahn selbst, die ich von einem Ende der Stadt zum anderen bewegte. Ich richtete mich nach den Regeln, die ich gelernt hatte. Ich hielt, wenn das Haltesignal es mir anwies. Ich fuhr an, wenn die Türen nicht blockierten und sich vollständig geschlossen hatten. Ab und zu gab es Verspätungen, einmal einen Streik, bei dem ich froh war, als der ganze Spuk vorüber war, und ich meinen Dienst wieder geregelt aufnehmen konnte.
Alles war wie immer – bis zu diesem Tag, der meine Normalität auf den Kopf stellen sollte.
Ich möchte die Geschichte nun erzählen, da ich etwas Abstand zu all dem gewonnen habe. Und ich denke, es ist wichtig, von den Ereignissen zu berichten, die ich damals selbst erlebte … und noch wichtiger, von denen, die ich im Anschluss daran erfuhr.
***
Es war an einem frostigen Wintertag im Jahre 1999. Das Millennium stand kurz bevor und man glaubte, dass die Welt vielleicht untergehen würde. Für mich tat sie das in gewisser Weise auch, allerdings etwas früher als vorhergesagt. Es lagen noch Reste des Schnees von vor zwei Tagen, aber er behinderte in keiner Weise den Fahrbetrieb. Meine Strecke führte über freies Feld und durch einige kleine Waldstücke, bis ich die nächste Station erreichen würde.
Ich sah nach vorne auf die Schienen und nahm am Rande die Bäume wahr, die an mir vorbeizufliegen schienen, dabei war ich es ja, der sich bewegte. Mein Kaugummi hatte schon seit mindestens einer Viertelstunde keinen Geschmack mehr, und ich überlegte mir, ob die Fahrgäste es wohl sehen würden, wenn ich ihn einfach aus dem Fenster spuckte. Würde sich jemand beschweren, wenn plötzlich ein ausgelutschter Kaugummi an seiner Scheibe vorbeiflog? Bestimmt nicht, also öffnete ich mit einer Hand das Fenster, während meine andere Hand am Hebel blieb, um die Geschwindigkeit ein wenig zu erhöhen.
Meinen Kopf drehte ich nach links, damit ich in hohem Bogen in den Fahrtwind spucken konnte. Eine Sekunde später befand sich der Kaugummi im Freiflug durch die winterliche Kälte. Mein Blick richtete sich wieder auf die Schienen. Und dann geschah es.
Man könnte sagen, es sei wie ein Albtraum gewesen, aber das stimmt nicht. Ich habe mich erschreckt, das gebe ich zu, aber das Grauen habe ich erst später begriffen. In dem Moment, als ich meinen Blick wieder in Fahrtrichtung wandte, sah ich eine Frau auf den Gleisen stehen. Sie sah mir geradewegs in die Augen. Ein Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Kein abwesendes, wie man es bei einem Selbstmörder wohl erwarten würde, sondern ein freundlich bittendes. So ein Ausdruck, als würde sie mich lediglich nach dem Weg fragen wollen, und doch bat ihr Lächeln mich in Wirklichkeit darum, sie zu töten.
Ich sah ihren Körper auf mich zukommen, ähnlich, wie ich es schon tausendmal bei den scheinbar fliegenden Bäumen gedacht hatte. Ich bewegte mich auf sie zu, aber mir schien es, als wäre sie es, die sich bewegte. Ihre Augen kamen näher, und ich bin mir sicher, sie waren grün.
Natürlich waren wir auf solche Situationen vorbereitet worden. Ich machte eine Notbremsung und nahm sofort das Kreischen der Fahrgäste wahr. Auch die Bremsen quietschten, aber ich wusste, dass es ohnehin zu spät sein würde. Der Körper der Frau klatschte gegen die Front, dann wurde er fortgeschleudert. Ich verlor ihn aus dem Blickfeld. Meine Hand tastete nach dem Funkknopf, und ich gab den Code durch. Man muss sich das vorstellen, es gibt einen extra Code für so einen Fall. So viele Menschen werfen sich vor eine Bahn, dass man dafür eigens einen Code erfand. Die Zentrale bestätigte. Ich wusste, man würde Krankenwagen, Polizei und Psychologen schicken. Alles würde seinen Gang gehen.
Als ich den Funk beendet hatte, schaltete ich auf Lautsprecher und forderte die Fahrgäste auf, sich ruhig zu verhalten. Ich sprach von einer Störung, die uns an der Weiterfahrt hindere. Das aufgeregte Gemurmel aus dem Waggon ignorierte ich. Dann öffnete ich meine Fahrertür und stieg die zwei Stufen hinab. Fast wäre ich ausgerutscht, denn die Erde war in dem feuchten Waldstück noch teilweise gefroren. Vorsichtig ging ich auf die linke Seite der Bahn und sah über den Grünstreifen. Dort lag niemand. Für einen Moment stutzte ich. Hatte ich nur geträumt? Doch die Blutspritzer an der Front der Bahn überzeugten mich vom Gegenteil. Ich ging ein paar Schritte, dabei konnte ich förmlich spüren, wie die Fahrgäste mich durch die Scheiben mit ihren Blicken verfolgten.
Dann entdeckte ich sie. Sie war unter die Räder geraten. Normalerweise wäre ich davon ausgegangen, dass sie durch die Wucht in hohem Bogen davon geschleudert sein musste, aber das war sie nicht. Ihr Kopf war vom Rumpf getrennt worden. Ein wenig erinnerte sie an eine Schaufensterpuppe, so unwirklich erschien mir der Anblick. Andererseits jedoch auch wieder überaus real. Denn in diesen paar Sekunden, als sie auf den Schienen gestanden hatte, war eine persönliche Beziehung zwischen uns entstanden.
Ich kann nicht behaupten, ihr Kopf sei in einem tadellosen Zustand gewesen, aber ihre Augen schienen mich immer noch entschlossen anzusehen. Und groteskerweise lag nach wie vor dieses Lächeln auf ihrem Gesicht, das den Eindruck einer Puppe verstärkte. Dass sie jedoch keine Puppe war, konnte ich an dem Blut ausmachen, das aus der riesigen Wunde floss. Das war der Moment, in dem ich das Bewusstsein verlor.
Ich weiß, es gibt eine Regel, die da lautet: Der Kapitän verlässt das sinkende Schiff zuletzt. Ich muss zugeben, dass es mich nach dem Erwachen absolut beschämte, dass ich meinen Fahrgästen keine Hilfe in dieser schwierigen Situation gewesen war. Doch der Sanitäter winkte auf mein Gestammel hin sofort ab und rief den Psychologen.
Nachdem der Krankenwagen eingetroffen war, hatte sich schnell herausgestellt, dass die Sanitäter bei der Frau nichts mehr ausrichten konnten. Also wurde ein Leichenwagen angefordert und man kümmerte sich um mich und die Fahrgäste.
Ich würde an diesem Tag keine Fahrt mehr machen – und auch nicht an den folgenden, versicherte mir der Psychologe. Er tat seinen Job, vermutlich sogar gut. Das kann ich nicht beurteilen, denn ich war zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur verzweifelt bemüht, mein Frühstück bei mir zu behalten. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich scheiterte. Ich werde den Blick des Psychologen nie vergessen, wie er redlich versuchte, nicht allzu angewidert zu gucken. Auch sein Bemühen war vergeblich gewesen.
***
Vom Zeitpunkt des Unglücks an war alles unscharf, verschwommen, ungreifbar.
Ich sah immer nur Augen – dankbare Augen – ihre Augen. Und tief in mir drin war dieser unerklärliche Frieden. Ich sollte Gott spielen, und ich hatte es getan. Es klingt furchtbar blasphemisch, ich weiß, aber ich wurde gebeten ein Leben zu beenden, und ich hatte es getan. Ich will nicht behaupten, dass mich das glücklich gemacht hätte, aber tatsächlich ließ es mich irgendwie zufrieden mit mir selbst sein. Doch kurze Zeit später ahnte ich, dass dieses Gefühl wohl nur dem Beruhigungsmittel zu verdanken war. Ich durchlief daraufhin die verschiedenen Phasen des Selbstvorwurfs, der Selbstzerfleischung und des alles erschütternden Zweifels an der Berechtigung der eigenen Existenz … nachdem ich eine andere Existenz ausgelöscht hatte. Hat Gott auch diese Selbstzweifel, bei jedem, den er tötet, fragte ich mich. Aber dann käme er aus dem Zweifeln ja gar nicht mehr heraus. Schließlich tötet er ständig – rund um die Uhr … in mannigfaltiger Art und Weise.
Ich gebe zu, dass mich solche Gedanken seit diesem Tag weit häufiger heimsuchen als jemals zuvor in meinem Leben. Und ich begriff schon bald, dass ich nicht länger normal war. Ich war aus der Masse herausgehoben wurden. Ich war nicht reicher, berühmter oder begehrter geworden – nein, ich war ein besonders bemitleidenswerter Mensch geworden!
Alle bedauerten mich. Aber da war noch etwas anderes. Sie blickten mich an und sprachen Worte des Mitgefühls, doch in ihren Augen stand der Wunsch, alles ganz genau erfahren zu wollen. Einige fragten mich dann auch nach Details. Wenn ich sie erzählte, winkten die Leute jedoch schnell ab und wandten sich um. Eine Nachbarin schlug sich die Hand vor die Augen und ließ sich mitten auf den Bürgersteig sinken, mit der Bemerkung, so genau habe sie es dann doch nicht wissen wollen, nun sei ihr schwarz vor Augen geworden.
Denn eigentlich wollte es trotz aller Neugier keiner so genau wissen. Der Psychologe hatte mich zwar in Profimanier gleich mehrfach angehört und mich aufgefordert, die ganze Situation Revue passieren zu lassen, doch auch er wurde blass um die Nase. Wie konnte ich es ihm verdenken? Ich hätte nicht anders reagiert, wenn mir jemand eine solche Horrorgeschichte erzählte. Doch mit der Zeit wurde ich wütend. Ich hatte auch nicht darum gebeten, diese Erfahrung zu machen. Doch ichhatte sie gemacht!
Die Frau auf den Schienen hatte mir eben jene Erfahrung zugedacht. Und obwohl wir uns erst kurz vor ihrem Tod begegnet waren, hatte sie mir dankbar zugelächelt.
Tagelang konnte ich nicht arbeiten, nicht schlafen, kaum essen. Und dann dämmerte langsam ein Gedanke in mir hoch. Es war wie ein Lichtstrahl, der sich von der aufgehenden Sonne über das Land stiehlt und einen heißen Tag verspricht. Nur, dass immer noch Winter war, und der Strahl sich lediglich in meinem Geist gebildet hatte.
Ich würde nicht eher wieder Normalität in meinem Leben finden, bis ich nicht herausgefunden hatte, warum die Frau mir an jenem verhängnisvollen Tag gegenübergetreten war, um durch mich zu sterben.
1. Kapitel
Für die Kollegen war ich zum ersten Mal ein interessanter Gesprächspartner. Eigentlich hatte ich den Eindruck, dass sie mich überhaupt zum ersten Mal wirklich bemerkten. Doch ich enttäuschte sie alle. Obwohl ich Nachbarn, meinem Psychologen und sogar der Verkäuferin in der Bäckerei alles haarklein erzählte, ließ ich die Kollegen mit ihren Vorstellungen von dem Geschehen weitestgehend allein. Meistens ließ ich sie über das mutmaßen, was geschehen war, wie es sich angehört hatte, und wie die Selbstmörderin später wohl ausgesehen hatte. Ich bemerkte ihre Faszination des Grauens und ließ sie ihnen. Ab und zu nickte ich, und wenn ich es über mich bringen konnte, dann sagte ich so etwas wie: „Ja, es war furchtbar – eine Tragödie.“
Es schien keinen zu interessieren, wie ich mich dabei fühlte. Alle wollten nur ihren Adrenalinspiegel ein wenig in die Höhe treiben. So weit, dass es kitzelte, aber um Himmels willen nicht so weit, dass man deswegen nachts nicht mehr schlafen konnte. Aber eigentlich gab es einen anderen Grund, warum ich ihnen keine Details erzählte. Ich wollte diese Erinnerung für mich behalten. Es war allein meine Erfahrung, die ich mit niemandem teilen wollte, dem es jederzeit genauso ergehen könnte. Bei den Nachbarn und der Bäckereifrau war es mir egal. Auch sie konnten natürlich etwas Ähnliches erleben, aber es war eben nicht so wahrscheinlich, wie die Tatsache, dass meinen Kollegen genauso gut ein Selbstmordkandidat auf die Gleise treten konnte. Und dann? Dann würden sie sagen: „Hey, das ist mir auch passiert. War doch halb so wild. Worüber hast du dich bloß so aufgeregt?“ Nein, das sollte mir nicht passieren, deshalb gab ich in Kollegenkreisen nicht preis, wie sehr mich diese Geschichte mitnahm. Naja, eine Ausnahme gab es doch: Elsa. Elsa war schon von jeher die Ausnahme gewesen. Eine Frau, die sich für mich interessiert hatte. Für mich!
Es war auf einer Betriebsfeier gewesen. Natürlich kannte ich schon einige Bahnfahrerinnen, aber ich hatte noch zu keiner Kontakt gehabt. Jedenfalls nicht auf diese Art.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich überhaupt noch keinen besonders intensiven Kontakt zu Frauen. Natürlich hatte ich schon ein paar Mal mit einer Frau geschlafen, aber man könnte wohl eher sagen, ich hatte sexuellen Kontakt mit einem weiblichen Körper. Mehr war das Ganze noch nie gewesen. Als ich in der letzten Klasse war, hatte ich – wie man so schön sagt – meine Jungfräulichkeit verloren. Ein Mädchen aus meiner Parallelklasse hatte einen Narren an mir gefressen, weil ich wohl immer so jämmerlich aussah. Das sagte sie zumindest, nachdem ich mein Sperma das erste Mal in einem Frauenschoß verspritzt hatte. Jämmerlich … so hatte ich mich nach diesem Erlebnis tatsächlich gefühlt.
Es folgten im Laufe der Jahre ähnliche Begebenheiten. Kurze sexuelle Episoden, die aneinandergereiht nicht einmal für den Vorspann eines Pornofilms taugen würden. Und schon gar nicht für eine Liebesgeschichte.
Ich gebe zu, dass mich eine gewisse Frustration befiel. Nach der letzten Nacht dieser Art, hatte ich mich denn auch darauf beschränkt, lieber in regelmäßigen Abständen selbst Hand an mich zu legen. Ich hatte mich dann eigentlich immer ganz wohl gefühlt. Der Druck war weg und meist blieb auch das schale Gefühl aus, das mich früher nach dem Beischlaf so oft überfallen hatte.
Doch dann kam das Betriebsfest und mit ihm Elsa. Und am gleichen Abend kam auch ich – so befriedigt, wie ich es bis dahin noch nie erlebt hatte. Elsa hat schulterlanges Haar, eine üppige braune Mähne, in der man seine Finger vergraben kann. Und sie hat außerordentlich volle Brüste. Außerdem besitzt sie ein lautes, aber sehr ansteckendes Lachen. In ihren Augen kann die Leidenschaft brennen, dass einem ganz schwindlig wird. Vielleicht hatte sie einige Biere zu viel getrunken an diesem Abend, aber man merkte ihr nicht an, dass sie betrunken war. Sie war gut gelaunt. Hat viel gelacht und ihre Hände schlecht bei sich behalten können. Meine Kollegen machten Bemerkungen, weil ich anscheinend ihr ausgemachtes Opfer war. Merkwürdigerweise hatte ich mich jedoch gar nicht wie ein Opfer gefühlt. Im Gegenteil. Ich habe mich sogar sehr gut gefühlt. Und so hatte ich nachgegeben, und mich, entgegen meiner eigentlichen Überzeugung, zu ebenfalls einigen Bieren verleiten lassen. Das war nicht das Einzige, wozu mich Elsa an diesem Abend verführte. Ich wusste gar nicht wie mir geschah, aber das war mir auch egal. Es war einfach wie in einem Traum. Elsa sagte mir, sie würde sich ein wenig schwindlig fühlen und wollte, dass ich sie an die frische Luft begleite. Das tat ich. Wir gingen ein paar Meter. Die Luft war lau, man hörte die Grillen zirpen. Es war fast wie in einer Lovestory. Plötzlich hielt sie an und sog die Nachtluft ein. Dann drehte sie sich zu mir und sagte: „Weißt du, was ich jetzt möchte?“
Woher hätte ich das wissen sollen? Es gibt ja so viele Dinge, die ein Mensch wie Elsa sich wünscht, also zuckte ich nur mit den Schultern. Doch statt mir die Frage zu beantworten, die sie selbst gestellt hatte, zog sie mich plötzlich an sich heran und gab mir einen Kuss. Ich weiß, das hört sich jetzt nicht sehr männlich an, aber so war es, und ich fand es sehr erregend. Natürlich war ich etwas überrascht, aber küssen konnte ich eigentlich immer recht passabel, und so ließ ich meine Zunge mit ihrer tanzen, bis Elsa nach Luft schnappen musste. Sie sah mich leise lächelnd an, und da war er wieder, dieser Blick, der sich direkt in meine Lenden zu bohren schien. In meinem Kopf bildete sich der Gedanke, dass ich nun wieder den gleichen Fehler machen würde. Ich würde sie mit nach Hause nehmen, und wir würden Sex haben. Kurz darauf würde sie so etwas sagen wie: „Ich habe wohl zu viel Bier getrunken. Wie bin ich bloß hierhergekommen?“
Langsam machte ich einen Schritt nach hinten. Von ihr weg. Wenn ich nun allein nach Hause ging, konnte ich es mir selbst machen und dabei von einer wundervollen Nacht mit Elsa träumen. Einen Traum, der nicht durch die Realität zerstört werden konnte. Doch Elsa schien nicht einfach ein Traum sein zu wollen. Nachdem ich einen Schritt nach hinten gemacht hatte, machte sie zwei nach vorn. Sie war mir dadurch so nahe, dass ich ihre Körperwärme spüren konnte. Ihre Hände umfingen meinen Nacken, während sie ihr Knie langsam zwischen meine Beine schob. Einen Moment lang lag ihre Kniescheibe genau auf meinem erigierten Penis und ich befürchtete, sie ramme sie mir in die Weichteile. Doch das war nicht ihr Vorhaben. Lässig nahm Elsa eine Hand von meinem Nacken, ihr Knie verschwand und wurde stattdessen von ihrer Hand abgelöst. Das war der Augenblick, in dem ich den Plan, allein zu verschwinden, vollständig aufgab. Ich würde sie mitnehmen, selbst wenn es abermals ein ernüchterndes Erwachen gab, aus diesem Traum, der viel zu gut war, um meiner zu sein.
Doch wieder übernahm Elsa das Ruder. Sie griff nach meiner Hand und zog mich in den Betriebshof. Dort standen zahlreiche Bahnen, da nachts nur eingeschränkter Fahrbetrieb herrschte. Alles war dunkel, aber Elsa konnte anscheinend genug erkennen. Sie holte ihren Schlüsselbund hervor, entriegelte die Tür einer Stadtbahn und zog mich mit sich. Dann schloss sie die Tür hinter uns. Sie fasste mir in den Schritt und küsste mich stürmisch. Meine Hände begannen daraufhin wie von selbst, sie zu entkleiden. Elsa lachte jetzt viel leiser als sonst, irgendwie kehlig und sehr verführerisch. Als wir unsere Kleidung abgelegt hatten, breitete Elsa sie mitten im Gang aus und ließ sich darauf nieder.
„Nimm mich hier und sofort“, raunte sie.
Es war eine eigenartige Situation, die wir heraufbeschworen hatten, aber ich gebe zu, dass ich nicht mehr lange überlegte und der Bitte nur allzu gerne nachkam. Bequem war die Sache nicht, aber durchaus erotisch.
Seitdem hatten wir keinen Sex mehr. Aber wir haben ein recht herzliches Verhältnis zueinander. Und ich für meinen Teil schloss lange nicht aus, nochmal mit ihr zu schlafen. Aber vielleicht doch lieber in einem Bett. Mir fiel nämlich auf, dass sich Elsa nach unserer gemeinsamen Aktion wohl nur unter Schmerzen bewegen konnte. Als ich sie fragte, ob ihr etwas wehtäte, lächelte sie und sagte: „Ja, mein Kopf … vom Saufen.“
Nach dem Unglück – wie die anderen es nannten, dass ich eine Frau ins Jenseits befördert hatte – musste ich trotz Krankschreibung ein paar Mal kurz zur Arbeit, um Unterlagen auszufüllen. Zumindest wenn es mir möglich wäre, wurde mir gesagt … Ich tat meine Pflicht. Bei einem dieser Besuche kam Elsa zu mir und nahm mich kurz in den Arm. Ich freute mich über ihre Anteilnahme. Ihr hätte ich gerne alles erzählt, aber sie fragte mich nicht. Sie murmelte etwas von ihrer nächsten Fahrt und verschwand so schnell, wie sie aufgetaucht war.
***
Knapp zwei Wochen waren vergangen, seit dieser schlimmen Sache, die ich nicht aus meinem Gedächtnis löschen konnte. Das neue Jahrtausend war inzwischen da, und die Welt existierte noch, aber ich hatte den Trubel um das alles kaum mitbekommen. Meine Aufmerksamkeit galt anderen Dingen.
Durch die Zeitung wusste ich, wann die Frau, die ich überfahren hatte, beerdigt werden würde. Ich hatte mich entschieden, hinzugehen. Auf dem Weg zum Friedhof schossen mir Gedanken durch den Kopf, die manch einer als zynisch bezeichnen würde. Immer wieder fragte ich mich zum Beispiel, wie sie es mit ihrem Kopf gemacht hatten, da es sich wohl nicht um ein Urnenbegräbnis handelte. War er irgendwie an ihrem Hals befestigt worden, oder hatte man ihn einfach neben sie gelegt? Mir war klar, dass ich auf diese Fragen keine Antwort erhalten würde. Und eigentlich waren es auch nicht die drängendsten, die mich beschäftigten. Den Leuten, die zu ihrer Beerdigung gekommen waren, galt meine besondere Aufmerksamkeit. Ich wollte wissen, was das für Menschen waren. Nein, das stimmte nicht. Ich wollte wissen, was sie für ein Mensch gewesen war, und diese Trauernden schienen mir der einzige Weg zu sein, es herauszubekommen. Natürlich war ich nicht in Dienstuniform erschienen. Vielleicht hatte der ein oder andere dennoch erraten, wer ich war. Doch es kam niemand auf mich zugestürmt, um mich als Mörder zu beschimpfen, wie ich es die Nacht zuvor geträumt hatte.
Nachdem die Bestattung vorbei war, stand ich unbeweglich in der Nähe des Grabes. Es sollte niemand von mir sagen können, ich hätte nur aus Pflichtgefühl an der Trauerzeremonie teilgenommen. Ich dachte, dass es meine persönliche Betroffenheit besser widerspiegelte, wenn ich dort ausharrte, obwohl es inzwischen angefangen hatte zu schneien. Die Schneeflocken wehten lustig durch die Luft und schienen mein ganzes Bemühen zu verhöhnen. Dennoch blieb ich am gleichen Fleck stehen. Meine Füße waren kalt, also bewegte ich unauffällig die Zehen, ansonsten erweckte ich einen hoffentlich erstarrten Eindruck.
Die meisten hatten den Friedhof bereits verlassen, als eine Frau mit verweinten Augen auf mich zukam. Ich traute mich kaum zu atmen, als die schwarz gekleidete Person mich ansprach. Jetzt würde ich erklären müssen, wer ich war. Ich würde gestehen müssen. Ich würde als schuldig erkannt werden. Und meine Seele würde sich binnen Sekunden im gleichen dunklen Sarg wiederfinden wie der Körper der Frau, die ich getötet hatte.
Ihr Name war Katrin Baumann gewesen. So hatte ich es in der Todesanzeige gelesen. Aber für mich war sie 'die Frau mit dem Lächeln'. Dieser Name schien mir passender, denn so hatte ich sie kennengelernt. Sie hatte nie vor mir gestanden, mir die Hand hingestreckt und gesagt: „Hallo, mein Name ist Katrin Baumann.“ Nein, sie hatte auf meinen Gleisen gestanden und sich mir mit einem Lächeln vorgestellt. Ein Lächeln, das jetzt für immer auf ihrem Gesicht liegen würde – nein, nicht für immer, nur so lange, bis der Körper sich aufzulösen begann. Es war nicht weiter schlimm, diesen Gedanken zu haben, eher tröstlich. Ihr Lächeln hatte jetzt ohnehin nicht mehr den Glanz, wie zu dem Zeitpunkt, als sie noch lebte. Vielleicht war es auch nur durch das Erschlaffen ihrer Gesichtsmuskeln entstanden. So oder so war es zu einem Lächeln ohne Leben geworden. Genauso wie ich zu einem Körper ohne Leben geworden war. Doch die Frau, die mich ansprach, schien nicht zu bemerken, dass kein Leben mehr in mir steckte. Ich konnte ihr nicht verübeln, dass sie es nicht gleich erkannte, denn ich stand ja aufrecht vor ihr, während die wirklich toten im Allgemeinen liegend in einem Erdloch ruhen.
„Katrin war meine Schwester“, sagte die Frau mit einem unsicheren Lächeln. Verwirrt sah ich sie an. Es gab natürlich keinen Grund für mich, an ihren Worten zu zweifeln, doch mein einziger Gedanke war: Aber ihre Augen waren grün. Als habe sie meine Gedanken erraten, wurde das Lächeln der Frau nun sicherer, und sie sagte: „Wir sahen uns nie sehr ähnlich, Katrin und ich. Sie hatte grüne Augen, ich habe die Augen meines Vaters – braune“, erklärte sie, als könne ich nicht selbst erkennen, welche Farbe ihre Augen hatten. Und tatsächlich fiel es mir schwer, ihre Aussage zu überprüfen, da ich mich scheute, in diese verweinten Augen zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte, also tat ich das Einzige, was man in einer solchen Situation tun kann – was man gelernt hat, was sich gehört. Ich reichte ihr meine Hand und murmelte mit leiser Stimme eine Beileidsbekundung. Sie reichte mir ebenfalls die Hand. „Patricia Neufeld.“
Ich zögerte, dann sagte ich rasch meinen Namen, in der Hoffnung, dass sie nicht aus dem Polizeibericht wusste, wer ich war. Aber natürlich wusste sie es. Sie hatte es schon gewusst, als sie auf mich zugekommen war. Es wurde mir schlagartig klar, als sie leise sagte: „Es war sicher auch für Sie sehr schwer. Niemand steckt so etwas leicht weg.“
Ich öffnete meinen Mund. Schloss ihn aber wieder, ohne etwas zu sagen. Wenn ich ein Kind gewesen wäre, hätte ich ebenfalls meine Augen geschlossen, in der Hoffnung, dass Patricia Neufeld mich dann nicht mehr sehen könnte. Aber ich war kein Kind, das sich dieser Illusion hingeben konnte. Ich wäre nicht einmal verschwunden, wenn ich mich umgedreht hätte und weggelaufen wäre. Denn man verschwindet nicht einfach. Man kann anderen ausweichen, aber verschwinden kann man nie. Immer nimmt man das mit, was einen präsent macht – das eigene Bewusstsein. Man kann es nur endgültig ausschalten, wenn man es macht wie Katrin Baumann. Doch selbst sie war nicht verschwunden. Sie am allerwenigsten. Sie lag da, in diesem Grab, mit Hunderten von Blumen um sie herum. Nein, verschwunden war sie ganz und gar nicht. Falls dies ihr Wunsch gewesen sein sollte, hatte sie schrecklich versagt.
Patricia Neufeld sah mich nun neugierig an. Ich hatte ihr nichts zu sagen. Ich konnte nicht. Wollte nicht. Durfte es letztendlich nicht. Ich hatte ihre Schwester nicht gekannt. Wie hatte ich auf den Gedanken kommen können, dass es einen Unterschied machte, wenn ich versuchte, etwas über sie herauszufinden? Das Resultat blieb doch dasselbe. Ein Grab auf einem Friedhof – ein Grab in meinem Herzen.
„Kommen Sie! Wir haben einen Umtrunk im Haus meiner Schwester organisiert. Sie sollten mitkommen ... um Ihrer selbst willen.“ Ich dachte über diese Worte nach. 'Um meiner selbst willen'. Hatte ich einen Willen? Ging es um mein Wohlergehen? Um mein Seelenheil? Während ich ihr wie mechanisch folgte, stellte ich fest, dass ich diese Gedanken nicht festhalten konnte. Genauso wenig wie ich Worte fand, um ihre Einladung dankend abzulehnen. Erst als wir den Flur des Hauses betraten, und meine Nase durch die plötzliche Wärme anfing zu laufen, konnte ich wieder mein Denken mit meinem Handeln überein bringen.
Es beschränkte sich allerdings erst einmal darauf, zu einem Taschentuch zu greifen, um mich zu schnäuzen. Sofort klopfte mir ein fremder Mann auf die Schulter. Auch er hielt ein Taschentuch in den Händen und sagte: „Wir vermissen sie alle schrecklich. Mein Gott, warum hat sie das nur getan?“
Ich ließ mein Taschentuch sinken und sah ihm hinterher, wie er zum nächsten kleinen Grüppchen ging, um anscheinend das gleiche Bedauern auch dort zum Ausdruck zu bringen. Patricia Neufeld wurde von einigen Leuten gleichzeitig angesprochen. Sie entschuldigte sich kurz, kam aber noch einmal zu mir zurück und sagte eindringlich: „Bleiben Sie, bitte! Ich möchte Sie so vieles fragen. Bitte geben Sie mir diese Chance. Es ist mir unendlich wichtig.“
Sie ging in Richtung Küche und verschwand erst einmal.
Ich stand da, in diesem fremden Haus, zwischen all den fremden Menschen, und wusste, dass man mich hinauswerfen würde, wenn man wüsste, wer ich war. Oder irrte ich mich? Patricia Neufeld wusste ganz genau wer ich war, dennoch hatte sie mich inständig gebeten, zu bleiben. Sie erhoffte sich Informationen. Ein Seufzen, das wohl viel zu lange in meinem Körper verweilt hatte, entrang sich meiner Kehle. Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen traten. Es tat gut, diesem Drang nachzugeben.
Wie ich so dastand, mit nassen Augen, kam ich mir auf einmal gar nicht mehr wie ein Fremder in diesem Haus vor. Durch meine sichtbare Trauer hatte ich mich der Menge angepasst. Es ist immer wichtig, wie die Mehrheit zu sein. Man darf nicht gefasst sein, in einem Haus voller Trauernden. Nun war ich angepasst und fühlte mich dadurch viel sicherer. Ein Gleicher unter Gleichen. Mein getrübter Blick wanderte durch den Raum. Ich sah, wie ein Mann mit gesenktem Kopf die Beileidsbekundungen einiger Freunde oder Bekannten entgegennahm. Patricia Neufeld trat plötzlich wieder an meine Seite und wisperte mir ins Ohr: „Das ist Gero, Katrins Ehemann.“
Ich beobachtete ihn eine Zeitlang aus den Augenwinkeln. Erst als niemand mehr vor ihm stand, um ihm die Hand zu schütteln, ging ich schnellen Schrittes auf ihn zu. Doch bevor ich bei ihm angelangt war, um ihm ebenfalls meine Anteilnahme zu versichern, hatte sich eine völlig hysterische Frau zwischen uns geschoben.
„Es war doch ein Unfall, Gero, nicht wahr? Sag mir, dass es nur ein Unfall war!“
Der Angesprochene legte seine Hand auf die Schulter der Frau und sagte laut und deutlich: „Ja Luisa, es war nur ein Unfall. Verursacht, weil ein besoffener Bahnfahrer nicht rechtzeitig erkannt hat, dass sie versehentlich auf die Schienen geraten war.“
Ich versuchte die Worte mit den Erinnerungen in meinem Kopf zu vergleichen. Diese beiden Bilder passten nicht übereinander. Automatisch machte ich einen Schritt rückwärts, als mich Geros Blick streifte. Er sah mich einen Moment lang verachtend an, dann wandte er den Kopf in eine andere Richtung und vertiefte sich in ein Gespräch mit einem anderen Mann. Meine Füße machten noch einen Schritt nach hinten. Dann noch einen, und schließlich war es Patricia, die mich sanft festhielt.
„Er ist so ein verlogener Drecksack. Das war er schon immer. Kümmern Sie sich nicht darum, was er gesagt hat. Er weiß, dass es nicht so geschehen ist. Das ist die Hauptsache, nicht wahr?“
„Ich muss hier raus“, sagte ich. „Sofort!“, fügte ich dringlicher an.
„Bitte ...“, sagte sie flehend. Doch ich hob abwehrend die Hände, drehte mich von ihr weg, um die Haustür aufzureißen und nach draußen zu stürzen. Die Kälte traf mich wie ein Faustschlag. Die Schneeflocken wirbelten um meinen Kopf. Sie ließen mich die Welt nur noch schemenhaft erkennen. Das Wirbeln wurde immer schneller. Alles versank in diesem Rausch. Ein Schmerz folgte, der mich innerlich zu zerreißen schien – dann nichts mehr.
***
Ich kam erst im Krankenwagen wieder zu mir. Eine Maske befand sich auf meinem Gesicht. Panisch schlug ich sie von mir. Sofort legte sich eine Hand beruhigend auf meinen Arm und drückte ihn dann mit sanfter Gewalt nieder. Man wollte mir erneut die Maske aufsetzen, doch ich drehte meinen Kopf zur Seite und begann mit der anderen Hand zu schlagen, bis mein Handgelenk in einen festen Griff genommen wurde. Mein Kopf wurde wieder in die andere Richtung gedreht. Ein Licht strahlte mir erst in das rechte, dann in das linke Auge. Eine Stimme arbeitete sich in meinen Geist vor.
„Sie hatten einen Kreislaufkollaps. Aber kein Grund zur Sorge. Trotzdem nehmen wir Sie erstmal mit in die Klinik. Bleiben Sie ruhig, alles ist in Ordnung.“
Was wollte dieser Mann? Was erzählte er mir da? Alles wäre in Ordnung, hatte er gesagt. Nichts war in Ordnung! Gar nichts! Ich hatte eine Frau getötet! Die Schwester dieser Frau saß im Krankenwagen neben mir und sah mich besorgt an.
„Ich war nicht betrunken“, sagte ich leise. Dann lauter: „Ich war nicht betrunken!“
„Hey, ist ja gut! Das sagt doch keiner. Ich habe nur gesagt, dass Sie einen Kreislaufkollaps hatten. Beruhigen Sie sich!“, fuhr der Sanitäter mich an.
Ich ignorierte ihn. Alles, was ich sah, war das Nicken von Patricia, und ich hörte ihre leisen Worte: „Ich weiß.“
Erschöpft schloss ich die Augen. Erneut wurde mir die Maske aufgesetzt. Diesmal wehrte ich mich nicht.
***
Als wir in der Klinik ankamen, fühlte ich mich soweit wieder hergestellt, dass es mir unendlich peinlich war, auf einer Trage von den Sanitätern in die Notaufnahme befördert zu werden. Immer wieder versicherte ich, dass ich selbst laufen könne, was jedoch niemand wahrzunehmen schien. Nachdem ich eingehend untersucht worden war, bot man mir an, mich über Nacht zur Kontrolle dazubehalten, was ich vehement ablehnte. Der Arzt hob missbilligend die Augenbrauen und murmelte etwas über uneinsichtige Patienten, die ihm das Leben unnötig schwer machten. Und letztendlich verdankte ich es wohl Patricia, dass er mich gehen ließ. Verblüfft hörte ich, wie sie dem Mann in Weiß versicherte, die Nacht über ein Auge auf mich zu haben. Sie versprach, mich sofort wieder in die Klinik zu fahren, falls mein Zustand es erfordern würde. Dann half sie mir auf und zischte mir ins Ohr: „Jetzt kippen Sie mir um Gottes Willen nicht um“, während wir gemeinsam in Richtung Ausgang gingen.
Draußen angekommen, öffnete sie die Tür des nächstbesten freien Taxis und bugsierte mich in den Innenraum. Dann ging sie auf die andere Seite und setzte sich neben mich.
„Wo soll's hingehen?“, fragte der Fahrer knapp.
Patricia sah mich fragend an. Als ich nichts erwiderte, fragte sie mich: „Wo wohnen Sie? Können Sie ihm Ihre Adresse nennen?“
Falls der Fahrer über ihre Fragen an mich erstaunt war, ließ er es sich nicht anmerken. Vielleicht waren wir für ihn längst nicht so merkwürdig, wie mir unsere Situation erschien. Ich nannte ihm die Adresse. Eine gute Viertelstunde später hatten wir das Ziel erreicht. Ich wollte mich von Patricia verabschieden. Doch daraus wurde nichts, denn sie stieg ebenfalls aus und bezahlte den Taxifahrer, ehe ich auch nur in der Lage war, nach meinem Portemonnaie zu greifen.
Das Taxi sauste davon, und ich stand mit Patricia vor meiner Tür.
„Vielen Dank für Ihre Hilfe“, versuchte ich die Sache wenigstens ein wenig würdevoll zu einem Abschluss zu bringen. Doch sie lächelte leicht und sagte: „Ich habe Sie nur aus dem Krankenhaus bekommen, weil ich zugesichert habe, diese Nacht auf Sie zu achten. Und wenn ich mein Wort gegeben habe, dann halte ich das für gewöhnlich auch. Also stellen Sie sich nicht so an. Sie wohnen doch allein?“
Ich nickte, dann sagte ich rasch: „Aber ich komme schon klar.“
Sie wollte davon nichts hören, sondern erwiderte: „Es stört mich nicht, wenn Sie nicht aufgeräumt haben ... Oder falls Ihre Pornosammlung auf dem Bett liegt. Alles, was ich will, ist mein Versprechen einzulösen und diese Nacht ein Auge auf Sie zu haben. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn Sie mir morgen früh erzählen, was sich vor dem Tod meiner Schwester genau ereignet hat. Aber erst ruhen Sie sich aus, okay? Und jetzt lassen Sie uns nicht länger in der Kälte rumstehen.“
Ich war unfähig, ihr zu widersprechen. Sie hatte alles durchdacht. Zwar lag meine Pornosammlung, wie es sich gehörte, unter und nicht auf dem Bett, doch was die sonstige Unordnung anging, hatte sie durchaus recht.
Als wir meine Wohnung betreten hatten, wollte ich den benutzten Teller und das Besteck schnell in den Geschirrspüler räumen, doch Patricia nahm sie mir entschieden aus der Hand.
„Jetzt ist nicht die Zeit, um den Hausmann zu spielen. Sie kommen gerade aus der Notaufnahme. Wo ist Ihr Schlafzimmer?“
Ich deutete auf die entsprechende Tür. Sie begleitete mich bis zum Bett. Eigentlich wäre ich nicht auf ihre Hilfe angewiesen gewesen, doch ich ließ sie gewähren. Und ich muss zugeben, dass es sich schön anfühlte, wie sie sich um mich kümmerte.
„Wenn Sie sich kräftig genug fühlen, können Sie sich vielleicht umziehen. Falls es Ihnen zu viel Mühe macht, bleiben Sie einfach so. Ich lege mich auf Ihre Couch. Keine Sorge, ich werde nicht in Ihrer Wohnung herumschnüffeln. Ruhen Sie sich aus. Wenn irgendetwas sein sollte, rufen Sie, in Ordnung?“
Nie in meinem Leben hatte ich eine derart praktisch veranlagte Frau kennengelernt, die noch dazu so fürsorglich war. Ich brummte eine Bestätigung. Patricia verließ den Raum. Ich zog meinen Pullover und die Hose aus, dann legte ich mich ins Bett. Ich denke, ich hatte mich kaum zur Seite gedreht, als ich auch schon in einen traumreichen Schlaf fiel.
***
Der nächste Morgen hatte mich im eisigen Griff, sobald ich meine Beine über den Bettrand schwang. Die Heizung hatte ich am Tag zuvor ziemlich weit heruntergedreht, um Energie zu sparen. Eigentlich wollte ich sie nach meiner Rückkehr wieder hochdrehen, was durch die besonderen Umstände allerdings nicht geschehen war. Nun würde es dauern, bis die Wohnung wieder eine einigermaßen erträgliche Temperatur hatte. Schnell schlüpfte ich in meine Sachen vom Vortag. Als ich ins Wohnzimmer ging, fiel mein Blick auf Patricia, die auf meiner Couch lag. Sie war nicht entkleidet. Außerdem hatte sie sich die Decke übergezogen, die ich am Tag zuvor auf den Sessel geworfen hatte. Eng war der Wollstoff um ihren Körper geschlungen. Doch obwohl sie schlief, konnte ich deutlich sehen, dass sie zitterte. Ich stellte rasch die Heizung hoch. Danach ging ich mit eiligen Schritten zum Schlafzimmer, holte mein Bettzeug und breitete es kurz darauf über die schlafende Patricia. Mein Blick lag etwas zu lange auf ihrem entspannten Gesicht.
Leise begab ich mich in die Küche und begann ein Frühstück zusammenzustellen. Es war ungewohnt, zwei Tassen und zwei Teller aus dem Schrank zu holen. Auch die Dosierung des Kaffeepulvers war mir gründlich misslungen. Er sah grässlich hell aus, als ich ihn in die Tassen goss, doch vielleicht mochte Patricia ohnehin keinen Kaffee. Woher sollte ich das wissen? Ich kannte diese Frau auf meiner Couch schließlich gar nicht.
Als ich mit einem Tablett, auf das ich noch einige Brotscheiben, Käse, Marmelade und Butter gelegt hatte, das Wohnzimmer betrat, schlug sie die Augen auf und blinzelte mich an.
„Wie geht’s Ihnen?“, fragte sie vom Schlaf noch benommen.
„Gut“, murmelte ich. „Tut mir leid, dass Sie gefroren haben.“ Erst jetzt bemerkte sie meine Bettdecke, schlug sie zurück und sagte: „Danke, das war nett von Ihnen.“
Mir war völlig klar, dass es noch wesentlich netter von mir gewesen wäre, ihr mein Bett anzubieten und selbst mit der Couch vorlieb zu nehmen. So taten das die Gentlemen in Filmen. Doch ich hatte bisher noch nicht viel Gelegenheit gehabt, mich in der Eigenschaft eines Gentlemans zu üben, und so hoffte ich, mit dieser Geste wenigstens einen leidlichen Start hingelegt zu haben. Ich stellte das Tablett auf dem Couchtisch ab und wies mit der Hand darauf.
„Haben Sie Hunger?“
Sie lächelte mich kurz an und nickte.
„Ich müsste nur erst ins Bad.“ Ihr fragender Blick ruhte auf mir.
„Ähm, erste Tür links neben der Wohnungstür“, sagte ich schnell und es war, als habe jemand einen Kübel Eiswasser über mir geleert, als ich an den Zustand meines Badezimmers dachte. Jetzt wäre es wohl die absolute Unhöflichkeit gewesen, sie zu bitten, mich zuerst hineinzulassen, um eine schnelle Säuberungsaktion durchzuführen. Also sah ich mit angehaltenem Atem hinterher, wie sie den kompromittierendsten Raum meiner Wohnung betrat. Als sie die Tür geschlossen hatte, setzte ich mich in den Sessel, ließ meinen Kopf in die Hände sinken und murmelte ein unspektakuläres, aber dennoch alles umfassendes: „Scheiße.“
Kurze Zeit später kehrte Patricia zurück und setzte sich mir gegenüber auf die Couch.
„Sie hätten sich nicht die Mühe machen müssen“, sagte sie, doch im nächsten Moment griff sie nach einer Scheibe Brot und legte sie auf ihren Teller. Ich wich ihrem Blick so gut es ging aus und war ihr zutiefst dankbar, dass sie mich nicht auf meine Unordentlichkeit ansprach. Da glaubte ich noch, dass es für mich nichts Peinlicheres geben könnte, als den Zustand meines Badezimmers mit ihr zu erörtern, doch ich hatte mich getäuscht.
Es wurde mir klar, als sie mich traurig ansah und mit ganz leiser Stimme fragte: „Sie haben von ihr geträumt, letzte Nacht. Von meiner Schwester, nicht wahr?“
Plötzlich war ich nicht mehr fähig, den Schluck Kaffee in meinem Mund hinunterzuschlucken. Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis ich schließlich sprechen konnte.
„Wie kommen Sie darauf?“, fragte ich, ohne die Antwort eigentlich hören zu wollen. Nun sah sie verlegen auf die Tischplatte zwischen uns.
„Sie haben aufgeschrien.“
Ich spürte, dass sie noch mehr hatte sagen wollen, es jedoch im letzten Moment verhindern konnte. Ich wusste auch so, was sie gehört hatte. Dem Schrei folgte immer das Weinen – ich wusste es, da ich seit Tagen immer denselben Traum hatte. Als es geschehen war, hatte ich nicht geweint, nicht einmal geschrien. Doch seitdem tat ich es jede Nacht. Ein gefundenes Fressen für meinen Psychologen – wenn ich es ihm erzählt hätte – was ich nicht tat.
Ich schwieg und biss in mein Brot, obwohl ich das Gefühl hatte, selbst diesen einen Bissen unmöglich bei mir behalten zu können. So kaute ich auch lange darauf und merkte, wie ich den breiigen Klumpen immer wieder von einer Seite meines Mundes auf die andere schob. Schließlich erhob ich mich und gab vor, etwas in der Küche vergessen zu haben. Als ich außerhalb von Patricias Blickfeld war, spuckte ich den Bissen Brot in den Müll. Mit der Handfläche strich ich über meine Stirn und bemerkte erstaunt, dass sie trotz der Kälte schweißnass war. Vielleicht war mein Kreislaufkollaps vom Vortag nur ein Vorzeichen für eine ernstere Erkrankung gewesen. Vielleicht würde ich Fieber bekommen. Ein hohes Fieber, dem keine Medizin Einhalt gebieten könnte. Ein Fieber, das die letzten Anzeichen von Leben endgültig aus meinem Körper brennen würde.
Ich verharrte einen Moment. Nach einigen Atemzügen musste ich mir eingestehen, dass ich kein Fieber hatte. Nicht einmal den Anflug einer kleinen Erkältung konnte ich erspüren. Also musste ich mich dem Leben weiterhin stellen. Ich durfte mich nicht hängen lassen. Was würde Patricia von mir denken? Was dachte sie bereits jetzt über mich?
Sie hatte am Tag zuvor den demütigenden Moment miterlebt, in dem eine vernichtende Lüge über mich erzählt wurde. Nicht einmal dagegen gewehrt hatte ich mich. Nichts klargestellt – ich war geflohen. Und als sei das nicht armselig genug, kippte ich vor ihren Augen einfach um. Aber auch das war noch nicht genug Blamage gewesen. Ich hatte geweint! Wenn auch im Schlaf – aber dennoch geweint! Und nun war ich nicht einmal in der Lage, Essen aufzunehmen, ohne mich dabei fast zu übergeben. Gott, ich wünschte wirklich in diesem Moment, ich wäre es, der in dem eisigen Grab liegen würde.
Als ich schließlich zu Patricia zurückkehrte, fiel mir ein, dass ich wenigstens irgendetwas aus der Küche hätte mitbringen können, um meine Aussage von zuvor nicht so völlig als Lüge erkennen zu lassen.
Doch dazu war es nun zu spät und so setzte ich mich einfach wieder ihr gegenüber, meinen Blick auf die Brotscheibe gerichtet, in der genau ein Bissen fehlte.
Auch Patricia hatte aufgehört zu essen und ich hörte sie leise seufzen. Ihre Stimme war sehr sanft. „Es tut mir leid. Ich würde Ihnen so gerne helfen.“
Endlich hob ich den Kopf. Ich denke, ich hatte einen trotzigen Blick, wie er höchstens einem Kind zusteht, als ich ihr in die Augen sah und sie bereits wieder belog.
„Es geht mir gut. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich erzähle Ihnen nun, was Sie wissen wollen, und dann können Sie den Rest des Tages in angenehmerer Gesellschaft verbringen.“
Ihre Augenbrauen zogen sich leicht zusammen. Sie verstand nicht, warum ich plötzlich so abweisend war. Ich verstand es selbst nicht.
Doch sie entspannte sich wieder und sah mich leicht kopfnickend an. Meine Hände wanderten zum Teller, der vor mir stand, und schoben ihn mitsamt dem angebissenen Brot zur Seite. Patricia schwieg abwartend.
Kurz ließ ich meinen Blick auf ihr ruhen, doch ich konnte nicht sprechen, solange ich in ihre Augen sah, die so viel Wärme ausstrahlten. Eine solche Geschichte kann man nicht erzählen, mit dem Gefühl, dass es noch irgendetwas Tröstliches, Warmes und Gutes auf der Welt gibt. Also ging mein Blick an ihr vorbei – war auf die Wand gerichtet, die hart, glatt und kalt war. Dann endlich begann ich zu berichten.
„Ich fuhr meine Strecke, wie ich es schon tausendmal getan habe. Ich war ausgeschlafen, gesund und in keiner Weise betrunken.“ Kurz sah ich sie an, um meine Worte zu unterstreichen. Es lag kein Zweifel auf ihrem Gesicht und so fuhr ich fort.
„Es war in einem Waldstück, als sie plötzlich auf den Schienen stand. Ich meine ... ich weiß nicht mehr ... wann ... sie sie betreten hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Vielleicht war ich abgelenkt ... Ich weiß es nicht mehr. Sie stand plötzlich einfach da!“
Erschöpft brach ich ab. Mir wurde klar, dass ich doch schuldig war. Ich musste schuld sein, denn ich konnte mich nicht erinnern, wann sie die Strecke betreten hatte. Vielleicht hätte ich doch noch rechtzeitig bremsen können, wenn ich mehr darauf geachtet hätte? Nein, das wäre völlig unmöglich gewesen – aber dennoch, ich hätte sie doch früher sehen müssen! Warum hatte die Polizei mich nicht näher danach befragt? Warum hatte man geglaubt, ich hätte nichts tun können? Warum hatte ich nicht die Strafe bekommen, die ich verdiente?
Mein Atem ging schneller. Ich fühlte mich, als hätte ich einen langen Lauf hinter mir. Aufgeputscht und dennoch völlig schwach, mit zittrigen Gliedern und brennenden Lungen. Mein Brustkorb schien zu eng zu werden. Das Herz schlug gegen meine Rippen und ich wünschte, es würde damit einfach aufhören – stillstehen, damit Ruhe einkehrte in meinen rastlosen Körper.
„Was geschah dann?“, fragte Patricia ruhig und brachte mich damit wieder in die Realität zurück. Immer noch konnte ich keinen Vorwurf in ihren Augen sehen. Warum nicht? Hatte sie denn nicht gehört, was ich ihr eben gebeichtet hatte? Sie wollte doch, dass ich redete! Warum hörte sie mir dann offensichtlich gar nicht zu? Bevor ich wusste, was ich tat, brach es aus mir hervor – in einer Wut, die sie sichtlich zurückschrecken ließ.
„Haben Sie es nicht begriffen?“, schrie ich sie an.
„Ich habe nicht gesehen, wie sie dahin kam. Ich habe nicht auf die Schienen gesehen. Ich habe nicht aufgepasst!“
In meinem Zorn hatte ich mich erhoben und stand nun bedrohlich vor ihr. Patricia sah mich erschrocken an. Dann setzte sie sich aufrecht und gab mir damit das Gefühl, meinem Ausbruch entgegenzutreten. Langsam ließ ich mich wieder in den Sessel sinken. Meine Wut war verraucht. Die Hände ineinander gekrampft, sagte ich mit entschiedener Stimme: „Ich werde das dem Polizeibericht hinzufügen. Gleich heute.“
Ihre Stimme klang ebenfalls beherrscht. „Sie glauben, Sie waren abgelenkt? Erzählen Sie mir, was Sie taten, bevor Sie Katrin auf den Schienen sahen.“
Zuerst war ich nicht in der Lage, den Sinn ihrer Worte zu erfassen. Schließlich nahm ihre Aufforderung zwei verschiedene Wege in mein Bewusstsein. Während der eine Teil meiner Gedanken mich aufs Schärfste davor warnte, irgendetwas zu erzählen, was gegen mich verwendet werden könnte, schien mir der andere Teil zuzuwispern, ich solle endlich Erlösung finden, indem ich jedes Detail jetzt und auf der Stelle erzählte. Den ersten Teil meines Bewusstseins konnte ich getrost ausblenden, denn es war mir inzwischen ein selbstzerstörerisches Bedürfnis, meine Schuldigkeit endlich der Welt kundzutun.
Mit Patricia wollte ich lediglich den Anfang machen – der Rest würde sich finden. Morgen würde ich vielleicht schon als Unmensch die Schlagzeilen der Zeitung zieren. Es war mir egal. Nein, mehr noch, sehnte ich mich doch regelrecht danach, endlich zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Mit äußerster Präzision erzählte ich Patricia, wie ihre Schwester das Opfer meiner Unachtsamkeit wurde. Der Gedanke an das Brot, das ich einfach nicht heruntergebracht hatte, ließ mich wieder an den Kaugummi denken, dem ich mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte als dem menschlichen Wesen, das direkt vor mich getreten war. Auch das erzählte ich ihr, ohne etwas schönzureden.
Sie hörte mir zu und ihre braunen Augen füllten sich mit Tränen, als ich ihr beschrieb, wie ihre Schwester mich angelächelt hatte. Ich sagte ihr, wie ich mich in dem Moment gefühlt hatte, als der Körper von der Bahn erfasst wurde. Nichts hatte ich gefühlt – fast nichts. Die Dienstvorschriften waren mir eingefallen. Wie verdammt gefühllos musste man sein, damit einem im Anblick des Todes Dienstvorschriften einfallen?
Auch dass ich um die Bahn herumgegangen war, erfuhr sie von mir. Dann stockte ich. Ihre Augen schwammen bereits in Tränen. Da war es wieder, dieses Gefühl, dass ich mit den schrecklichen Bildern in meinem Kopf allein weiterleben musste. Sie hatte alles wissen wollen. Doch so gefühllos konnte ich nun letztendlich nicht sein, ihr zu beschreiben, wie ich ihre Schwester aufgefunden hatte. Also schwieg ich.
„Sie hat sicherlich grausam ausgesehen“, sagte Patricia mit Angst in der Stimme. Ich rang mich zu einem Nicken durch. Das musste reichen, für sie – und für mich.
Sie wartete, ob ich weitersprechen würde. Sicher fürchtete sie sich davor, war jedoch bereit, sich dem auszusetzen, nun, da sie sich auf diesen schweren Pfad begeben hatte. Ich bewunderte Patricia für ihren Mut, und wahrscheinlich schonte ich sie gerade deshalb.
„Ich kann mich eigentlich nicht genau erinnern. Muss wohl der Schock gewesen sein“, sagte ich zögerlich. Sie nickte, aber ich glaubte, in ihren Augen einen dankbaren Ausdruck zu erkennen. Sie wusste, dass ich log.
Einige Minuten verstrichen in Schweigen. In dieser Zeit führte ich meine Kaffeetasse zum Mund und nahm einen Schluck von dem viel zu schwachen Gebräu, das inzwischen auch noch kalt war. Als Patricia plötzlich sprach, zuckte ich zusammen, obwohl ihre Stimme alles andere als laut gewesen war.
„Sie suchen die Schuld bei sich. Das ist falsch. Sie haben keinerlei Schuld. Lassen Sie sich das von keinem einreden. Ich habe meine Schwester geliebt, wir waren eng verbunden und Sie können mir eins glauben …, wenn ich Sie auch nur einen Bruchteil für schuldig halten würde, hätte ich dafür gesorgt, dass Sie dafür bezahlen. Sie mögen vielleicht in dieser Sekunde nicht nach vorne gesehen haben, aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Zeit zu bremsen auch niemals gereicht hätte, wenn Sie sie sofort gesehen hätten. Sie trifft keine Schuld. Meine Schwester wollte gehen. Sie waren nur ihr Werkzeug. Wenn Katrin geahnt hätte, was sie Ihnen damit antut, hätte sie sicher eine andere Art gewählt, um zu sterben. Sie hat nicht nachgedacht. So war sie, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann musste es sofort umgesetzt werden. Aber ... sie ... sie war ein guter Mensch.“
Die letzten Worte waren kaum noch verständlich gewesen, denn die Tränen schnürten Patricia die Kehle zu.
Mit beiden Händen versuchte sie vergeblich den Rinnsalen, die über ihr Gesicht liefen, Einhalt zu gebieten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Obwohl sie so weinte und alles schrecklich war, fühlte ich dennoch Erleichterung. Sie verurteilte mich immer noch nicht. Nun gab es nichts mehr, was ich ihr vorenthalten hatte, wenn man von dem abgetrennten Kopf absah. Sie wusste alles und sprach mich frei. Und so fühlte ich mich. Befreit!
***
Diese Freiheit schien eine neue Kraft in mir entfacht zu haben. Nie war ich gut darin gewesen, andere Menschen zu trösten, und gewiss noch viel weniger darin, eine Frau zu trösten. Doch das neue Gefühl gab mir Mut. Ich erhob mich und ging um den Tisch herum zu Patricia. Dann setzte ich mich neben sie und legte meinen Arm vorsichtig um ihre Schultern. Ein leichtes Beben ging von ihr aus. Ich war wohl doch nicht so gut in meiner Bemühung, denn ihr Weinen nahm nun eindeutig noch zu. Schluchzend stieß sie einige Worte hervor.
„Ich vermisse sie so sehr. Ich hätte es ahnen müssen … hätte es verhindern müssen.“
Mein erster Gedanke war, dass wohl meine Schuldgefühle auf sie übergegangen sein mussten. Doch dann begriff ich, dass sie von Anfang an ebenso wie ich gelitten hatte. Nein, sie litt schlimmer, denn Patricia hatte Katrin ein Leben lang gekannt, während ich sie nur zwei, drei Sekunden lang lebend gesehen hatte.
Eigentlich war ich immer der Typ, der eher schwieg, wenn ihm nichts Passendes einfiel. Doch diesmal schwieg ich nicht, sondern sagte das Erste, was mir in den Kopf kam. Erst viel später begriff ich, dass ich wohl instinktiv das Richtige gesagt hatte. Auch, dass ich vom Sie zum du wechselte, war nicht einer wirklichen Überlegung entsprungen, sondern es war einfach ein Gefühl, dem ich felsenfest vertraute.
„Bitte erzähl mir von deiner Schwester“, sagte ich, hielt sie im Arm und gab ihr Zeit. Patricias Weinen beruhigte sich, dann sah sie mich leicht lächelnd an. In diesem Moment wusste ich, dass wir vielleicht in der Lage waren, uns gegenseitig zu heilen. Denn das Lächeln, das auf ihrem Gesicht lag, hatte ich tot geglaubt. Doch nun sah ich es wieder vor mir, lebendig und dennoch dankbar.
2. Kapitel
Patricia Neufelds Blick schien in die Vergangenheit zu schweifen, während sie erst zögerlich, und später immer mehr in Erinnerungen schwelgend, von ihrer Schwester erzählte.
Ich hörte ihr aufmerksam zu. Es war, als würde sie mir aus einem Buch vorlesen, das ich stets versucht hatte, zu entziffern, doch den Sinn erst richtig verstand, als ich die Zeilen aus dem Mund einer anderen Person hörte.
„Meine Schwester und ich waren schon als Kinder unzertrennlich. Sie war knapp zwei Jahre jünger als ich, aber das war nie ein Problem. Im Gegenteil – ich habe manchmal die besorgte große Schwester gespielt, während sie es mochte, sich einfach etwas quirliger zu benehmen. Zwischen Schwestern ist es nicht immer leicht. Manchmal haben wir uns natürlich gestritten, ab und zu heftig, aber das hielt nie lange an. Nicht zuletzt lag das wohl auch daran, weil wir uns gemeinsam gegen unsere Eltern wehren mussten. Versteh das bitte nicht falsch. Meine Eltern waren anständige Leute. Doch um diese Anständigkeit auch nach außen zur Schau zu stellen, waren sie oftmals sehr streng. Alles, was nach einem zu großen Vergnügen aussah, wurde uns verboten. Man sollte es im Leben zu etwas bringen, nicht einfach so in den Tag hineinleben. Als wir uns dann das erste Mal verliebten, was trotz unseres Altersunterschiedes fast gleichzeitig geschah – Gott sei Dank jedoch nicht in denselben Jungen – kam es zum richtigen Eklat zwischen unserem Vater und Katrin.
Sie war damals dreizehn, ich wurde fünfzehn. Es war nicht mehr als ein Verschossen sein. Sie war allerdings so dumm, oder vielleicht auch einfach so verliebt, dass sie ihr Glück hinausposaunte. Das konnte nicht gutgehen. Nicht bei unseren Eltern. Mein Vater musste nicht einmal brüllen, um sie zu bestrafen. Ganz leise und sanft fragte er, ob sie denn beabsichtigen würde, zu einem Flittchen zu werden. Katrin versuchte ihm klarzumachen, dass der Junge, in den sie sich verliebt hatte, nicht so einer sei. Er würde sie wirklich mögen und hätte nicht einmal versucht, sie zu bedrängen. Doch Vater lachte sie aus. Vor mir und meiner Mutter sagte er ihr eiskalt ins Gesicht, dass es für ihre Einsicht zu spät wäre, wenn der lauernde Kerl erst einmal mit der Hand in ihrem Höschen war. Dann würde sie erst wieder klar zu Verstand kommen, wenn der ‚ach so sittsame Junge’ sich keuchend von ihr wälzen würde. Einmal ein Flittchen, immer ein Flittchen. So weit würde er es nicht kommen lassen. Er hat ihr verboten, noch ein einziges Mal mit diesem Jungen Kontakt zu haben. Nachdem ich mitbekommen hatte, wie mein Vater über unsere Verliebtheit dachte, hielt ich meine eigenen Schwärmereien geheim. Nur Katrin erzählte ich davon. Wenn wir nachts in unseren Betten lagen, malten wir uns aus, wie der erste Kuss wohl sein würde. Und was mein Vater bei seiner schockierenden Rede nicht bedacht hatte, war die Tatsache, dass wir uns erst danach vorstellten, wie es wohl sein mochte, wenn einmal ein Junge seine Hand in unser Höschen schob.
Tja, ich würde sagen, da hat mein Vater einen mächtigen Fehler begangen. Aber das sollte nicht sein einziger Fehler bleiben. Wir hatten in der folgenden Zeit viel zu viel Angst, um wirklich mal eine Beziehung einzugehen. Immer war da sofort die Furcht, mein Vater könne es herausfinden, und wir wussten, dass uns dann harte Strafen drohten. Er schlug uns nicht, aber er hatte seine ganz eigene Art, uns seine Wut spüren zu lassen. Er ging dabei subtil vor. Sein Schweigen konnte sich über Tage hinziehen. Wenn er böse auf eine von uns war – und das galt auch für meine Mutter – sah er uns manchmal tagelang nicht an. Es gibt kein schlimmeres Gefühl, als nicht beachtet zu werden. Das ist härter, als geschlagen zu werden, denke ich manchmal, obwohl mir natürlich der Vergleich fehlt. Es gab Tage, da konnte man ihm einfach nichts recht machen. Heute denke ich, dass er mit sich selbst sehr unzufrieden war. Und ich hege den Verdacht, dass er ebenfalls mit meiner Mutter unzufrieden war, die ihn, statt ihm einen Sohn zu schenken, mit zwei Töchtern gestraft hatte. Wenn sie ihm wenigstens einmal die Stirn geboten hätte ... Doch das tat sie nie.
Als er vor ein paar Jahren starb, hat sie nie wieder gelacht. Still und folgsam ist sie ihm nur ein gutes Jahr später ins Grab gefolgt. Himmel, wenn ich darüber nachdenke, könnte ich schreien vor Wut! Sie hätte endlich einmal leben können. Für sich und mit uns. Katrin und ich haben versucht, sie aus ihrer Lethargie zu holen, doch es war vergeblich. Meine Mutter kannte kein anderes Leben. Und schließlich kam es so weit, dass sie die gleichen Worte wie mein Vater benutzte. Damit schob sie Katrin ein Stück näher in Richtung Abgrund, das ist mir heute klar. Vielleicht tat sie es, weil sie in Wahrheit Angst hatte. Aber das ist keine Entschuldigung für ihr vernichtendes Urteil über Katrin. Wie schon unser Vater nannte sie sie ein Flittchen … und Schlimmeres. Dabei wollten wir doch nur, dass unsere Mutter endlich ein wenig Spaß im Leben hatte; dass sie mal an sich dachte, und an Dinge, die ihr guttun würden. Aber Mutter wollte davon nichts hören. Und noch schlimmer ... Sie wurde genauso verletzend, wie unser Vater es immer gewesen war. Und genau wie er, konnte sie an Katrin kein gutes Haar lassen. Ich hatte inzwischen aufgegeben, mit unserer Mutter zu diskutieren. Aber Katrin nicht. Sie wollte unbedingt, dass Mutter sie nur einmal im Leben verstand. Es war schlimm für meine Schwester, plötzlich auch von ihr so sehr verletzt zu werden. Katrin hat sehr darunter gelitten. Es hat sie kaputtgemacht. Ich denke, es war mir damals schon klar, nachdem unsere Mutter meiner Schwester sagte, wir sollten sie endlich in Ruhe lassen. Sie sei nie eine kleine Hure gewesen wie Katrin, und sie gedenke auch jetzt keine zu werden. Sie fragte meine Schwester, ob sie denn im Leben nichts anderes könne, als an ihr Vergnügen zu denken und dem Teufel so in die Hände zu spielen. Es war, als spräche mein Vater aus seinem Grab heraus durch Mutters Mund. Als Katrin und ich später darüber nachdachten, fröstelte uns beide bei dem Gedanken.“
Ich muss zugeben, dass ich ebenfalls bei dem Gehörten eine Gänsehaut bekam. Mir war etwas unbehaglich zumute, weil ich in die geheimen Gedanken zweier pubertierender Mädchen eingeweiht wurde. Noch nie in meinem Leben war ich in einer ähnlichen Situation gewesen. Doch ich muss zugeben, dass ich ganz gebannt war. Wenn ich herausfinden wollte, warum eine Frau so verzweifelt war, ihrem Leben ein Ende zu setzen, musste ich wohl mit ihr durch diese Emotionen gehen. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, Patricia hätte mir kurz und knapp erzählt, dass Katrin unheilbar krank gewesen sei, und ich ihr lediglich ein langes Leiden erspart hätte. Doch so einfach sind die Dinge wohl nicht immer im Leben.
Patricia spürte mein Unbehagen und sah mich verlegen an.
„Es tut mir leid. Du musst dir das nicht anhören. Ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles erzähle.“
„Weil ich dich darum gebeten habe“, erklärte ich kurz.
Sie lächelte nun wieder und senkte den Blick.
„Es tut gut, von ihr zu erzählen“, sagte sie leise.
„Dann erzähl weiter“, forderte ich Patricia auf.
Und das tat sie.
„Katrin war wirklich immer sehr viel quirliger als ich. Vieles, was ich nur in meinen Gedanken auslebte, wollte sie am eigenen Leib erfahren. Es ging dabei nicht nur um Dinge der körperlichen Liebe. Es waren auch ganz harmlose Sachen, die meine Eltern trotzdem verboten hatten. So hatte sie sich einen kurzen Rock genäht, den sie manchmal in ihrer Schultasche mitnahm, um sich unterwegs heimlich hinter einem Gebüsch umzuziehen. Ich muss zugeben, dass ich sehr neidisch auf sie war. Aber ihre Beine waren ohnehin sehr viel hübscher als meine, und so hatte ich keinen Mut aufgebracht, es ihr gleichzutun, sondern die dunklen Cordhosen getragen, die meine Mutter uns regelmäßig in neuen Größen kaufte. Katrin hatte auch angefangen, Bücher zu lesen, die ein Frauenbild darstellten, das meinem Vater wohl kaum in den Kram passte. Es waren Werke von Marilyn French, Alice Walker und Susanne Kubelka. Sie las sogar Anaïs Nin. Ich habe nur mal eine kurze Passage gelesen, die mir schon die Schamesröte ins Gesicht trieb. Meine Schwester war jedoch nicht offensichtlich rebellisch. Sie wickelte ihre Bücher in Umschläge von Nesthäkchen und einem Sammelband von Hanni und Nanni. Einmal musste ich laut loslachen, als meine Mutter einer Nachbarin erzählte, dass Katrin wohl nie auch nur einen einzigen Krimi gelesen hätte, sondern immer noch Kinderbücher las, als diese meiner Schwester ihre Agatha-Christi-Sammlung vermachen wollte.
Das Lachen zu einem Husten kaschiert, konnte ich den fragenden Blick meiner Mutter besänftigen, doch als ich Katrin davon erzählte, sah sie mich entsetzt an und sagte: „Du musst dich wirklich etwas mehr zusammenreißen. Du weißt genau was passiert, wenn Vater herausfindet, mit welcher Literatur ich mich beschäftige.“
Es kam jedoch nicht dazu, und manchmal denke ich, mein Vater glaubte, wir seien nie über Jungmädchenbücher hinausgekommen. Was ihm mit Sicherheit nur recht war.