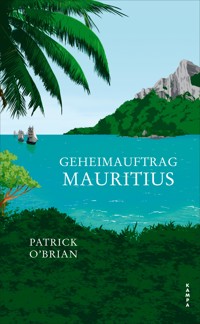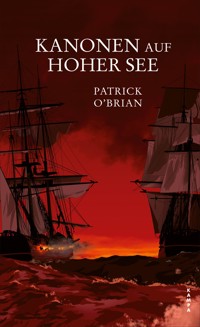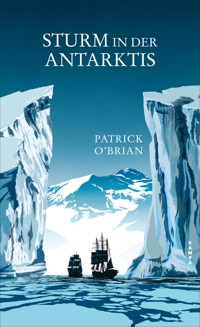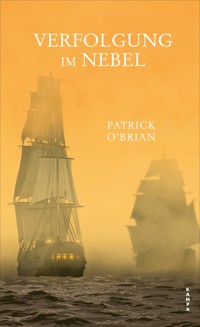
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Abenteuer von Aubrey und Maturin
- Sprache: Deutsch
Kapitän Jack Aubrey und sein bester Freund und Schiffsarzt Dr. Stephen Maturin sind in Boston nur knapp den Fängen amerikanischer und französischer Spione entkommen. Nun feiern sie zusammen mit Diana Villiers, Stephens verflossener Liebe aus alten Zeiten, an Bord der britischen HMS Shannon den Sieg über die amerikanische Chesapeake. Ein Wendepunkt im Seekrieg! Mit dem Auftrag, der britischen Regierung die frohe Botschaft zu überbringen, legen sie in Halifax ab. An Bord des Postschiffs Diligence: nicht nur Diana, schwanger von ihrem vorherigen Liebhaber, dem amerikanischen Spion Johnson, sondern auch streng geheime Papiere, die Maturin Johnson in Boston heimlich entwendet hat. Alle sehnen sich nach ihrem Zuhause: Jack Aubrey freut sich, Frau und Kinder wiederzusehen, und Stephen Maturin möchte Diana in England ein neues Leben ermöglichen. Aber das Glück ist von kurzer Dauer, denn ihr Depeschenboot wird von einem amerikanischen Schiff verfolgt. Die Diligence nimmt Fahrt auf, doch um die Eisberge der Arktischen See zieht Nebel auf – und nach England ist es noch ein weiter Weg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Patrick O’Brian
Verfolgung im Nebel
Das siebte Abenteuer für Aubrey und Maturin
Roman
Aus dem Englischen von Reiner Pfleiderer
Kampa
Mariae Sacrum
Vorwort des Autors
Große Männer können sich Anachronismen erlauben,und tatsächlich ist es recht amüsant, wenn Cressida Heiligenviten liest oder Hamlet in Wittenberg studiert. Doch vielleicht sollte sich der gewöhnliche Autor der Vergangenheit gegenüber nicht so viele Freiheiten herausnehmen. Wenn er es tut, opfert er Authentizität und Glaubwürdigkeit, und er wird gewiss Zuschriften von Lesern erhalten, deren Liebe zur historischen Genauigkeit größer ist als seine. Erst kürzlich monierte ein gebildeter Niederländer, dass in meinem letzten Buch in der Vorpiek der HMS Shannon Eau de Cologne verspritzt wird: Der früheste Nachweis für den Gebrauch des Wortes Eau de Cologne, so schrieb er, finde sich laut Oxford Dictionary in einem Brief Byrons aus dem Jahr 1830. Ich glaube, er irrt, wenn er annimmt, dass kein Engländer vor dieser Zeit von Eau de Cologne gesprochen habe. Dennoch stimmt mich sein Brief nachdenklich, und das umso mehr, als ich in dem vorliegenden Buch Sir James Saumarez in der Ostsee auftreten lasse, obwohl er bereits Monate vor der fraglichen Zeit die Victory nach Hause gebracht und seinen Abschied genommen hatte. In meinem ersten Entwurf hatte ich mich auf das Dictionary of National Biography verlassen, demzufolge der Admiral das Kommando in dem von mir gewählten Zeitraum noch innehatte. Später jedoch, als ich die Memoiren eines seiner Untergebenen zurate zog, stellte ich fest, dass in Wahrheit bereits ein anderer seinen Platz eingenommen hatte. Doch ich wollte unbedingt etwas über Saumarez sagen, denn er verkörpert meines Erachtens wie kaum ein anderer den Typus des tief religiösen, überaus fähigen und diplomatisch versierten Seeoffiziers. Und da ich die Zeitstruktur des Buches nicht mehr ändern konnte, beschloss ich, die Dinge so zu belassen, wie sie waren, strich allerdings aus einem mir selbst nicht ganz erklärlichen Gefühl des Respekts für die Victory alle Bezüge auf dieses noble Schiff. Die historische Abfolge ist daher nicht ganz korrekt, doch ich hoffe, der geneigte Leser wird mir diese kleine Freiheit gestatten.
1
Es war ein langer Sommertag, und zwei Fregatten glittenunter Toppsegeln mit der Flut in den lang gestreckten Hafen von Halifax in Neuschottland: Die erste fuhr, da sie bis vor wenigen Tagen der Kriegsmarine der Vereinigten Staaten gehört hatte, das Sternenbanner unter einer weißen Flagge, die zweite lediglich ihre eigene verblichene Flagge, denn es handelte sich um die HMS Shannon, die Siegerin in einem kurzen und blutigen Gefecht mit der Chesapeake.
Die Besatzung der Shannon hatte bereits eine ungefähre Vorstellung von dem Empfang, der sie erwartete, denn die Siegesmeldung war ihr vorausgeeilt. Dorys, Jachten, Kaperschiffe und kleine Fahrzeuge aller Art hatten sie weit draußen vor der Hafeneinfahrt erwartet und segelten nun neben ihr her, und ihre Besatzungen schwenkten die Hüte und riefen: »Bravo – hurra – gut gemacht, Shannon hurra, hurra!« Die Shannons nahmen von den Zivilisten keine große Notiz, nur die Freiwache winkte verhalten und kühl zurück. Umso mehr Notiz nahmen die kleinen Fahrzeuge von ihnen, und mochte dem flüchtigen Beobachter an der Shannon nichts Ungewöhnliches auffallen, denn die Takelage war großteils ersetzt, an die Rahen ein neues Stell Segel angeschlagen und der Anstrich mindestens ebenso schmuck wie einige Wochen zuvor, als sie aus demselben Hafen ausgelaufen war, so entgingen dem geschulten Auge der Freibeuter doch nicht die tiefen Wunden an ihrem Bugspriet und ihren Masten. Der Besan war mit Spillspaken gelascht, in der Bordwand stak noch eine Kanonenkugel, und mehrere Schusslöcher waren mit Pfropfen verstopft. Doch selbst der oberflächlichste Betrachter konnte nicht das klaffende Loch am Heck und Achterschiff der Chesapeake übersehen, wo die Shannon sie immer wieder mit vollen Steuerbordbreitseiten beharkt und ihr bei jeder Salve rund fünf Zentner Eisen in den Rumpf gejagt hatte. Natürlich sah er nicht das Blut, das bei dem schweren Gefecht vergossen worden war, das Blut, das dick durch die Speigatten gequollen war, denn die Shannons hatten beide Schiffe gesäubert und, so gut es ging, die Decks gespült. Gleichwohl konnte sich jeder, der schon einmal an einem Gefecht mitgewirkt hatte, beim Anblick von Masten, Rahen und Rumpf der Chesapeake vorstellen, dass es nach dem Gefecht auf den Schiffen wie in einem Schlachthaus ausgesehen haben musste.
Die Shannons wussten also, welch ein Empfang sie erwartete, und so waren die Männer der Freiwache bereits in ihre beste Ausgehuniform geschlüpft und trugen nun breitkrempige Hüte mit Bändern, auf denen der Name Shannon eingestickt war, hellblaue Jacken mit Messingknöpfen, weite weiße Leinenhosen mit Borten auf den Seitennähten und glänzende schwarze Halbschuhe. Dennoch staunten sie über den tosenden Lärm, der ihnen von den Piers entgegenschlug, über die Wogen der Begeisterung, die an das Schiff brandeten, und dann über den noch lauteren, noch willkommeneren und auf Kommando losdonnernden Jubel, als sie die Kriegsschiffe passierten, die im Hafen ankerten und deren Rahen und Wanten von Männern wimmelten, die wie aus einer Kehle »Shannon, hurra, hurra, hurra« riefen, sodass die Luft und die See darunter erzitterten, als die Fregatte bei Hochwasser ihren gewohnten Liegeplatz anlief. Ganz Halifax war herausgekommen, um sie zu begrüßen und ihren Sieg zu feiern, den ersten in einem Krieg, der für die Royal Navy so verheerend begonnen hatte, als nacheinander drei stolze Fregatten von den Amerikanern in Einzelgefechten aufgebracht worden waren, von den kleineren Schiffen gar nicht zu reden. Unter den Seeleuten war die Begeisterung offensichtlich am größten, und ihr tiefer Schmerz über all diese Niederlagen ließ sich an der Lautstärke ihrer heiseren Freudenschreie ermessen. Doch auch die vielen tausend Rotröcke und Zivilisten jubelten, und so war die Stimme des jungen Mr Wallis, der die Shannon befehligte, kaum zu vernehmen, als er den Befehl zum Aufgeien gab.
Doch obwohl die Shannons erfreut und erstaunt waren, blieben ihre Mienen ernst, feierlich ernst, denn ihr hochverehrter Kapitän schwebte in seiner Kajüte zwischen Leben und Tod. Zudem hatten sie auf See ihren Ersten Offizier und zweiundzwanzig Schiffskameraden bestattet, und im Lazarett, das auf das Mannschaftslogis ausgedehnt worden war, lagen neunundfünfzig Verwundete. Viele von ihnen rangen mit dem Tode, und einige gehörten zu den beliebtesten Männern auf dem Schiff.
Als der Hafenadmiral über die Seite an Bord kletterte, fand er daher nur eine spärliche Besatzung vor, herausgeputzt zwar, doch in gedämpfter Stimmung, und ein dünn bevölkertes Achterdeck, auf dem ihn nur wenige Offiziere begrüßten.
»Gut gemacht, bei Gott«, brüllte er gegen das Wimmern der Bootsmannspfeife an, das seine Ankunft meldete, »gut gemacht, Shannon.« Und dann: »Wo ist Kapitän Broke?«
»Unten, Sir«, antwortete Mr Wallis. »Verwundet, wie ich zu meinem Bedauern sagen muss. Sehr schwer verwundet, am Kopf. Er ist kaum bei Bewusstsein.«
»Oh, das tut mir leid. Teufel auch, und wie mir das leidtut! Geht es ihm sehr schlecht? Am Kopf, sagen Sie? Ist er noch bei Verstand – weiß er von seinem famosen Sieg?«
»Ja, Sir. Ich glaube, nur das hält ihn am Leben.«
»Was sagt der Arzt? Darf man zu ihm?«
»Heute Morgen wurde es mir nicht gestattet, Sir, aber ich werde jemanden hinunterschicken und mich nach seinem Befinden erkundigen.«
»Aye, tun Sie das«, sagte der Admiral. Eine Pause. »Wo ist Mr Watt?« Er meinte den Ersten Offizier, der früher als Fähnrich unter ihm gedient hatte.
»Tot, Sir«, antwortete Wallis.
»Tot«, sagte der Admiral und senkte den Blick. »Das tut mir von Herzen leid. Ein tüchtiger Seeoffizier. Hatten Sie schwere Verluste, Mr Falkiner?«
»Dreiundzwanzig Tote und neunundfünfzig Verwundete, Sir, ein Viertel der Besatzung. Aber die Chesapeake hat über sechzig Tote und neunzig Verwundete. Ihr Kapitän ist am Dienstag bei uns an Bord gestorben. Und mit Verlaub, Sir«, fügte er mit leiser Stimme hinzu, »ich heiße Wallis. Mr Falkiner führt das Kommando auf der Prise.«
»Recht so, recht so«, sagte der Admiral. »Ein blutiges Geschäft, Mr Wallis, ein grausames Geschäft. Aber es lohnt sich. Ja, bei Gott, es hat sich gelohnt.« Sein Blick glitt über das saubere, ordentliche, wenn auch von den Kampfspuren gezeichnete Deck, die Beiboote, von denen zwei bereits repariert waren, dann hinauf in die Takelage und ruhte für einen Moment auf dem gelaschten Besanmast. »Dann haben also Sie, Falkiner und die restlichen Leute mit vereinten Kräften die Schiffe hergebracht. Das haben Sie sehr gut gemacht, Mr Wallis, Sie und Ihre Kameraden. Und jetzt geben Sie mir einen kurzen, inoffiziellen Bericht von dem Gefecht. Sie werden ihn bald zu Papier bringen müssen, wenn Kapitän Broke nicht rechtzeitig auf die Beine kommt. Aber jetzt würde ich ihn gern aus Ihrem Mund hören.«
»Nun, Sir«, begann Wallis und hielt inne. Er war ein guter Soldat, aber kein Redner. Der Rang des Admirals schüchterte ihn ebenso ein wie die Anwesenheit einer Zuhörerschaft, zu der auch der einzige überlebende amerikanische Offizier gehörte, der sich noch auf den Beinen halten konnte, wenngleich auch er verwundet war. Er brachte nur eine wirre Schilderung zuwege und geriet häufig ins Stocken, doch der Admiral lauschte freudestrahlend, denn sie deckte sich voll und ganz mit dem, was er zuvor gehört hatte: Broke hatte die Chesapeake allein im Bostoner Hafen angetroffen, seine Geleitschiffe fortgeschickt und den amerikanischen Kapitän aufgefordert, herauszukommen und die Sache auf offener See auszutragen. Die Chesapeake hatte der Aufforderung Folge geleistet, was ihr zur Ehre gereichte, und dann hatten die beiden gleichwertigen Schiffe einen offenen, fairen Kampf ausgetragen, Breitseite an Breitseite und ohne jedes taktische Manöver. Nachdem die Shannon das Achterdeck des Gegners gleich in den ersten Sekunden des Gefechts schwer getroffen und die meisten amerikanischen Offiziere getötet hatte, beharkte sie die Chesapeake weiter, enterte und eroberte sie. »Und es dauerte nur fünfzehn Minuten, Sir, vom ersten bis zum letzten Schuss.«
»Nur fünfzehn Minuten, bei Gott! Das wusste ich nicht«, rief der Admiral, und nach einigen weiteren Fragen verschränkte er die Hände hinter dem Rücken und schritt, still seine Zufriedenheit auskostend, auf und ab.
Sein Blick fiel auf eine große Gestalt in der Uniform eines Kapitäns zur See, die bei den Seesoldaten stand, und er rief: »Aubrey! Na, so was, das ist doch Aubrey, so wahr ich hier stehe!« Er trat vor und streckte die Hand aus: Kapitän Aubrey klemmte sich den Hut unter den linken Arm, zog den rechten Arm aus einer Schlinge und drückte dem Admiral so herzhaft, wie es ging, die Hand. »Ich wusste doch, diesen Blondschopf kann man nicht verwechseln«, sagte der Admiral, »obwohl es Jahre her sein muss … Eine Verwundung am Arm? Ich wusste, dass Sie in Boston waren, aber wie kommen Sie hierher?«
»Ich bin entflohen, Sir«, antwortete Jack Aubrey.
»Gut gemacht«, lobte der Admiral abermals. »Dann waren Sie bei diesem großartigen Sieg also an Bord! Das ist einen Arm wert, oder zwei, bei Gott. Aber um den guten Watt tut es mir verdammt leid, und um Broke. Ich muss mit ihm reden, wenn der Arzt … Was macht Ihr Arm, ist es schlimm?« Er deutete mit dem Kopf auf die Schlinge.
»Nur eine Musketenkugel bei dem Gefecht auf der Java, Sir. Aber da kommen die Ärzte, wenn Sie mit ihnen sprechen wollen.«
»Mr Fox, wie geht es Ihnen?«, fragte der Admiral den Bordarzt der Shannon, der gerade mit einem Begleiter aus der Großluke aufgetaucht war, beide in Arbeitskleidung. »Und wie geht es Ihrem Patienten? Kann er Besuch empfangen, einen kurzen Besuch?«
»Nun ja, Sir«, antwortete Fox und wiegte skeptisch den Kopf »Wir sollten ihm in diesem Stadium jede Aufregung oder geistige Anstrengung ersparen. Stimmen Sie mir zu, Kollege?«
Sein Kollege, ein kleiner bleicher Mann mit blutbeflecktem schwarzem Rock, schmutziger Leinenhose und schlecht sitzender Perücke, antwortete ungeduldig: »Gewiss, gewiss. Solange die Arznei nicht gewirkt hat, können wir unmöglich Besucher zu ihm lassen«, und machte Anstalten, ohne ein weiteres Wort weiterzugehen.
Da fasste ihn Kapitän Aubrey am Ellbogen und raunte ihm zu: »Gemach, Stephen, das ist der Admiral.«
Stephen blickte mit seinen seltsam blassen und nach den Strapazen der letzten Tage und Nächte geröteten Augen Aubrey an und sagte: »Hör zu, Jack, ich habe eine Amputation vorzunehmen, und ich würde nicht einmal eine Pause machen, um mit dem Erzengel Gabriel zu plaudern. Ich bin nur heraufgekommen, um meinen kleinen Wundhaken aus der Kabine zu holen. Und sag dem Mann, er soll nicht so laut reden.« Damit ging er weiter, und hinter ihm flogen ängstliche Blicke, begleitet von einem nervösen Lächeln, in Richtung Admiral. Aber der große Mann war offenbar überhaupt nicht verstimmt. Sein Blick schweifte über das Schiff und dann über das Wasser hinüber zur Chesapeake, und trotz seiner unmittelbaren Sorge um den Kapitän der Shannon und ihre verwundeten Offiziere und Mannschaften war ihm die tief empfundene Freude anzusehen. Er fragte Wallis nach der Musterrolle der Kriegsgefangenen, und während sie geholt wurde, trat er mit Jack Aubrey neben eine behelfsmäßige Kappe auf dem Kajütenskylight und sagte: »Ich weiß, dass ich das Gesicht schon einmal gesehen habe. Mir fehlt nur der passende Name dazu.«
»Das ist Dr. …«, begann Kapitän Aubrey.
»Warten Sie. Ich hab’s. Saturnin – so heißt der Mann. Admiral Bowes und ich sprachen im Palast vor und erkundigten uns nach dem Befinden des Herzogs, und da kam er heraus und teilte uns mit, wie es ihm ging. Saturnin – ich wusste doch, dass es mir wieder einfällt.«
»Das ist der Mann, Sir. Stephen Maturin wurde bei der Behandlung von Prinz William hinzugezogen, und meines Wissens rettete er ihn, als alle anderen Mittel versagten. Ein hervorragender Arzt, Sir, und ein guter Freund von mir. Wir fahren seit dem Jahre zwei zusammen zur See. Doch ich fürchte, er ist mit den militärischen Umgangsformen nicht recht vertraut, und so erregt er manchmal Anstoß ohne jede böse Absicht.«
»Na ja, jedenfalls handelt er ohne Ansehen der Person, so viel steht fest. Aber ich bin keineswegs beleidigt. Ich bin nicht der liebe Gott, Aubrey, auch wenn ich den Admiralswimpel habe, und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich mir an einem solchen Tag die Laune verderben ließe – mein Gott, Aubrey, was für ein Sieg! Überdies muss er ein bedeutender Mediziner sein, wenn er zum Herzog gerufen wird. Hoffentlich rettet er den armen Broke. Ihr Diener, Madam«, rief er und blickte mit respektvoller Bewunderung auf eine ungewöhnlich elegante junge Frau, die, eine Pütz in der Hand, soeben aus der Behelfsluke aufgetaucht war, im Schlepptau einen müden, blutbespritzten Sanitätsgasten. Sie war blass, aber diese Blässe gereichte in dieser Umgebung zum Vorteil und verlieh ihr etwas Vornehmes.
»Diana«, sagte Kapitän Aubrey, »darf ich dich mit Admiral Colpoys bekannt machen. Admiral, meine Cousine, Mrs Villiers. Mrs Villiers war in Boston, Sir. Sie ist mit Maturin und mir geflohen.«
»Ihr ergebenster Diener, Madam«, lächelte der Admiral mit einer Verbeugung. »Wie ich Sie darum beneide, dass Sie einem so brillanten Gefecht beiwohnen durften.«
Diana setzte die Pütz ab, machte einen Knicks und antwortete: »Oh, Sir, ich musste die ganze Zeit unter Deck bleiben. Aber wie gern«, und ihre Augen sprühten Feuer, »wie gern wäre ich ein Mann gewesen und hätte mit den anderen zusammen das Schiff geentert.«
»Ich bin überzeugt, Sie hätten sie totgeschlagen, Madam«, sagte der Admiral. »Aber jetzt müssen Sie unbedingt bei uns Quartier beziehen. Lady Harriet wird entzückt sein. Meine Barkasse steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie sofort an Land wollen.«
»Das ist zu gütig von Ihnen, Admiral«, sagte Diana, »und ich würde Lady Harriet sehr gern meine Aufwartung machen, doch leider bin ich hier noch einige Stunden beschäftigt.«
»Das ehrt Sie, Madam«, lobte der Admiral, den ein Blick in die Pütz über die Art ihrer Beschäftigung aufgeklärt hatte. »Doch sowie Sie hier fertig sind, müssen Sie in unser Haus kommen. Aubrey, wenn Mrs Villiers hier fertig ist, bringen Sie sie in unser Haus.« Das Strahlen seines Lächelns wurde stumpf, als ein schriller, fast unmenschlicher Schmerzensschrei aus dem Lazarett erscholl und wie ein Messer in das Hurrageschrei schnitt. Doch er hatte schon viele Gefechte erlebt und kannte den Preis, der bezahlt werden musste, und so fuhr er mit kaum getrübter Laune fort: »Das ist ein Befehl, Aubrey, haben Sie verstanden?« Dann wandte er sich an den jungen Leutnant: »Wohlan, Mr Wallis, machen wir uns an die Arbeit.«
Stunden waren verstrichen. Kapitän Broke hatte man ins Haus des Commissioners gebracht, seine verwundeten Schiffskameraden ins Hospital, wo diejenigen, die nicht halb wahnsinnig waren vor Schmerzen, recht friedlich neben den verwundeten Chesapeakes lagen und manchmal Kautabak und geschmuggelten Rum tauschten. Die amerikanischen Kriegsgefangenen hatte man von ihrem Schiff geholt, die wenigen überlebenden Offiziere auf Ehrenwort entlassen und die Mannschaften in die Kaserne geschickt. Die Unglücklichsten von allen, die auf der Chesapeake gefassten britischen Deserteure, saßen im Gefängnis, das sie aller Voraussicht nach erst wieder verlassen würden, um den Gang zum Galgen anzutreten. Im Augenblick war das grausamste Gesicht des Krieges nicht mehr zu sehen. Auf der Fregatte gewannen Freude und gespannte Erwartung allmählich die Oberhand über Nachdenklichkeit und Trauer, als die Kapitäne der benachbarten Schiffe Freiwillige für die Hafenwache herüberschickten, sodass die Shannons an Land gehen konnten. Und die Fröhlichkeit der Neuankömmlinge im Verein mit den anhaltenden Jubelrufen von den Piers brachten die jüngeren Landgänger zum Lachen, als sie am Fallreep warteten und sich gegenseitig auf die Zehen traten, indessen ihre Kameraden die Boote abfierten und dabei tunlichst darauf achteten, dass sie ihre Segeltuchhosen nicht mit Teer beschmutzten.
»Cousine Diana«, sagte Jack Aubrey, »willst du an Land? Ich könnte die Kommandantengig der Tenedos anpreien.«
»Danke, Jack«, antwortete sie, »aber ich warte lieber auf Stephen. Er wird nicht mehr lange brauchen.« Sie saß auf einem kleinen grünen Schrankkoffer mit Messingbeschlägen, dem einzigen Gegenstand, den sie bei ihrer überstürzten Flucht aus Boston mitgenommenen hatte, und spähte über eine zerstörte Neunpfünderkanone hinweg nach Halifax. Jack stand neben ihr, einen Fuß auf der Lafette, und blickte ebenfalls zur Stadt, allerdings nur mit sehr oberflächlichem Interesse, denn mit seinen Gedanken war er woanders. Sein ganzes Wesen war von tiefer Freude erfüllt, denn obwohl nicht er diesen Sieg errungen hatte, so war er doch mit Leib und Seele Seeoffizier und identifizierte sich seit seiner Kindheit mit der Royal Navy. Die Niederlagenserie im letzten Jahr hatte ihn so bedrückt, dass er es kaum hatte ertragen können. Jetzt war er erleichtert: Die beiden ebenbürtigen Schiffe hatten einen fairen Kampf ausgefochten, und die Royal Navy hatte gesiegt. Die in ihren Grundfesten erschütterte Welt war wieder in Ordnung. Die Sterne zogen wieder ihre natürliche Bahn, und sobald er in England eintraf, bekam er höchstwahrscheinlich das Kommando über die mit vierzig Kanonen bestückte Acasta, was dazu beitragen würde, sie in noch natürlichere Bahnen zu lenken. Und sobald er an Land war, würde er zur Post eilen und seine Briefe abholen: Während seiner Gefangenschaft in Boston hatte er von Sophia, seiner Frau und Dianas leiblicher Cousine, nichts gehört, und er sehnte sich nach einer Nachricht von ihr, brannte darauf zu erfahren, wie es den Kindern ging, was seine Pferde, der Garten, das Haus machten … Doch da war auch eine Sache, die ihm Sorgen bereitete, und keine geringen. Obwohl er ein ungewöhnlich reicher Kommandant war und mehr Prisengelder verdient hatte als die meisten Kapitäne seines Dienstalters, sogar mehr als die meisten Admirale, hatte er seine geschäftlichen Angelegenheiten doch in einem höchst komplizierten Zustand zurückgelassen, dessen Entwirrung von der Ehrlichkeit eines Mannes abhing, dem weder Sophia noch sein Freund Maturin über den Weg trauten. Dieser Mann, ein gewisser Kimber, hatte ihm versichert, dass sich in den stillgelegten Bleiminen auf seinem Land nicht nur mehr Blei fördern, sondern nach einem Verfahren, das nur ihm bekannt sei, auch eine erstaunliche Menge an Silber gewinnen ließe, und dass seine Investitionen folglich eine überaus stattliche Rendite abwerfen würden. Doch in den letzten Briefen, die er vor seiner Rückreise nach England und seiner Gefangennahme durch die Amerikaner im fernen Ostindien von Sophia erhalten hatte, war von Profit und Rendite nicht mehr die Rede gewesen, nur noch von undurchsichtigen Machenschaften des eigenmächtigen Kimber, von umfangreichen Neuinvestitionen in Straßen, Minenanlagen, eine Dampfmaschine, Schächte … Er musste Klarheit haben, und er war recht zuversichtlich, dass er sie auch bekommen würde, denn im Unterschied zu Sophia und Stephen Maturin, die nichts vom Geschäft verstanden und nur ihrer Intuition folgten, hatte er sich seine Meinung auf der soliden Grundlage von Fakten und Zahlen gebildet. Überhaupt kannte er die Welt weit besser als sie. Noch mehr aber sehnte er sich nach Nachricht von seinen Kindern, seinen beiden Zwillingstöchtern und seinem kleinen Sohn – George musste inzwischen zu sprechen begonnen haben. Der Wunsch nach Neuigkeiten hatte ihm während der Gefangenschaft am meisten zu schaffen gemacht, denn nicht ein einziger Brief war durchgekommen. Und am meisten sehnte er sich danach, Sophias Handschrift zu sehen und gleichzeitig ihre Stimme zu hören: Ihre letzten Briefe, die noch aus der Zeit vor dem Krieg mit den Vereinigten Staaten datierten, hatten ihn auf Java erreicht, und er hatte sie so oft gelesen, dass sie in den Falten brachen. Immer wieder hatte er sie gelesen, bis er sie mit nahezu seiner gesamten Habe auf See verloren hatte. Seitdem kein Wort mehr. Vom hundertundzehnten Grad östlicher Länge bis zum sechzigsten Grad westlicher Länge, eine Fahrt beinahe um die halbe Welt, und nicht ein einziges Wort. Das war Seemannslos, das wusste er. Auf die Postschiffe und all die anderen Transportmittel war kein Verlass, und dennoch fühlte er sich vom Schicksal bisweilen schlecht behandelt.
Vom Schicksal im Allgemeinen, nicht von Sophia, denn ihre Ehe, die fest in tiefer Zuneigung und gegenseitigem Respekt wurzelte, war besser als die meisten. Und wenn sie einen Mann mit Jack Aubreys ausgeprägten animalischen Instinkten auch nicht in jeder Hinsicht restlos zufriedenstellte und man sogar sagen konnte, dass Sophia etwas Besitzergreifendes hatte, gewissermaßen zu krankhafter Eifersucht neigte, so war sie doch ein fester Bestandteil seines Lebens. Sophia war ebenso wenig ohne Fehler wie er, ja in gewissen Augenblicken neigte er sogar der Ansicht zu, dass seine Fehler verzeihlicher waren als ihre. Doch dies alles war sogleich vergessen, wenn er vor seinem geistigen Auge das Bündel Briefe sah, das ihn jenseits der glatten See in Halifax erwartete.
»Sag mir, Jack«, sagte Diana, »Sophia hatte es wohl nicht leicht mit ihrem letzten Baby?«
»Wie?«, rief Jack, aus seinen Gedanken aufgeschreckt. »Nicht leicht mit George? Ich hoffe nicht … nein, das hoffe ich wirklich nicht. Sie erwähnte jedenfalls nichts dergleichen. Ich war die ganze Zeit auf Mauritius. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass es manchmal sehr schwer ist.«
»Ich habe so etwas gehört«, sagte Diana, und nach einer Pause: »Da kommt Stephen.«
Ein paar Minuten später lag das Boot längsseits, und sie nahmen Abschied, mehr von der Shannon als von ihren Menschen, die sie später an Land bei den Siegesfeiern wiedersehen würden – der Admiral hatte bereits von einem Ball gesprochen. Diana lehnte den Bootsmannsstuhl ab, den Wallis ihr anbot, und kletterte so behände und flink wie ein Junge hinter Stephen hinunter. Die Bootsgasten blickten stur auf die offene See hinaus, um ja nicht ihre Beine zu sehen, doch sie rief den Männern an Deck zu, dass sie ihren Koffer mit größter Vorsicht behandeln sollten: »Das ist meine ganze Habe, meine ganze bescheidene Habe«, erklärte sie und lächelte nach oben in Mr Wallis’ entzücktes Gesicht.
Sie bildeten eine merkwürdige Gruppe in der Achterplicht des Bootes, das an Land gepullt wurde, eine Gruppe, die durch starke, komplizierte Beziehungen verbunden war. Denn nicht nur, dass die beiden Männer in der Vergangenheit um ihre Gunst gewetteifert hatten, sodass ihre Freundschaft beinahe darüber zerbrochen wäre, Diana war auch Stephens große Liebe gewesen. Sie hatte ihn in Indien sitzenlassen und eine Affäre mit einem Amerikaner begonnen, einem sehr wohlhabenden Mann namens Johnson, dessen Gesellschaft ihr jedoch nach ihrer Ankunft in Amerika immer lästiger und nach der Kriegserklärung schlicht unerträglich geworden war.
Maturin traf sie als Kriegsgefangener in Boston wieder, und obwohl er ihren Mut und ihre Schönheit noch immer bewunderte, stellte er fest, dass seine Gefühle für sie erkaltet waren. Welche Veränderungen bei ihr oder bei ihm selbst dafür verantwortlich waren, vermochte er nicht genau zu sagen, aber er wusste, dass er den Hauptantrieb seines Lebens verlieren würde, wenn sein Herz nicht mehr fühlen konnte. Dennoch waren sie zusammen geflohen und hatten die Shannon in einem Boot erreicht. Und sie hatten sich verlobt. Stephen fand, dass sie Anspruch auf diese Verlobung hatte, selbst wenn sie nur ein Mittel war, ihr zu ihrer alten Staatsangehörigkeit zu verhelfen. Und zu seinem Erstaunen schien sie diese Verlobung sogar zu begrüßen, obwohl er sie bislang für eine Frau gehalten hatte, die sich wie keine andere auf ihre Intuition verlassen konnte. Tatsächlich wären sie bereits Mann und Frau, wenn es nicht zu dem Gefecht gekommen wäre, zwar nicht in den Augen der katholischen Kirche (denn Maturin war Papist), aber doch nach englischem Recht, denn Philip Broke hatte zugesagt, von seinen Befugnissen als Kapitän Gebrauch zu machen und sie auf See zu trauen, und Diana wäre jetzt offiziell wieder britische Staatsbürgerin und keine Amerikanerin mehr.
Trotz dieser unterschwelligen Gefühle plauderten sie auf dem gesamten Weg zur Anlegestelle und zum Haus des Admirals ruhig und vergnügt miteinander und trennten sich dort wie alte Freunde, Jack, um dem Commissioner Bericht zu erstatten und anschließend seine Post abzuholen und sich nach einer Unterkunft umzutun, und Stephen mit unbekanntem Ziel, unter dem Arm ein in Segeltuch eingeschlagenes Paket, sein einziges Gepäckstück, während Diana bei der kurzbeinigen, freundlichen Lady Harriet Colpoys blieb.
Stephen sagte nicht, wohin er ging, doch jeder seiner Begleiter hätte es ohne große Mühe erraten können. Kapitän Aubrey hatte im Verlauf ihrer langen gemeinsamen Dienstzeit zwangsläufig davon Kenntnis erhalten, dass Dr. Maturin nicht nur ein hoch angesehener Mediziner war, der deshalb als Schiffsarzt zur See fuhr, weil er dabei Gelegenheit für seine naturkundlichen Forschungen fand (seine größte Passion nach seinem Wunsch, Bonaparte zu stürzen), sondern auch einer der besten Geheimagenten der Admiralität. Und Diana war Zeugin gewesen, wie Stephen unmittelbar vor ihrer Flucht die Papiere, die sein Paket jetzt enthielt, aus dem von ihr und Mr Johnson bewohnten Zimmer in Boston entwendet hatte, wobei er sein Tun damit begründet hatte, dass sie einen Nachrichtenoffizier interessieren würden, den er zufällig in Halifax kenne. Stephen war sich all dessen völlig bewusst, doch aus alter Gewohnheit wahrte er Verschwiegenheit, denn äußerste Diskretion, der allein er es verdankte, dass er überhaupt noch am Leben war, war ihm zur zweiten Natur geworden. Und so begab er sich auf Umwegen zum Büro seines Kollegen und blickte in Schaufenster, bevorzugt in solche, in denen sich die Straße hinter ihm spiegelte. Eine übliche Vorsichtsmaßnahme, doch hier war sie besonders angebracht, denn er wusste besser als jeder andere in Halifax, dass mehrere amerikanische Agenten in der Stadt operierten. Und aus Wut über den Verlust seiner Papiere und seiner Geliebten würde Johnson gewiss außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um sich zu rächen.
Er erreichte das Büro gut gelaunt, ohne dass ihm jemand gefolgt war, nannte seinen Namen und wurde von Major Beck, dem Nachrichtenoffizier der nordamerikanischen Station, unverzüglich empfangen. Sie waren einander nie begegnet, und Beck musterte ihn mit lebhafter Neugier: Dr. Maturin genoss einen hervorragenden Ruf. Er war einer der wenigen Agenten, die nicht nur auf absolut freiwilliger Basis arbeiteten, sondern auch durch herausragende Leistungen glänzten. Und obwohl Maturin aufgrund seiner irisch-katalanischen Abstammung in erster Linie Experte für katalanische Angelegenheiten war, wusste Beck, dass der Doktor unlängst das Kunststück vollbracht hatte, mit gefälschtem, kompromittierendem Material, das die Amerikaner in gutem Glauben Paris zugespielt hatten, die Reihen des französischen Geheimdienstes zu lichten. Da dies Becks eigenen Tätigkeitsbereich berührte, war er davon offiziell unterrichtet worden, doch auf inoffiziellem Wege hatte er auch von anderen, ebenso bemerkenswerten Bravourstücken in Spanien und Frankreich erfahren, und jetzt stellte er fest, dass er unsinnigerweise enttäuscht war von dem schmächtigen, schäbig gekleideten, unscheinbaren Mann, der ihm am Schreibtisch gegenübersaß und bedächtig ein Segeltuchbündel auswickelte. Wider alle Vernunft hatte Beck eine heroischere Gestalt erwartet, und ganz gewiss keinen Mann, der zum Schutz vor der Sonne eine blaue Brille trug.
Stephens Einschätzung seines Gegenübers war ebenso wenig schmeichelhaft. Er stellte fest, dass Beck ein seltsam hässlicher Kerl war mit wässrigen Glotzaugen, schütterem rotblondem Haar, ohne Kinn, einem vorspringenden Adamsapfel und, trotz einer intelligenten Stirn, mit dem biederen Aussehen eines Mannes, der schwer einzuordnen war. »Ob wir alle so verunstaltet sind«, überlegte Stephen und dachte an einige andere Kollegen.
Sie sprachen eine Weile über den Sieg, wobei Beck so in Verzückung geriet, dass sein ungesundes gelbes Gesicht Farbe bekam, während Stephen unablässig abstritt, nähere Kenntnis von dem Gefecht zu haben: Er sei vom ersten bis zum letzten Schuss unter Deck gewesen und könne folglich weder über den Verlauf berichten noch Angaben dazu machen, wie viele britische Deserteure auf dem amerikanischen Schiff gedient hätten oder wie man sie abgeworben habe. Beck schien enttäuscht.
»Ich erhielt Ihre Warnung vor den Franzosen in Boston«, sagte Stephen, während er mit dem Knoten kämpfte, »und möchte Ihnen dafür meinen Dank aussprechen. So konnte ich ihnen besser vorbereitet gegenübertreten.«
»Sie hatten doch hoffentlich keine Unannehmlichkeiten, Sir? Durand gilt als äußerst skrupelloser, energischer Offizier.«
»Pontet-Canet war schlimmer, ein übereifriger, lästiger Kerl, der mir eine Weile wirklich das Leben schwermachte. Doch ich habe ihm ein Ende um die Klampe gelegt.« Dr. Maturin war stolz auf seine seemännischen Ausdrücke, und bisweilen verwendete er sie sogar korrekt. Doch ob korrekt oder nicht, jedes Mal schwang eine leichte Genugtuung in seiner Stimme, wie bei anderen, wenn ihnen ein besonders passendes griechisches oder lateinisches Zitat einfällt. »Und mit einem Rundtörn gestoppt«, fügte er hinzu. »Hätten Sie vielleicht ein Messer? Es lohnt sich nicht, diese Schnur zu retten.«
»Und wie haben Sie das angestellt, Sir?«, fragte Beck und reichte ihm eine Schere.
»Ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten«, antwortete Maturin und kappte die Schnur. Major Beck war an Blutvergießen im offenen und geheimen Krieg gewöhnt, doch der alltägliche, undramatische Ton seines Besuchers jagte ihm einen Schauder über den Rücken, und das umso mehr, als Maturin just in diesem Augenblick die Brille abnahm und ihn aus seinen ausdruckslosen blassen Augen ansah, die das einzig Bemerkenswerte an ihm waren.
»Nun denn, Sir«, sagte Stephen, als die Schriftstücke ausgewickelt waren. »Ich nehme an, dass Sie über Mr Harry Johnsons Rolle im amerikanischen Nachrichtendienst im Bilde sind?«
»Oh, durchaus.« Wie hätte Beck über das Treiben seines gefährlichsten Gegenspielers in Kanada nicht im Bilde sein können: Seit seinem Amtsantritt kämpfte er gegen Johnsons glänzend organisierten und bestens ausgerüsteten Agentenring.
»Ausgezeichnet. Diese Papiere stammen aus seinem Schreibtisch und seiner Stahlkassette in Boston. Die Franzosen studierten sie, als ich ihren Machenschaften ein Ende bereitete.« Er legte sie nacheinander auf den Schreibtisch des Majors: eine kommentierte Liste der in Kanada und Westindien operierenden amerikanischen Agenten; Codes, die bei verschiedenen Anlässen benutzt wurden; Briefe an den Außenminister mit einem detaillierten Bericht über die früheren und gegenwärtigen Beziehungen zwischen dem französischen und amerikanischen Nachrichtendienst; Notizen über Charakter, Fähigkeiten und Absichten seiner französischen Kollegen; Pläne für künftige Operationen; einen umfassenden Bericht über die Position der Briten an den Großen Seen …
Zu dem Zeitpunkt, als das letzte Dokument auf dem Tisch lag, hatte Dr. Maturin die heroische Größe, die von ihm erwartet worden war, erreicht und sogar übertroffen. Major Beck betrachtete den Stapel Papiere mit tiefem, an Ehrfurcht grenzendem Respekt. »Das ist der größte Fischzug«, sagte er, »von dem ich je gehört habe. Sie haben gründlich abgeräumt, bei Gott! Allein die erste Liste wird die Exekutionskommandos wochenlang auf Trab halten. Ich muss den ganzen Berg durcharbeiten. Das wird meine Bettlektüre für viele Nächte sein.«
»Nicht diese Dokumente, Sir, wenn Sie erlauben, Sir Joseph und seine Kryptographen müssen sie erhalten …« Der Major verneigte sich bei Sir Josephs Namen, »… und ich schlage vor, dass wir den größten Teil mit dem nächsten geeigneten Schiff nach London schicken. Abschriften selbstverständlich, obwohl auch das gewisse Probleme aufwirft, wie Sie ja selber wissen. Doch bevor wir über die Herstellung von Kopien oder etwas anderem sprechen, habe ich ein Anliegen vorzubringen, ein Anliegen und eine Bitte. Kennen Sie Mrs Villiers?«
»Diana Villiers, Johnsons Geliebte, die abtrünnige Engländerin?«
»Nein, Sir«, entgegnete Stephen mit kaltem, starrem Blick. »Nein, Sir. Mrs Villiers war nicht Johnsons Geliebte. Sie nahm lediglich seinen Schutz in einem fremden Land in Anspruch. Und sie ist auch keineswegs eine Abtrünnige. Nicht nur, dass sie eine heftige Meinungsverschiedenheit hatten, als er versuchte, sie für den Krieg gegen ihr eigenes Land zu gewinnen, ihr haben wir es auch zu verdanken, dass ich in den Besitz dieser Dokumente gelangt bin. Ich kann nicht dulden, dass abfällig über sie gesprochen wird.«
»Nun, Sir«, entgegnete Beck nach kurzem Zögern, »ich kann mich natürlich irren, und ich will der Dame auch in keinster Weise zu nahe treten, doch wie es scheint, hat sie die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen.«
»Das war ein unüberlegter Schritt. Sie sah darin eine bloße Formalität, die ihre natürlichen patriotischen Gefühle nicht im Geringsten berührte. Man machte sie glauben, der Vorgang würde Mr Johnsons Scheidung beschleunigen.« Stephen bemerkte ein gewisses Mitgefühl oder gar konspiratives Einverständnis im Blick des Majors. Er runzelte die Stirn und fuhr in kühlerem Ton fort: »Da sie formal eine feindliche Ausländerin ist, Sir, möchte ich bemerken – möchte ich der wohlüberlegten Meinung Ausdruck verleihen, dass die übliche Bescheinigung für sie ausgestellt werden sollte, wie für einen unserer Leute, obschon ich bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen muss, dass sie wenig oder nichts über meine Verbindung zum Department weiß. Ich habe sie hierhergebracht, und so wäre es, von allen anderen Erwägungen einmal abgesehen, unschicklich, sie zu belästigen oder in irgendeiner Weise zu behelligen.«
»Sofort, Sir«, sagte Major Beck und läutete. »Ich bin froh, dass Sie das angesprochen haben. Mein Assistent Archbold hätte sie bestimmt noch vor Einbruch der Nacht in Gewahrsam genommen. Wir haben eine ganze Anzahl von Frauen hier – wenngleich die fragliche Dame natürlich einer ganz anderen Kategorie angehört.« Major Becks Assistent trat ein, ebenfalls ein hässlicher Kerl, dessen Äußeres eher noch mehr von dieser undefinierbaren, verborgenen Verunstaltung hatte, jedoch auf ein weit geringeres Mass an Intelligenz schließen ließ. »Mr Archbold«, sagte der Major, »eine X-Bescheinigung auf den Namen Mrs Villiers, wenn ich bitten darf.« Das Papier kam, Beck versah es mit seinem Dienststempel und seiner Unterschrift und reichte es über den Tisch mit den Worten: »Gestatten Sie mir die Bemerkung, Sir, dass dieses Dokument nur in meinem Zuständigkeitsbereich Gültigkeit hat. Bei einer eventuellen Rückkehr nach England hat die Dame größere Unannehmlichkeiten zu gewärtigen.«
Stephen hätte erwidern können, dass er dem vorzubeugen gedachte, indem er Diana heiratete und somit wieder zur britischen Staatsbürgerin machte, doch er zog es vor, diese Absicht für sich zu behalten. Er war sehr müde, müde und erschöpft von den ungewöhnlichen Strapazen auf der Flucht und dem nahezu pausenlosen ärztlichen Einsatz auf beiden Schiffen seit dem Gefecht. Er gab daher keine Antwort, und nach kurzem Schweigen fragte Beck: »Wollten Sie nicht eine Bitte äußern, Sir?«
»Ja. Könnten Sie den Zahlmeister ermächtigen, einen Wechsel auf mein Londoner Bankhaus zu akzeptieren? Ich benötige dringend Geld.«
»Aber ich bitte Sie, Dr. Maturin«, rief Major Beck, »in Geldangelegenheiten werden Sie sich doch nicht mit dem Zahlmeister und seinen siebeneinhalb Prozent herumärgern. Wozu der Papierkrieg? Ich verfüge über Mittel, die mich in den Stand setzen, jedes Problem dieser Art umgehend zu beheben. Sie sind für die Beschaffung von Informationen gedacht, und für jedes einzelne dieser Schriftstücke hier könnte ich mit Fug und Recht …«
»Sie sind zu gütig, Sir«, unterbrach Stephen, »doch ich muss Ihnen sagen, dass ich von Anfang an, seit ich mit dem Department zusammenarbeite, niemals auch nur einen Penny für meine bescheidenen Dienste angenommen habe. Nein. Eine Anweisung an den Zahlmeister würde vollauf genügen, wenn Sie freundlichst die Güte haben wollen. Und vielleicht könnten Sie mir ein paar diskrete, kräftige Männer mit auf den Weg geben: Die Grenze ist nicht allzu weit, und bis Sie sich der Agenten auf Johnsons Liste angenommen haben, sollte ich in Halifax besser nicht alleine auf die Straße gehen.«
Einen diskreten, einsachtzig großen Mann vor sich, einen anderen hinter und einen dritten neben sich ging Stephen zur Kanzlei des Zahlmeisters, wickelte dort sein Geschäft ab und trat mit einem beruhigenden Bündel in der Tasche wieder ins Freie. Er verharrte eine Weile nachdenklich, dann machte er, gefolgt von seinem Begleiter, ein paar zaghafte Schritte die Straße hinunter und blieb an einer Ecke abermals stehen. »Ich bin auf Grund gelaufen«, sagte er.
»Sir?«, sagte sein Schutzengel.
»Ich bin auf Grund gelaufen. Ich weiß nicht, wo ich wohne.«
Die Stadt war wie ausgestorben, da jeder, der abkömmlich war, unten am Hafen weilte und die Shannon und die Chesapeake begaffte, und so gaben sich die beiden anderen Männer alle Mühe, möglichst unauffällig zu bleiben, schlenderten lässig durch die menschenleere Straße und zogen ein gleichgültiges Gesicht. Bald aber fingen sie ein Nicken ihres Kollegen auf und eilten zu ihm an die Ecke.
»Der Gentleman«, sagte er, »weiß nicht, wo er wohnt.«
Sie sahen Stephen an. »Vielleicht hat er den Namen seines Gasthofes vergessen«, vermutete einer.
»Haben Sie den Namen Ihres Gasthofes vergessen, Sir?«, fragte der erste Mann und beugte sich beim Sprechen zu Stephens Ohr.
Stephen fuhr sich gedankenverloren mit der Hand über das stoppelige Kinn und versuchte, sich zu konzentrieren.
»Wahrscheinlich wohnt er im Bailey«, sagte ein anderer. »Dort werden die Herren Ärzte meistens untergebracht.«
»Ist es das Bailey, Sir?«, fragte der Erste und beugte sich wieder hinüber.
»Im White? Im Brown? Im Goat and Compasses?«, fragten die anderen, allerdings ihren Begleiter, nicht Dr. Maturin selbst.
»Ich hab’s«, rief Stephen. »Ich habe die Lösung. Könnten Sie mich bitte dorthin bringen, wo die Offiziere ihre Post erhalten?«
»Dann müssen wir uns aber sputen«, sagte der erste Mann. »Wir müssen sogar rennen, Sir. Sonst schließen sie.« Und ein paar Minuten später und ein paar Hundert Meter weiter rief er keuchend: »Da, wie ich befürchtet hatte. Die Läden sind bereits geschlossen.«
Die Läden waren geschlossen, doch die Tür stand einen Spalt offen, und selbst wenn sie fest zu gewesen wäre, hätte Kapitän Aubreys kräftige, seetüchtige Stimme weit in die Straße hinaus gehallt. »Was zum Teufel soll das heißen, Dienstschluss, du faule Mastbacke?«, fragte er. »Zum Donnerwetter noch mal …«
Stephen stieß die Tür auf, und der Lärm schwoll an. Jack hielt einen jungen Mann an der Hemdkrause, schüttelte ihn kräftig durch und schimpfte ihn einen »gemeinen Hurensohn«.
Die Hemdkrause löste sich, und Jack rief Stephen zu: »Er sagt, es sei bereits nach Dienstschluss.«
»Es ist nicht nur das, Sir«, sagte der Beamte zu Stephen wie zu seinem Retter aus höchster Not, »Mr Gittings hat die Schlüssel. Im Fach liegt nichts, und ohne Schlüssel kann ich die Kassette nicht öffnen, das leuchtet doch ein.« Er wischte sich mit dem Ärmel die Tränen ab und setzte hinzu: »Außerdem haben wir nichts für Kapitän Aubrey, darauf kann ich Ihnen mein heiliges Ehrenwort geben. Wir sind bemüht, jedem Gentleman, der uns höflich behandelt, gefällig zu sein.«
Stephen betrachtete die Stahlkassette. Es war ein veraltetes Modell und hatte ein gewöhnliches Schloss mit einer Zuhaltung, das seinen Überredungskünsten kaum länger als ein paar Minuten widerstanden hätte, doch das war weder der rechte Ort noch die rechte Zeit für eine Demonstration seiner Talente.
»Ich bin froh, Sie hier zu finden, Kapitän Aubrey«, sagte er. »Mir ist nämlich der Name unseres Gasthauses entfallen, und ich bin todmüde. Ich würde alles für ein Bett geben.«
»Sie sehen wirklich recht mitgenommen aus«, sagte Jack und ließ die Hemdkrause los. »Fix und fertig. Wir wohnen im Goat, ich bringe Sie gleich hin. Hören Sie, Sir«, sagte er zu dem Beamten in einer letzten Aufwallung von Wut und Enttäuschung, »morgen bin ich in aller Frühe wieder hier, verstanden?«
Auf der Straße dankte Stephen seiner Eskorte, entließ sie mit den besten Empfehlungen an Major Beck und ging mit Jack alleine weiter.
»Ein verdammt elender Nachmittag«, sagte Jack. »Enttäuschungen auf Schritt und Tritt – wahrlich ein heldenwürdiger Empfang. Die Stadt ist vollgepfropft mit Soldaten, und ich konnte nur ein Zimmer im Goat bekommen, eines für uns beide.«
»Wie dumm«, sagte Stephen, der schon des Öfteren eine Kajüte mit Kapitän Aubrey geteilt hatte, dem vielleicht lautesten Schnarcher in der Kriegsmarine.
»Und als ich auf dem Hügel Bericht erstatten wollte, war der Commissioner nicht da. Eine Menge Leute warteten auf ihn. Wir plauderten eine Weile, und dabei erfuhr ich ein paar höchst unerfreuliche Neuigkeiten. Harte sitzt wieder in der Admiralität, und diesen Wray haben sie kommissarisch zum Zweiten Sekretär ernannt.«
»Heilige Mutter Gottes«, dachte Stephen bei sich, und das mit gutem Grund: Auf Menorca hatte Jack als flotter Junggeselle Harte wiederholt Hörner aufgesetzt, und gehörnte Ehemänner waren gewöhnlich sehr nachtragend. Zudem hatte er Wray, der schon damals einen hohen Regierungsposten bekleidete, öffentlich und zu Recht des Betrugs beim Kartenspielen bezichtigt. Wray hatte damals darauf verzichtet, den Vorwürfen in geziemender Weise entgegenzutreten, doch es war kaum damit zu rechnen, dass er sie für immer auf sich sitzen ließ.
»Ich wartete so lange, wie ich konnte, doch dann, als ich im Laufschritt das Büro erreichte – und in meinem Alter ist Laufschritt auch nicht mehr das, was es einmal war, Stephen, das kann ich dir sagen –, die nächste Enttäuschung. Ein verdammt elender Nachmittag.«
»Na, Ehemann«, sagte eine hübsche Dirne im Dämmerlicht. »Komm mit, dann bekommst du einen Kuss.«
Jack lächelte, schüttelte den Kopf und ging weiter. »Ist dir aufgefallen, dass sie mich Ehemann genannt hat?«, fragte er nach ein paar Schritten. »Das tun sie häufig. Schätze, die Ehe ist ein natürlicher Zustand, und das macht es weniger – weniger verwerflich.«
Das Wort Ehe erinnerte Stephen daran, dass er eigentlich die Absicht gehabt hatte, mit Becks Bescheinigung, diesem unerlässlichen Dokument, einen Geistlichen aufzusuchen und alles für seine Vermählung mit Diana zu regeln, doch im Augenblick konnte er sich kaum noch auf den Beinen halten. Die ganze Müdigkeit der letzten Tage senkte sich nun, da die pausenlose Anspannung vorüber war, wie undurchdringlicher Nebel über ihn. Nur sein Widerspruchsgeist war noch wach. »Ganz und gar nicht«, sagte er. »Im Gegenteil, wie einer eurer großen Männer im letzten Jahrhundert bemerkt hat: Das Zusammenleben von Mann und Frau im Stand der Ehe ist alles andere als natürlich, denn es hat sich gezeigt, dass all die Gründe, die für eine Beibehaltung dieses Bundes sprechen, und all die Beschränkungen, die zivilisierte Gesellschaften auferlegen, um eine Trennung zu verhindern, kaum ausreichen, um Mann und Frau zusammenzuhalten.«
»Horch mal!«, sagte Jack und blieb stehen.
Unten am Hafen hatte eine Kapelle »Heart of Oak« angestimmt, und eine große Menschenmenge sang entweder den Text oder jubelte. Rauch und der rötliche Schein von Fackeln schwebten über den Dächern, und plötzlich kamen die Flammen selbst in Sicht und überquerten die Straße am anderen Ende – eine inoffizielle Prozession von Seeleuten und Zivilisten, die hüpfend und springend den schmalen Durchgang passierten. Von allen Seiten strömten Menschen herbei und schlossen sich ihnen an, darunter auch die schöne Dirne.
Aubreys Miene hellte sich auf. »Das gefällt mir schon besser«, sagte er gut gelaunt. »So empfängt man Helden. Mein Gott, Stephen, ich bin so glücklich, sieht man einmal von diesen kleinen Ärgernissen ab. Und morgen, wenn ich Sophias Briefe in Händen halte, werde ich noch glücklicher sein. Hör mal. Da schmettert noch eine Kapelle.«
»Ich habe nur einen Wunsch«, sagte Stephen. »Sie sollen ihre Helden gefälligst in erträglicher Entfernung vom Goat feiern – und nicht im Umkreis von einer Achtelmeile um den Gasthof aufspielen. Aber weiß Gott, wahrscheinlich könnte ich auch schlafen, wenn zehn Kapellen auf dem Korridor spielten.«
Sie hätten gut dort spielen können, oder zumindest vor dem Fenster, denn die Shannons feierten ihren Sieg mit derselben Hingabe, mit der sie ihn errungen hatten, und bis zum Morgengrauen und darüber hinaus erbebte Halifax unter ihrem ausgelassenen Gelächter. Doch Dr. Maturin schlief wie ein Stein, bis ein Sonnenstrahl durch seine Bettvorhänge stach und ihn wachkitzelte. Er fühlte sich körperlich herrlich schlapp und vollkommen behaglich, geistig ausgeruht, ruhig und entspannt. Er wäre dem Sonnenstrahl ausgewichen und liegen geblieben, um seinen Gedanken nachzuhängen, und vielleicht wäre er sogar wieder eingedöst, hätte er nicht ein gekünsteltes Husten vernommen, das Husten eines Mannes, der seinen Stubenkameraden nur ungern weckt, ihn jedoch von seiner Gegenwart in Kenntnis setzen will, wenn der Weckruf längst verklungen ist.
Er schob die Vorhänge auseinander und fing Jacks Blick auf, einen überraschend finsteren Blick. Jack stand am Fenster und wirkte unnatürlich groß, größer noch als sonst, und Stephen schrieb dies dem Umstand zu, dass er die Schlinge abgenommen hatte und der Arm, der an der Seite hing, seine Proportionen veränderte. Er schenkte Stephen ein Lächeln, wünschte ihm einen guten Morgen, oder vielmehr einen guten Tag, und sagte: »Ich habe Post für dich.« Stephen überlegte einen Moment. Jacks bedrückte Miene mochte damit zusammenhängen, dass er einen breiten Trauerflor am Arm trug, aber da war noch etwas anderes. »Wie spät ist es?«, fragte er.
»Kurz nach Mittag, und ich muss weg«, antwortete Jack und reichte ihm einen kleinen Stapel Briefe.
»Du bist bestimmt schon sehr lange auf«, sagte Stephen. Er sah ohne großes Interesse den Stapel durch.
»Ja. Ich war in dem gottverdammten Büro, gleich, als sie aufmachten. Der Vorsteher war nicht da, trotzdem ließ ich sie die ganze Bude auf den Kopf stellen – eine solche Unordnung kannst du dir nicht vorstellen –, aber kein einziger Brief für mich.«
»Mehrere Postschiffe wurden von den Amerikanern gekapert oder gelten als vermisst, Kamerad.«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Jack. »Und dennoch … aber jammern hilft auch nicht weiter. Danach meldete ich mich beim Commissioner. Er war ausgesprochen höflich und zuvorkommend, und er hatte erfreuliche Neuigkeiten von Broke – er saß eine Stunde lang aufrecht im Bett, war bei völlig klarem Verstand, redete und kann vielleicht selbst den Bericht schreiben. Und er lud mich zum Essen nach der Beisetzung ein. Aber mir fiel gleich auf, dass er verlegen war, und nach langem Hin und Her rückte er schließlich damit heraus: Ich werde die Acasta nicht bekommen, sondern nach Hause fahren. Ich war zu lange fort, und so hat man sie Robert Kerr gegeben.«
Die Acasta war eine besonders schmucke Fregatte mit vierzig Kanonen, eine der wenigen, die den schweren amerikanischen ebenbürtig war, und Stephen wusste, wie sehr sich Jack darauf gefreut hatte, sie in diesen Gewässern zu befehligen. Er suchte nach geeigneten Worten, um ihn über den schweren Schlag hinwegzutrösten, fand aber keine, und so sagte er: »Das tut mir leid für dich, Jack. Aber hör mal, wenn du den leisesten Schmerz oder ein Pochen im Arm spürst, musst du ihn hochnehmen – schieb ihn unter den Rock.« Er streckte sich, gähnte, nahm die Nachtmütze ab und fragte: »Sagtest du nicht etwas von einer Beerdigung?«
»Ja, natürlich. Du schläfst ja noch halb, Stephen. Wir bestatten den armen Lawrence von der Chesapeake.«
»Sollte ich mitkommen? Ich kann in einer Sekunde fertig sein. Ich bin durchaus bereit, ihm die letzte Ehre zu erweisen, wenn das üblich ist.«
»Nein, üblicherweise nehmen außer seinen eigenen Offizieren und denjenigen, die dazu abkommandiert werden, nur Männer desselben Ranges teil. Stephen, ich muss gehen. Sag, hättest du etwas Geld? Ich werde zwischen dem Begräbnis und dem Essen keine Zeit haben. Du bekommst es so schnell wie möglich zurück.«
»In meiner Rocktasche. Er hängt hinter dem Speiseschrank.«
Jack zog das Bündel Geldscheine hervor, nahm, was er brauchte, rief »Danke, Stephen«, schnallte den Säbel um und rannte die Treppe hinunter.
Alle Vollkapitäne von Halifax waren am Kanonen-Pier versammelt. Jack kannte die meisten, konnte in der Kürze der Zeit aber nur ein oder zwei begrüßen, bevor die Glocke ertönte. Pünktlich auf die Minute traf der Sarg mit einer Eskorte Seesoldaten an Land ein. Hinter ihm formierte sich der Trauerzug, bestehend aus den Amerikanern, die noch gehen konnten, den Seesoldaten, den Kapitänen in Zweierreihe, den Generälen und dem Admiral.
Sie marschierten zu den Schlägen einer umwickelten Trommel, und bei ihrem Erscheinen verstummte der Jubel in den Straßen. Jack hatte an vielen Leichenzügen dieser Art teilgenommen, und einige Male war er tief bewegt gewesen – bei der Beisetzung eines Vetters, von Schiffskameraden, engen Freunden, eigenen Offizieren oder Fähnrichen. Niemals aber hatte ihm ein feindlicher Kapitän so leidgetan wie Lawrence, ein Mann so recht nach seinem Geschmack und ein tüchtiger Kommandant, der sich mit seinem Schiff ehrenhaft dem Gefecht gestellt hatte. Der monotone Rhythmus, zu dem sie im Gleichschritt marschierten, ließ ihn die bitteren Enttäuschungen vom Morgen vergessen, und das vorgeschriebene Zeremoniell, die feierlichen Worte des Kaplans und das Prasseln der Erde auf den Sarg stimmten ihn sehr nachdenklich. Die Salve des Ehrensalutkommandos, die letzte militärische Ehre, riss ihn aus seinen Gedanken, doch seine Stimmung blieb gedrückt. Obwohl der Tod in seinem Beruf ein ständiger Begleiter war, ging ihm nicht das Bild aus dem Sinn, wie Kapitän Lawrence unmittelbar vor den ersten verheerenden Breitseiten auf seinem Achterdeck gestanden hatte, und deshalb empfand er die nun wieder auflebende Fröhlichkeit unter seinen Kameraden als höchst unpassend. Nicht, dass ihr Respekt vor dem Toten nur vorgetäuscht, ihr feierlicher Ernst bei der Zeremonie nur Heuchelei gewesen wäre, doch ihr Respekt galt einem unbekannten, wenn auch gewiss tapferen und fähigen Kommandanten. Es war der Respekt vor einem abstrakten Feind und vor einem Verhalten, das eines Offiziers würdig war.
»Sie kannten ihn, wie ich annehme?«, fragte sein Nachbar, Hyde Parker von der Tenedos.
»Ja«, antwortete Jack. »Er besuchte mich in Boston. Er hatte bei der Kaperung der Peacock einen meiner Offiziere gefangen genommen und war sehr freundlich zu ihm. Er kommandierte ihre Hornet. Ein feiner, tapferer Kerl. So tapfer, wie man es sich nur wünschen kann.«
»Aye«, sagte Hyde Parker. »Das ist das Leidige an der Sache. Aber Sie können nun mal kein Omelett backen, ohne Eier aufzuschlagen. Sie können keinen großen Sieg erringen, ohne dass Blut fließt. Und das ist ein großartiger Sieg, bei Gott. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich wie in dem Moment, als die Shannon mit ihrer Prise einlief. Jedenfalls habe ich mein Lebtag nicht so laut oder ausgiebig gejubelt. Ich bin jetzt noch so heiser wie eine Wiesenralle.«
Noch deutlicher wurde die allgemeine Freude auf dem Flottenstützpunkt bei dem vorzüglichen Essen im Haus des Commissioners. Und sie bemächtigte sich auch wieder Jacks, als er, nachdem abgetragen war, das denkwürdige Gefecht anhand zweier, aus der Werft herbeigeschaffter Modelle noch einmal in allen Einzelheiten nachstellte und seinen verzückten Kameraden erläuterte, wann welches Segel gesetzt, welches Stück Rigg zerschossen und von den beiden Fregatten welches Manöver ausgeführt worden war.
Ebenso greifbar war die Freude im Haus des Hafenadmirals, wo ein aufgeräumter Colpoys fröhlich trällernd die Treppe hinauf sprang und eine vergnügte Hausherrin unbeschwert plauderte, anstatt sich Sorgen wegen des großen Balls zu machen, den sie so kurzfristig zu geben hatte. Auch Diana hatte sich von der allgemeinen Heiterkeit anstecken lassen– wenige Frauen liebten Bälle mehr als sie – und begrüßte Stephen ausnehmend herzlich mit Küssen auf beide Wangen. »Wie schön, dass du gekommen bist. Jetzt kann ich dir deine Karte persönlich überreichen und brauche sie dir nicht zu schicken. Seit dem Frühstück habe ich Lady Harriet geholfen, sie zu schreiben. Die halbe Kriegsmarine kommt und unzählige Heeressoldaten.«
»Meine Karte?«, fragte Stephen und hielt sie mit einem argwöhnischen Blick von sich weg.
»Deine Einladung für den Ball, mein Lieber. Ein Ball, weißt du noch: ein großes strahlendes Fest, bei dem getanzt wird. Du kannst doch tanzen, Stephen, oder?«
»Auf meine Art. Das letzte Mal habe ich in Melbury Lodge getanzt, im Frieden. Du hast dich freundlicherweise meiner erbarmt und ohne große Blamage ein Menuett mit mir durchgestanden. Ich hoffe, du wirst auch diesmal so freundlich sein.«
»Ach, Stephen, ich kann leider nicht kommen. Ich habe nichts anzuziehen. Doch ich werde von der Galerie aus zusehen. Du wirst mir von Zeit zu Zeit ein Eis bringen, und dann ziehen wir über die Tänzer her.«
»Hast du denn nichts in deinem kleinen Koffer mitgebracht?«
»Oh, ich hatte keine Zeit zum Auswählen, und ich hatte meine fünf Sinne nicht beisammen. Außer den Juwelen habe ich nur ein paar Unterhemden und Strümpfe eingepackt, was mir gerade so in die Hände fiel. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich zu einem Ball eingeladen werde.«
»In Halifax gibt es Manteau-Schneider, Villiers.«
»Manteau-Schneider in Halifax«, lachte Diana herzhaft. Es war das erste Mal seit ihrem Wiedersehen in Amerika, dass er sie lachen hörte, und es berührte ihn seltsam. »Nein. In dieser Einöde gibt es nur eine Hoffnung. Lady Harriet kennt eine findige Französin, die Sachen aus Paris einschmuggelt. Heute Morgen brachte sie einen ganzen Haufen, und darunter war auch ein Kleid aus blauer Glanzseide, das uns beiden sehr gefiel. Lady Harriet könnte es natürlich nicht tragen. Es hat Ärmel bis hier und ist vorn und hinten tief ausgeschnitten, und sie sagt selbst, dass sie darin wie ein Denkmal aussehen würde. Sie hat sich für ein scheußlich gelbgrünes Kleid aus Musselin entschieden, aber wenigstens bedeckt es sie ganz. Sie lassen es im Moment für sie aus. Ich hätte das blaue nehmen können, aber Madame Chose verlangt einen horrenden Preis, und ich muss mit den fünf Cents, die ich mitgebracht habe, auskommen. Gestern Abend, mein Lieber, habe ich mir doch tatsächlich ein Paar Strümpfe gestopft. Wären wir in London oder Paris oder auch in Philadelphia, könnte ich ja ein paar Perlen verkaufen. Ich habe sie abgefädelt. Doch in dieser Wildnis gibt es nur Talmi und Filigran. Schmuck ist das Einzige, wovon ich etwas verstehe, und es wäre nachgerade eine Dummheit, in Halifax etwas zu verkaufen. Die Perlen des Nawab in Halifax! Kannst du dir das vorstellen?«
Aus dem Mund jeder anderen Frau wären diese Worte eine plumpe und obendrein ziemlich unverschämte Forderung gewesen. Nicht so bei Diana. Seit Stephen sie kannte, war sie nie unaufrichtig zu ihm gewesen, hatte alles ganz offen und direkt ausgesprochen, ohne jeden Hintergedanken, als wären sie vom gleichen Schlag oder in gewisser Weise sogar Verbündete. Und so war sie ehrlich überrascht, als er sagte: »Wir sind bei Kasse. Ich habe einen Wechsel auf meine Londoner Bank ausgestellt, und du sollst natürlich dein Seidenkleid bekommen. Wir lassen es sofort bringen.«
Es kam, und es fand Gefallen. Und Madame Chose ging mit dem Preis herunter. Diana hielt das Kleid vor sich hin und blickte in den Spiegel über dem Kamin. Sie war nicht zurechtgemacht, doch die aufrichtige Freude an dem neuen Kleid, die sie auch nach Jahren im Luxus noch empfinden konnte, belebte sie angenehm. Sie kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn: »Das Oberteil macht nicht viel her. Es soll wohl etwas anderes besser zur Geltung bringen: Perlen, könnte ich mir vorstellen. Ich werde meine Diamanten dazu tragen.«
Stephen sah zu Boden. Die Diamanten, eine Halskette mit einem erstaunlich blassblauen großen Solitär in der Mitte, hatte Diana von Johnson in ihren ersten gemeinsamen Tagen geschenkt bekommen. Auf irgendeine Weise war es ihr gelungen, die Herkunft der Steine aus ihrem Gedächtnis zu streichen. Stephen nicht. Doch was ihn jetzt schmerzte, war nicht etwa ein Anfall von nagender Eifersucht, sondern eine gewisse Enttäuschung darüber, dass sie etwas Ungehöriges gesagt hatte. Was Diana auch immer tun mochte, er hatte ihr Taktgefühl stets für unfehlbar gehalten und war wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass ihr niemals eine unbeabsichtigte Kränkung über die Lippen kam. Möglicherweise hatte er sich geirrt. Möglicherweise hatten aber auch der lange Aufenthalt in Amerika, der Umgang mit Johnsons leichtlebigen, reichen Freunden und der Kummer mit der Zeit ihre Manieren verdorben, so wie sie auch einen leichten Kolonialakzent angenommen und Geschmack an Bourbon und Tabak gefunden hatte … eine Flucht in die Grobheit, sozusagen. Andererseits jedoch, so überlegte er, hatte Johnson die Diamanten sicherlich zurückgenommen, und Diana hatte sie wieder in ihren Besitz gebracht, war mit ihnen unter hohem Risiko geflüchtet und glaubte nun wohl, sie habe einen berechtigten Anspruch auf den Schmuck erworben, wie ein Pirat, der einen anderen Piraten entert und beraubt, ohne sich um die Herkunft der Beute zu kümmern. Er sah auf und sagte: »Ist das nicht ein wenig übertrieben? Schließlich ist es nur ein Provinzball.«
»Ganz und gar nicht, Maturin«, entgegnete sie. »Es gibt hier durchaus Frauen, die einen feinen Lebensstil pflegen. Viele Soldatenfrauen sind ihren Männern gefolgt – als ich die Einladungskarten schrieb, las ich mindestens ein halbes Dutzend bekannte Namen –, und auch unter den Frauen der Seeleute sind einige: Mrs Wodehouse, zum Beispiel, und Charlotte Leveson-Gower, und Lady Harriet selbst. Sie mag keine Aphrodite sein, aber sie besitzt Smaragde so groß wie Suppenteller, und sie ist fest entschlossen, sie zu tragen, überhaupt alles, was auf ihrem Busen Platz findet, und das ist nicht wenig.«
Der erste Versuch war gescheitert, und Stephen unternahm keinen zweiten. Von solchen Dingen verstand Diana ohnehin mehr. Jedenfalls hatte sie in London und Indien in sehr feinen oder zumindest sehr eleganten Kreisen verkehrt. Er fasste in die Tasche und zog ein paar Papiere hervor. Das Erste war nicht das, wonach er suchte, doch er lächelte bei seinem Anblick, und anstatt es wieder einzustecken, sagte er: »Das habe ich heute Morgen erhalten, und drolligerweise hatte ich keine halbe Stunde zuvor von Paris geträumt.« Er reichte ihr den Brief.
»Man bittet dich, am Institut de France einen Vortrag zu halten – meine Güte, Stephen, ich wusste ja gar nicht, dass du ein so bedeutender Mann bist. Du sollst über die ausgestorbene Avifauna auf Rodriguez sprechen. Was ist denn Avifauna?«
»Vögel.«
»Wie schade, dass du nicht hingehen kannst. Es würde dir sicher sehr gefallen. Vermutlich halten sie dich für einen Neutralen oder einen Amerikaner.«
»Vielleicht werde ich sogar hingehen. Wie du siehst, bleibt mir bis dahin noch viel Zeit, und wenn wir ein leidlich schnelles Schiff bekommen, werde ich es wohl auch tun. Das ist bereits die zweite Einladung, und beim letzten Mal habe ich mein Fernbleiben hinterher zutiefst bedauert. Es ist vielleicht die größte Ehre, die mir jemals zuteilwurde, und ich könnte ein paar der interessantesten Männer Europas treffen. Bestimmt werden die Cuviers dort sein, und was ich zum antarktischen Wal zu bemerken habe, dürfte Frédéric in Erstaunen versetzen.«
»Aber wie kannst du so etwas tun? Wie kannst du mitten im Krieg nach Paris gehen?«
»Oh, was das angeht, so ist das mit den entsprechenden Genehmigungen und Geleitbriefen kein Problem. Die Naturphilosophie nimmt auf den Krieg keine Rücksicht, weder auf diesen noch auf irgendeinen anderen, wenn man es genau nimmt, und es ist durchaus üblich, sich auszutauschen. Zum Beispiel sprach Humphry Davy in Paris über sein Stickstoffchlorid, und er wurde regelrecht verwöhnt. Doch eigentlich wollte ich mit dir über etwas anderes sprechen.« Er nahm den zweiten Umschlag, legte ihn vor ihr auf den Tisch und sagte etwas verlegen: »Für Haarnadeln.«
»Für Haarnadeln?«, rief sie verwundert.
»Ich habe immer gedacht, dass Frauen eine ordentliche Summe für Haarnadeln brauchen.«
»Stephen«, lachte sie vor Vergnügen, »du wirst ja rot. Auf mein Wort und bei meiner Ehre, du wirst wirklich rot. Das hätte ich nie gedacht, dass ich dich einmal erröten sehe. Nein. Das ist wirklich zu lieb von dir, aber du hast schon viel zu viel für mich getan. Ich besitze hundertundfünfundzwanzig Dollar, das reicht für Nadeln. Behalte das Geld, mein lieber Stephen, und ich verspreche dir, ich lasse es dich wissen, wenn ich in Geldverlegenheit bin.«
»Gut«, sagte Stephen und nahm das dritte Papier zur Hand. »Hier habe ich eine Bescheinigung für dich. Sie gibt dir, obwohl du eine feindliche Ausländerin bist, das Recht, kanadischen Boden zu betreten und dich hier aufzuhalten, solange du dich gut führst.«
»Oh, ich werde mich sehr gut führen«, sagte sie und lachte abermals. »Aber was ist das für ein Unsinn, Stephen. Ich befinde mich doch schon auf kanadischem Boden. Ich habe Ausweise und juristische Formalitäten schon immer für Unsinn gehalten, aber so etwas Albernes ist mir noch nicht untergekommen. Auf unbestimmte Zeit und nach dem Ermessen Seiner Majestät«, las sie, »und dabei weiß Seine verehrte alte Majestät noch nicht einmal, dass ich hier bin. Oh, was für ein Blödsinn.«
»Er nicht, aber seine Beamten. Es ist mein bitterer Ernst, Villiers, dieses Dokument ist wichtig. Ohne es hätte man dich festgenommen, Admiral hin oder her. Es ist bekannt, dass du nach dem Gesetz amerikanische Staatsbürgerin bist, und als solche würde man dich normalerweise in Haft nehmen, vielleicht sogar zurückschicken.«
»Wer kümmert sich schon um das Gesetz und solche Haarspaltereien? Jeder weiß, dass ich mit Leib und Seele Engländerin bin, immer war und immer bleiben werde. Sagst du mir, wie du sie bekommen hast?«
»Selbstverständlich, ich habe mich an die zuständige Stelle gewandt, an den Offizier, der mit solchen Dingen befasst ist.«
»Es war sehr freundlich von dir, daran zu denken«, sagte sie, und dann rief sie: »Oh, Stephen, das habe ich ja ganz vergessen« – und er hätte schwören können, dass es Gedankenübertragung war –, »war man mit den Papieren zufrieden, die du aus Boston mitgebracht hast? Soweit ich mich erinnere, wolltest du sie einem hiesigen Nachrichtenoffizier des Heeres geben. Ich hoffe doch, er konnte etwas damit anfangen.«
»Ach, wie es scheint, ist ihr Inhalt eher politischer als militärischer Natur. Sie sind nicht ohne einen gewissen Wert, wie man mich wissen ließ, aber anscheinend hätte ich eine bessere Auswahl treffen können. Ich fürchte, ich bin nicht zum Agenten geboren.«