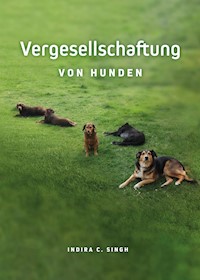
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Im Laufe der vergangenen zehn Jahre hatte ich das Glück, eine völlig neue Weise des Lebens mit Hunden kennenzulernen. Zuvor hielt ich Hunde, wie es jeder Hundehalter macht, der einen treuen Begleiter für sein Leben haben möchte. Doch dann lernte ich die Rudelstellungen kennen, betrat eine neue Welt mit eigenen Regeln und erlebte anhand meiner Hunde, die ich nach diesen Regeln zusammengebracht hatte, was wirkliche Gemeinschaft bedeutet, unter Hunden, aber auch übertragen auf uns Menschen. Hunde sind mehr als nur faszinierende und kluge Tiere, sie sind Rudeltiere, die nach angeborenen Strukturen diese Rudelgemeinschaft leben und dabei hochsozial und immer mit dem Gemeinschaftsgedanken an erster Stelle handeln und sich verhalten. Ermöglicht man seinem Hund durch die Aufnahme eines von der Stellung her passenden Hundepartners, diese natürliche Anlage und sein essentielles Bedürfnis nach einer sozialen Gemeinschaft ausleben zu können, erlebt man einen Zauber, der nur schwer in Worte zu fassen ist. Man erlebt eine andere Stufe des Zusammenlebens mit Hunden, lernt von ihnen die Regeln ihrer Gemeinschaft kennen und wird zu einem Teil dieser Gemeinschaft - wenn man bereit ist, sich auf diese Regeln einzulassen und den Hund als eigenständiges Wesen mit eigenen Bedürfnissen und in seiner Partnerschaft mit seinem passenden Hundepartner anzuerkennen. Für die Hunde, aber auch für die Tiere allgemein wünsche ich mir, daß sich in Zukunft immer mehr Menschen trauen, zuzugestehen und zu respektieren, daß Tiere auf Ebenen kommunizieren und sich in natürlichen Strukturen organisieren, von denen wir nur wenig wissen und ahnen, daß es das gibt. Danke, meine lieben Hunde, daß ich von und mit euch lernen durfte und darf. Ihr habt mir eine für mich neue Welt, eure eigene und natürliche Welt, gezeigt, dafür bin ich euch unendlich dankbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
IMPRESSUM
© 2020 Indira C. Singh
Autor: Indira C. Singh
Umschlaggestaltung: ofp kommunikation
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-347-21917-5 (Paperback)
978-3-347-21918-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Kurze Einführung in die Begriffe
Vergesellschaftungen - was bedeutet das Wort „Vergesellschaftung“ überhaupt?
Spätvergesellschaftungen
Die ideale Vergesellschaftung?
Was bedeutet eine Vergesellschaftung für die Hunde?
Die Bedeutung der Vergesellschaftung zweier passender Hunde für den Menschen
2. Über die sieben Stellungen in Bezug auf die Bedeutung im Rudel und in der Vergesellschaftung: VLH - V2 - V3 - MBH - N2 - N3 - NLH
Das Gefüge aller sieben Hunde in einem Komplettrudel
3. Das Bild der Waage
4. Vor- und Nachteile der Hundehaltung in kleineren Gruppen oder Zweierteams
Zweierteam, Einzelhunde: Leithunde, Bindehunde, MBH Vor- und Nachteile eines Teilrudels
5. Parameter
Nicht zu unterschätzen: die Altersstruktur
Altersstufen
Altersmodelle in der Vergesellschaftung
Die Stellungsstärke
Die körperlichen Parameter
Rassen
6. Reparaturverhalten
7. Fallbeispiele
Fallbeispiel 1: Vergesellschaftungsstufen in meiner eigene Hundegruppe
V3, dazu MBH
MBH, dazu N2
N3, dazu NLH Welpe
NLH, dazu N3 Welpe
Sonderfall Aufstockung Teilrudel nach Todesfall
Weitere Fallbeispiele anonymisiert aus unserem Vereinsforum:
Fallbeispiel Aufstocken Komplettrudel mit noch fehlender N2
Sonderfall Beispiel Aufstockung Komplettrudel mit MBH
VLH , dazu V2, nach Todesfall Aufstockung mit VLH Welpe
8. Sonderfall passende Geschwisterhunde
Sonderfall: Vergesellschaftung zweier Rentnerhunde, VLH, 12jährig, mit V2, 11jährig, aus Fehlbesatz
9. Beispiele für strukturierte Abläufe in Hundeteams
Beispiel: Auto
Beispiel: Rausgehen
Beispiel: Besuch kommt
Beispiel: Bellen an der Gartenhecke
Beispiel: Disziplinierung der N2 im Teilrudel anhand von zwei Alterstrukturen
Beispiel: Wildbegegnung im Wald
Beispiel: Passanten
10. Verschiedene Stufen in der Vergesellschaftung zweier Hunde
Wie verläuft eine Vergesellschaftung?
Unterschied Leithund+passender Bindehund / MBH+ passender Bindehund
Anfangsstadium
Aufnahme der Bindearbeit
Disziplinarbeiten, über Abstände oder Ressourcen
Abstellen, Wegschicken, Heranholen
Ressourcenarbeit, Tabubelegung
Sonderfall Hauptfuttermahlzeit
Liegeplätze und erhöhte Liegeplätze
Endstadium der Vergesellschaftung
Sozialgesten
11. Sonderfall Hunde im Rentenalter
Fallbeispiel Rentner
12. Unterschiede in der Vergesellschaftung im Vergleich von jungen Hunden zu älteren Hunden
zwei junge Hunde
erwachsener Eckhund, junger Bindehund
zwei erwachsene Hunde
13. Komplikationen in der Vergesellschaftung
Den Welpen an den Eckhund abgeben
zu unterschiedliche Stellungsstärken
Eckhund mit Altlasten
Größe und Gewicht des Bindehundes
14. Abweichungen in der Spätvergesellschaftung
15. Rasse-Eigenschaften und Stellung
16. Rolle des Menschen in der Vergesellschaftung
17. Die Rolle des Menschen mit den Hundeteams
Leithund als Einzelhund
NLH-N3
VLH - V2
MBH - N2 bzw MBH - V3
Verhaltens des Menschen in Bezug auf alle Stellungen
18. Ganz praktische Tipps für den Alltag mit strukturierten Hunden
Die Reihenfolge
Fütterung in strukturierten Gruppen
Handfütterung
selbständige Entscheidung über das Futter
Ausnahme Fütterung großer Brocken, Teile bzw ganzer Tiere
Körperpflege, medizinische Versorgung, Fellpflege
Tierarztbesuch
Geschirre anlegen, Anleinen, Ableinen
Spazieren
Entschleunigung
Einsteigen/Aussteigen beim Auto
Besuch begrüßen
Zuhause mit den Hunden
Plüschhund
Nachwort
Danksagung
Begriffserklärung
Fotoanhang
Die MBH-Gruppe schwimmt zusammen; vlnr: V3 - MBH - N2
1. KURZE EINFÜHRUNG IN DIE BEGRIFFE
Vergesellschaftungen
Was bedeutet das Wort „Vergesellschaftung“ überhaupt?
Das Wort Vergesellschaftung verwenden wir, wenn zwei passende Hunde zum Zusammenleben zueinander kommen, sich kennenlernen und dann fortan ihr Leben miteinander verbringen.
Miteinander vergesellschaftet werden immer zwei von der Stellung her zusammenpassende Hunde, d.h.:
- NLH mit N3
- MBH mit N2 oder
- MBH mit V3
- VLH mit V2
Das sind die kleinstmöglichen Formen der Vergesellschaftung.
Werden zwei Hund miteinander vergesellschaftet, sollten sie immer ausreichend Zeit zu zweit haben, um sich ihre gemeinsame Basis zu erarbeiten. Das bedeutet, nehme ich zwei Hunde zu einer schon bestehenden Hundegruppe auf, sollte man den zwei zu vergesellschaftenden Hunden auch immer wieder ermöglichen, sich zu zweit miteinander auseinanderzusetzen - so zumindest wird es vom Prinzip her geraten, aber auch hier gibt es Ausnahmen, zum Beispiel, wenn die schon vorhandenen Hunde wie eine Einbettung den zwei neuen Hunden helfen, und die Vergesellschaftung unterstützen. Es ist notwenig, von Fall zu Fall und mit geübtem Auge zu entscheiden.
Eine Ausnahme bilden zwei passende Welpen-Geschwister, die zusammen aus einem Wurf stammen und aufgenommen werden: Welpen professionalisieren sich im Wurf, und eine Vergesellschaftung fällt dann sozusagen weg, diese zwei passenden kleinen Lebewesen sind eine perfekt funktionierende Einheit und haben sich alle Abläufe schon erarbeitet.
Auf die Schwierigkeiten bei Welpengeschwistern gehe ich in einem späteren Kapitel ein.
Eine Vergesellschaftung zweier passender Hunde bedeutet aber nicht, dass damit alle Probleme, die ein Einzelhund womöglich gemacht hat, verschwinden. Für schnelle Lösungen ist RS (= Rudelstellungen) und eine Vergesellschaftung nicht geeignet.
Mit einer Vergesellschaftung setzen sich zwei Hunde ein gemeinsames Ziel, die Gemeinschaft, und verfolgen dieses; das zeigt, dass Hunde eine Vorstellung von Zukunft haben, sie verfolgen ein Ziel und planen, was in der Zukunft liegt. Hunde haben auch viel Phantasie auf dem Weg zum Erreichen dieses Ziels, sie überlegen sich viele verschiedene Lösungswege, denken sehr variantenreich.
Gemeinsam im Schnee buddeln, v.l.n.r.: N2 - MBH - V3
Spätvergesellschaftungen
Mit Spätvergesellschaftung meinen wir, wenn zwei von der Stellung her passende Hunde miteinander leben wollen, die zuvor ein Vorleben als Einzelhund und/oder in Unstruktur gelebt haben, die kennengelernt haben, welche Varianten es gibt neben dem Leben in Struktur. Bei solchen spätvergesellschafteten Hunden ergeben sich andere Bilder als bei Hunden, die ihr Leben lang nur in Struktur gelebt haben; speziell auf diese Varianten soll auch in diesem Buch eingegangen werden, denn:
Die allermeisten Menschen haben Hunde, die nicht in Struktur leben, es ihrem Hund aber trotzdem ermöglichen wollen, und diese ersten Schritte sollen hier auch aufgezeigt werden.
Im vereinseigenen Forum kann man wunderbare Spätvergesellschaftungen mitverfolgen! Spätvergesellschaftung ist also keineswegs wertend zu verstehen, sondern es ist einfach eine Bezeichnung für diese Form der Vergesellschaftung.
Vergesellschaftet werden in Spätvergesellschaftungen genau dieselben Stellungen wie oben benannt.
Die ideale Vergesellschaftung
Gibt es eine ideale Vergesellschaftung? Das ist eine sehr schwierige Frage, und es wird wahrscheinlich keine eindeutige Antwort darauf geben.
Die V2 ist über das Aufpassen an der Eingangstüre eingeschlafen.
Der Rottweiler VLH (vorne) schläft entspannt, die V2 (braun) wurde vor der Eingangstüre positioniert, damit niemand unbemerkt das Grundstück betreten kann, während der VLH schläft.
Hunde sind Individuen, und man kann niemals eine Schablone anwenden, die auf alle Hund immer gleich gut passt.
Aber man kann einige Parameter feststellen, die - wie die jahrelangen Aufzeichnungen der vielen Forumsuser gezeigt haben - eine Vergesellschaftung reibungsloser verlaufen lassen und wo man als Halter fast davon ausgehen kann, dass die Hunde relativ schnell eine Basis erarbeitet haben, die wir unter Rudelstellungs-Gesichtspunkten als gut funktionierend sehen.
Was bedeutet eine Vergesellschaftung für die Hunde?
Mit einer Vergesellschaftung betritt man als Mensch eine neue Art der Hundehaltung. Es ist ein verantwortungsvoller und weitreichender
NLH links, N3 rechts, teilen sich den Hundekorb. Miteinander liegen baut die gegenseitige Akzeptanz auf.
Schritt - das muss man sich klarmachen und auch überlegen, ob man das überhaupt möchte für sich selber, denn es wird durch eine Vergesellschaftung nicht unbedingt einfacher mit den Hunden, sondern eher anspruchsvoller für den Menschen.
Man begibt sich in eine Welt, die das Individuum Hund an erste Stelle setzt und versucht, aus der Sicht dieses Individuums Hund die Dinge wahrzunehmen. Das ist unbequem, aber auch wunderbar, wenn man sich darauf einlässt. Es entspricht nicht dem gängigen Bild des Umgangs mit einem Hund, wie er fast überall gelehrt wird. Man gesteht dem Hund eine Eigenständigkeit zu, die Fähigkeit, eigene kluge Entscheidungen zu treffen, man degradiert den Hund nicht zu einem Kommandoempfänger, sondern versucht, eine Gemeinschaft herzustellen, die auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen beruht.
Ab dem Moment, wo ich meinem Hund einen passenden Partner ermögliche, setze ich in den Hunden eine Welt in Gang: ihre eigene Welt.
Ab diesem Moment bin ich gleichzeitig verpflichtet, mich an die Regeln der Hunde zu halten, die ihre Welt ausmachen. Man muss nicht perfekt sein, man kann Fehler machen, aber man muss den Hunden zeigen, dass man ihre Welt anerkennt, sich darauf einlässt, die Regeln achtet. Die Hunde prüfen es, und werden, wenn man sich daran hält und es ernsthaft verfolgt, den Menschen innerhalb der Struktur als Gemeinschaftswesen anerkennen und in hohe Kooperation mit dem Menschen gehen.
So haben es die Erfahrungen der vielen Jahre, gesammelt in unserem Vereinsforum, gezeigt.
Erlebt man einmal diese Aufnahme in die funktionierende Gemeinschaft der Hunde, möchte man - so kann ich zumindest für mich selber sagen - niemals mehr eine andere Art des Umgangs mit Hunden erleben.
Lässt man zwei passende Hunde zusammen leben und sich vergesellschaften, so ist das wie ein Mechanismus zu verstehen, der nicht mehr aufgehalten werden kann - die Hunde bleiben nicht stehen, wenn sie einmal begonnen haben, sich zu verbinden.
Auf der Basis dieser Verbindung ist es Hunden möglich, sich vom Menschen in gewisser Weise unabhängig zu machen, sie sind nicht mehr ausschliesslich auf die Sozialität des Menschen und die Kommunikation mit diesem angewiesen, sondern können diese jetzt mit dem passenden Partner ausleben. Sie beginnen und bewerten ihren Menschen. Um diese hohe Kooperation und eine Gemeinschaft mit den Hunden zu erreichen, in der ich als Mensch von den Hunden vertrauensvoll anerkannt werde, muss ich mich wie gesagt an die Regeln der Welt der Hunde halten und meine Aufgaben in dieser Gemeinschaft zuverlässig übernehmen.
Die Bedeutung der Vergesellschaftung zweier passende Hunde für den Menschen
Wie weiter oben schon angeschnitten, öffnet man für die Hunde in dem Moment, wo man ihnen das Leben mit einem passenden Partner ermöglicht, ihre eigene Hundewelt mit den Regeln aus dieser Welt.
zusammen buddeln, vlnr: N2, MBH, N3, NLH, V3
Der junge VLH (hell) und seine V2 beim gemeinsamen Mittagsschlaf auf der Couch.
Für den Menschen bedeutet dies, dass man ab jetzt diese Regeln der Hundewelt lernen und einhalten muss; in den Hunden setzt man einen Mechanismus frei, und sie werden in ihrer Zusammenfindung nicht mehr stoppen und warten, sondern eine Vergesellschaftung läuft unaufhaltsam, mit verschiedenen Endergebnissen.
Wichtig ist für den Menschen, dass er lernt, die Hund richtig zu bewerten.
Man muss sich immer klar machen: Hunde bewerten den Menschen auch. Jedes Verhalten wird bewertet, und bemerken die Hunde, dass der Mensch zu viele Bewertungsfehler macht, sinkt das Vertrauen in den Menschen.
I Nachrangteilrudel mit V3, von vorne nach hinten: MBH (rechts), V3, N2, NLH, N3
Es geht in einer Vergesellschaftung zum einen um den Gemeinschaftsaufbau zwischen zwei passenden Hunden, aber genau so geht es um den Gemeinschaftsaufbau zwischen Hunden und Mensch.
Dieser Gemeinschaftsaufbau hat ausschliesslich mit der Übernahme der klaren Führungsbereitschaft für Außenreize der Menschenwelt, der Richtungvorgaben und den Erklärungen/Bewertungen zu tun - das sind zusammengefasst die Aufgaben des Menschen.
In Teilrudeln oder kleineren Teams muss man sich immer klar machen, welche Aufgaben die fehlenden Stellungen übernehmen würden und dann weiß man, was man als Mensch ausfüllen muss, und die Hunde in der Gruppe können sich fallen lassen.
Je mehr man sich mit den Aufgaben der Hunde im Komplettrudel befasst, desto besser wir man seine eigenen Aufgaben im eigenen Hundeteam erkennen und verstehen.
Im Folgenden will ich anhand meiner eigenen Hundegruppe, aber auch an anonymisierten Fallbeispielen aus unserem Forum diese Alterstrukturen und Vergesellschaftungen bzw Spätvergesellschaftungen illustrieren und erklären.
Der VLH steht und beobachtet mit gerunzelter Stirn den V2
2. ÜBER DIE SIEBEN STELLUNGEN IN BEZUG AUF DIE BEDEUTUNG IM RUDEL UND IN DER VERGESELLSCHAFTUNG
Der vorrangige Leithund, VLH
Ein VLH-Welpe aus einem strukturierten Wurf, der sich erfolgreich separiert hat im Wurf, ist ein sich relativ wenig bewegender Hund, und wenn, dann nie mitten im restlichen Wurf. Der VLH wird nur kurz mit dem MBH Sozialgesten tauschen manchmal im Vorbeigehen; der V2 wird schon in dem Alter mit Stimulationen beginnen und fordern, dass der VLH sich mit ihm abgibt. Der VLH dosiert sehr gezielt seine Aktivitäten mit V2. Der vordere Leithund ist als einziger Hund ausgestattet mit einem Ortungssinn, einem Radar nach vorne. Dieser Ortungssinn funktioniert auf weiteste Entfernungen, der VLH kann durchblutete Lebewesen auf einige Kilometer Entfernung wahrnehmen, aber auch andere Reize wie Maschinen, Autos etc bemerkt der VLH sehr frühzeitig.
Der VLH (hell) thront auf der Terrasse, beobachtet die Umgebung und nimmt sie mit all seinen Sinnen auf, die V2 (braun) liegt entspannt und abwartend neben ihm
Der VLH (tricolor vorne) hält den V2 (weiß) an seiner hinteren Flanke und führt ihn an.
Dadurch ist er als einziger Hund prädestiniert, Bewertungen nach vorne zu erstellen.
Diese Funktion ist immens wichtig für den Rest der Rudels, denn durch diese Fähigkeit ist es dem VLH möglich, frühzeitig Gefahren festzustellen, und kann dann sein Rudel in großen Bögen um solche Gefahren herumführen, ohne dass das Rudel tangiert wird von dem Reiz.
Die anderen sechs Hunde wissen das, und fordern so vom vorderen Leithund, dass dieser sich möglichst ausschließlich mit dieser Aufgabe befasst, denn nur so ist das Rudel sicher von direkten Konfrontationen mit Reizen aller Art.
Der VLH soll „thronen“, er sitzt oder liegt an strategisch relevanten Aussichtspunkten und ortet die Umgebung ab.
Er beurteilt liegend die Geschehnisse im Rest des Rudels, und greift nur ein, wenn es erforderlich wird, z.B. der MBH seine Unterstützung benötigt.
Zusammen erkunden die junge VLH (braun) und der ältere V2 die Wiese
Der VLH steht in Absprache mit dem NLH, beide tarieren sich aus, und so müssen beide flexibel bleiben in ihren Entscheidungen und können nicht despotisch ihren Kopf durchsetzen.
Der MBH wird anschliessend in die Absprachen einbezogen, damit er sie weitergeben kann an die Bindehunde. An den Absprachen der beiden Leithunde kann man erkennen, ob die Bindehunde alle gut in ihrer Stellung agieren; je ausgewogener das Rudel funktioniert, desto ausgeglichener können die Leithunde sich absprechen
Im Zug führt der VLH den V2 direkt an. Der VLH kann aus seiner Stellung heraus eine enorme Zugkraft entwickeln, und sich dabei völlig auf die Umgebung vor ihm konzentrieren.
Es liegt am MBH, dafür zu sorgen, dass alles anderen Hunde folgen.
Trifft ein VLH auf einen Reiz, so wird er diesen nach Möglichkeit aus der Entfernung bewerten, und dann seitlich aus der Tangente Reiz-VLH treten, und dadurch das Rudel mit sich ziehen, und so an dem Reiz im Bogen vorbei ziehen. Lässt sich eine Konfrontation nicht umgehen, ist normalerweise der MBH als Hund mit der höchsten Sozialkomponente dafür zuständig, oft mit Hilfe seiner Bindehunde. Der VLH kann sich auch aufgebaut dem Reiz entgegenstellen und dadurch auf Abstand halten. In dringenden Fällen wird er den V2 freigeben und direkt schicken.
Dem VLH muss man als Mensch auf einer partnerschaftlichen Ebene begegnen; ihn führen zu wollen, womöglich über Kommandos, wird auf Dauer nicht funktionieren, es kann nur eine Gemeinschaft in Kooperation entstehen mit dem Menschen, wenn der VLH in seinen Anlagen und Fähigkeiten anerkannt wird.
Der zweite vordere Bindehund, V2
Der V2 ist die „rechte Hand“ vom VLH; er ist der Sicherungshund des VLH, und für dessen persönliche Sicherheit zuständig. Sollte dem VLH jemals etwas zustossen, so ist der V2 ausgestattet mit der Fähigkeit des Führen-Könnens; er kann in die Rolle des VLHs schlüpfen, kann nach vorne einen Zug entwickeln und so das Rudel von A nach B bringen. Der V2 hat allerdings keinen Ortungssinn, so dass ihm - wie allen anderen Bindehunden - die Fähigkeit, Reize frühzeitig zu bewerten, fehlt. Sein Führen gleicht also mehr einem Führen „auf gut Glück“, und das wissen die anderen Hunde, weswegen die Zweier nur in Notfällen in diese Führungsrolle gehen sollten.
Die V2 bewegt sich zielorientiert und flott über die Wiese
Auch schiesst ein V2 ohne die Anleitung des VLHs beim Führen über das Ziel hinaus, er wird übertrieben agieren und auch reagieren auf Außenreize, da die Kontrolle des VLHs fehlt.
Durch die Anlage des Führen-Könnens braucht ein Zweier automatisch mehr Freiheit, als im Vergleich dazu die Dreier. Die Eckhunde VLH und MBH wissen das und gestehen den Zweiern mehr Freiheiten zu, sie dürfen ihre Anlage des Führens am jeweiligen Dreier ausleben: V2 führt den V3 im Zug an.
Der sehr junge VLH (hell) sitzt und beobachtet, die V2 (braun) läuft erkundend voraus und wird anschliessend Bericht erstattend zum VLH zurückkehren.
Während die V3 (schwarz) die Umgebung im Blick behält und wächtert, können MBH und N2 entspannt herumschnüffeln.
Auch führt der V2 Aufträge aus, die er vom VLH erhält, erkundet dabei die Umgebung vor dem Rudel und kommt Bericht erstattend wieder zurück.
Außerdem fungiert der V2 als Bindeglied zwischen dem Vorrang VLH - V2 und den anderen fünf Hunden. Im Zug achtet der V2 darauf, dass über die Brücke V2-V3 der Anschluss an den VLH nicht verloren geht. (Auch die anderen Hunde helfen da mit, siehe die jeweilige Stellungsbeschreibung)
Der V2 kann als Partner vom VLH den VLH auch zum Nachdenken bringen, von ihm Flexibililtät in seinen Entscheidungen fordern, und sorgt dafür, dass ein Leithund sich nicht auf seinem Leithundedasein ausruht.
Der dritte vordere Bindehund, V3
Der V3 ist der vordere Sicherungshund des MBHs, und hat aus seiner Stellung heraus die Anlage des Wächterns und des Meldens. Naht sich ein Reiz dem Rudel, wird der V3 sich in die Richtung dem Reiz zugewandt aufgebaut aufstellen und mit einigen kontrollierten tiefen Wuffs den Reiz an die anderen Hunde melden.
Es werden sich dann die Leithunde zur Bewertung aufstellen, und damit ist der Job des Dreiers erledigt, alles weitere übernehmen die anderen Hunde.
Damit der V3 dieses kontrollierte Melden lernt und weiß, welche Reize meldenswert sind und welche nicht, bekommt er ein Belltraining vom MBH. Dazu wird der MBH Reize setzen und der V3 muss dann aufmerksam sein und melden; diese Übung wird innerhalb einiger Tage, manchmal auch Wochen sehr intensiv geübt, und danach wird der Dreier sehr gezielt melden und nicht mehr undifferenziert bellen.
Der MBH (links) behält die anderen Hunde im Blick, während V3 wächtert
Der MBH fordert durch die Vorderkörpertiefstellung die anderen Hunde zur Mitarbeit auf.
Wird entschieden, dass der MBH den Reiz übernehmen muss, so kann der MBH den V3 als Sicherungshund mitnehmen zur Verstärkung.
Der V3 als Dreier ist ein harmoniebedürftiger Hund, er benötigt Anführung und Leitung, er wird unsicher, wenn er Entscheidungen treffen soll. Auch benötigt er eine Körper als haltgebendes Element, er ist gerne eingebettet zwischen den anderen Hunden.
Der VLH kann den V3 in der Überkreuzarbeit im Vorrangteilrudel übernehmen und damit dem MBH helfen.
Als Sicherungshund hat der V3 aber auch die geringste Beißhemmung im Rudel. Bei der Jagd wird der V3 von den anderen Hunden eingesetzt, um den Todesbiss zu setzen.
Der mittlere Bindehund, MBH
Der mittlere Bindehund ist die Steuerzentrale des Rudels. Er übernimmt die Koordination aller Hunde, er trennt den Vorrang vom Nachrang, und er übernimmt die Steuerung aller Bindehunde, damit die beiden Leithunde sich auf ihre Arbeit, das Orten und Bewerten, konzentrieren können.
Darauf wird ein junger MBH auch bestehen, wenn er neu in ein Rudel kommt, dass die Leithunde ihm mit der Zeit diese Arbeit übertragen und ihre Bindehunde N3 und V2 an den MBH übergeben.
MBH (links) und N2 (rechts) kommen vom Schwimmen zurück. Der MBH in Struktur lebend ist nie alleine, er hat immer mindestens einen seiner Bindehunde bei sich.
Ohne einen MBH wird ein Rudel zerfallen, es wird sich der Nachrang und der Vorrang vermischen. Leithunde haben auf Dauer keine Lust, sich ständig um die Bindehunde zu kümmern und setzen dann die Ordnung und Ruhe auch sehr druckvoll um. Der MBH ist als hochsozialer Hund am Aufbau und Erhalt der Struktur maßgeblich beteiligt, und setzt dabei auf die Kooperation, Eigendiziplin und Selbstkorrektur der Bindehunde.
Der MBH stellt sich bei Konfrontation mit Außenreizen dem Reiz entgegen, manchmal nimmt er hierbei einen oder beide Bindehunde N2 und V3 zur Unterstützung mit.
Wenn die Leithunde sich absprechen, achtet der MBH darauf, dass keiner der Bindehunde diese Absprachen stört, und er selber geht erst im Anschluss an die Absprachen zu den Leithunden, um seine Informationen zu bekommen, die er dann weitergibt an die Bindehunde. Besprechen sich die Leithunde zu lange und kommen zu keinem Ergebnis, kann der MBH dazugehen und dies einfordern.
Der MBH hat keine Begabung im Bewerten von Außenreizen, man kann sagen, der MBH ist „kurzsichtig“. Um einen Reiz für sich klarzubekommen, muss der MBH nah herangehen und kann aus der Nähe dann zu einem Urteil kommen, allerdings kann es sein, dass dieses Urteil nicht von Dauer ist. Das erklärt, wieso der MBH so angewiesen ist auf die ihn umgebenden Hunde, die ihn sichern, die er zu Reizen schicken kann, und auf die Leithunde, deren Bewertungen er einfach übernehmen kann.
Die MBH (vorne sitzend) hält den N2 (hinten stehend) durch Fixierung auf Abstand zu dem fotografierenden Menschen, der N2 darf sich nicht nähern.
Als Einzelhund fehlt dem MBH die Grundlage für das, was ihn ausmacht, die Hunde zu einer Gemeinschaft zusammenzufügen und in einer Gemeinschaft zu halten, und es fehlt ihm auch der Austausch auf sozialer Ebene, die für den MBH höchst wichtig ist.
Der nachrangig zweite Bindehund, N2
Der N2 ist der Sicherungshund vom MBH nach hinten. Genau wie der V2 besitzt der N2 auch Führungsanlagen aus seiner Stellung heraus. Er kann im Zug den N3 führen. Fehlt ein MBH im Rudel, wird kurzfristig der N2 in die Rolle des MBH gehen und versuchen, dessen Aufgaben zu übernehmen.
Die N2 geht konzentriert durch das Gebüsch und hebt geschickt die Pfoten, um über die Äste zu steigen. Die beiden Zweier N2 und V2 zeigen oft eine besondere Geschicklichkeit mit den Pfoten.
Die N3 wartet auf den NLH und mich, damit wir weitergehen können
Ein N2 hat aber niemals die Autorität wie ein MBH, und die anderen Bindehunde werden sich auf Dauer nicht an den N2 halten. Das kann dazu führen, dass der N2 dann über das Ziel hinaus schiesst und zu körperlichen Druckmitteln greift.
Der N2 ist im Zug auch dafür zuständig, darauf zu achten, dass der Nachrang NLH - N3 den Anschluss zur Gruppe behalten. Dazu schickt der MBH den N2 nach hinten zur N3 und NLH, und N2 zieht dann anführend den Nachrang mit sich mit zur Gruppe.
Der N2 wird vom MBH gesteuert, aber auch von hinten mental angesteuert vom NLH, dadurch wird der MBH unterstützt.





























