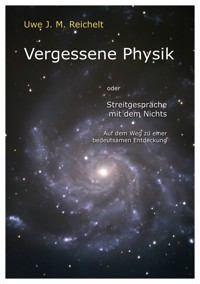
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Es geht um den Weg, eine Theorie zu finden, die untersuchen kann, ob die Planetenbahnen strukturiert und physikalisch geordnet sind oder dem Zufall unterliegen. Diese Theorie erweist sich als Verallgemeinerung der Schrödingerschen Quantentheorie und eröffnet damit den Weg, zur Beantwortung vieler offener Fragen der Physik. Z.B., sind die vier Kräfte vereinheitlichbar? Was ist Dunkle Energie? Gibt es Singularitäten in der Natur? Gibt es kleinstmögliche Schwarze Löcher? Was ist Dunkle Materie? Wie verlief der Urknall? Was löste ihn aus? Was ist das Vakuum?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Vorwort
Gibt es eine Physik, die vergessen wurde? Physik, die es einmal gab und die in Vergessenheit geriet, ist damit nicht gemeint, sondern dass vergessen wurde, anerkannte Physik auf ihre Möglichkeiten hin vollständig auszuloten, zu nutzen, um Fragen zu klären, die durchaus im Raum standen. Begeistert jedoch von den ohne Frage hochwichtigen Entwicklungen der modernen Physik ist die Naturwissenschaft auf der breiten Allee neuer Erkenntnisse vorangestürmt, nach dem großen Aufbruch durch neue Entdeckungen, der gründlich aufräumte mit der zur Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert noch geltenden Ansicht von der Vollendung der Newtonschen Physik und dem Glauben nun alles zu wissen und die Physik vervollständigt zu haben.
Ausgelöst wurde der Umbruch im naturwissenschaftlichen Denken durch Entdeckungen, die nicht hineinpassten in die klassische Welt der Physik, einige wichtige seien kurz angeführt: Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant, ist eine physikalische Obergrenze von Geschwindigkeiten, womit die klassische Addition von Geschwindigkeiten nicht gültig ist, des Weiteren gibt es eine kleinstmögliche Wirkung, die im Kleinsten jeglicher Kontinuität physikalischer Größen den Garaus macht, es gibt unerklärliche radioaktive Strahlung …
Die Entwicklung neuer physikalischer Prinzipien explodierte förmlich – Versuche zur Beschreibung des Atoms mündeten in die elementare Quantenphysik und weiter in die Wellenmechanik und Matrixmechanik, gefolgt von Quantenelektrodynamik und Quantenchromodynamik bis hin zum Standardmodell der Elementarteilchen, während die Obergrenze Lichtgeschwindigkeit die Spezielle Relativitätstheorie zur Folge hatte und diese die Allgemeine Relativitätstheorie, auch Gravitationstheorie genannt.
Dann aber tat sich eine Kluft auf: Die Allgemeine Relativitätstheorie war unvereinbar mit dem, was die Quantenphysik zu bieten hatte, doch beide erwiesen sich unabhängig voneinander als richtig.
Diese Kluft sollte mit allem, was Mathematik, Logik und Physik zuließ, überbrückt werden. Es wurden mehr Dimensionen notwendig, nunmehr 10 statt vier wie bisher und es entstanden gleich Theorien, die sogar durch Hinzufügen einer weiteren Dimension zusammengefasst werden konnten.
Nur die hochmodernen Experimente in genialen Beschleunigeranlagen wollten die erwarteten Dinge wie neue unbekannte, aber erwartete Teilchen und die Supersymmetrie bisher nicht hervorbringen. Die Physik kam den Erfolgen der modernen Astronomie und Astrophysik und den neuen Erkenntnissen nicht mehr hinterher.
Nach Jahren vergeblicher Mühen wurden einzelne Stimmen laut, die sporadisch nach einer neuen Physik [1] verlangten und auch wieder verstummten, da sie doch keinen Weg aufzeigen konnten, wie das gehen soll.
Den Hauptstrom naturwissenschaftlicher Forschung konnte derartige Kritik nicht erschüttern, sind doch in den letzten 120 Jahren durch physikalische Revolutionen und Entwicklungen Technik, Erkenntnis und die Zivilisation unglaublich vorangebracht worden.
Ist es da verwunderlich, dass beim großen Vorwärtsstürmen auf der breiten Straße der Erkenntnis niemand mehr auf das eine oder andere unscheinbare Blümlein am Wegessrand geachtet hat, um ja nicht den Anschluss zu verpassen?
Diese Blümlein sind nun die vergessene Physik, von der dieses Buch zumindest in einem Fall schildern soll. Der Autor würde das nicht können, wäre ihm nicht durch Zufall ein solches begegnet, hätte er es nicht bemerkt und mit unendlichen Mühen ausgegraben.
Und gerade dieses zunächst unscheinbare Blümchen entpuppte sich in gleich mehrfacher Hinsicht als äußerst bedeutsam.
Erstens zeigte sich, die klassische Newtonsche Mechanik war noch keineswegs ausgereizt, ein sehr wichtiges Segment war unbeachtet geblieben, man hatte übersehen, es zu bearbeiten, es war einfach vergessen worden und die seit Johannes Kepler offene Frage, ob die Planetenbahnen im Sonnensystem einem geordneten harmonischen System und damit physikalischem Prinzip folgen, blieb deswegen unbeantwortet, wurde stattdessen als zufällig und damit irrelevant angesehen und versank in Bedeutungslosigkeit.
Dem jedoch widersprechend ergab sich zweitens das ganze Gegenteil, mit diesem vergessenen, zunächst ganz unscheinbaren Blümchen lässt sich beweisen, die Planetenbahnen folgen einem physikalischen harmonischen Prinzip.
Und drittens zeigte dieser vergessene Teil der Newtonschen Mechanik, die Ableitung wäre nicht nur bereits im 19. Jahrhundert möglich gewesen, sondern darüber hinaus, dass darin auch Wege und Antworten zur Lösung weiterer vorhandener Probleme stecken, die bisher nicht zufriedenstellend oder gar nicht beantwortet werden konnten.
Wie aber geriet der Autor an dieses Blümlein?
Beizeiten war ihm schon während des Studiums trotz aller Begeisterung klar geworden, an der Spitze oder im Hauptfeld der physikalischen Forschung kann er nicht mithalten, er muss sich an kleinen zufällig gefundenen, möglicherweise wertlosen Gebieten der Physik ausprobieren, um damit vielleicht ein wenig zu ihr beizutragen, wenn auch abseits vom großen Wege.
Einem solchen Blümlein ist er in der fakultativen und mit viel Interesse gehörten Vorlesung über Astronomie während seines Studiums der Physik begegnet.
Der Professor, Hans-Ullrich Sander, ein würdiger älterer freundlicher Herr, erwähnte beim Abhandeln der Keplerschen Gesetze, dass jener seinem tiefen Glauben an eine harmonische Schöpfung folgend, angespornt durch den Erfolg seiner nicht genug zu würdigenden mathematischen Leistung, drei Gesetze gefunden zu haben, nach einer vierten Regel suchte. Die Abstände der damals sechs bekannten Planeten (einschließlich der Erde) von der Sonne sollte sie beschreiben. Kepler fand diese Regel nicht, viele nach ihm scheiterten ebenfalls und der Autor im jugendlichen Eifer dachte sich, das muss doch möglich sein, zumal die Datenlage besser ist und seit Kepler weitere Planeten entdeckt wurden. Solch eine Gruppe von gut gesicherten Werten müsste seiner Meinung nach physikalisch begründbar sein, zumindest mit dem Wissen der mittleren Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Hinweis des Professors, dass man in der modernen Astronomie, diesem Thema keine große Bedeutung mehr beimisst, nährte die Hoffnung, hier ein Feld vor sich zu haben, auf dem keinerlei Zeitdruck herrscht, der dem Autor während des ganzen Studiums ansonsten gehörig zu schaffen machte. Hätte er geahnt, dass inzwischen die Wissenschaft zu der Überzeugung gelangte, da gibt es keine Regel, es ist alles historischer Zufall und jedes Nachdenken darüber ist Zeitverschwendung und diese Meinung von bedeutenden Wissenschaftlern vertreten wird, er hätte das Blümlein wohl nicht weiter beachtet.
So aber verbiss er sich, wenn er sich auch dafür Zeit ließ, um so mehr in dieses Thema, je öfter alle Lösungsversuche und Denkansätze scheiterten, was dazu führte, dass er sich ständig mit der Theoretischen Physik auseinandersetzen musste, um im Studium Versäumtes nachzuholen und Neues hinzuzulernen.
Nach der zurückdenkend kaum fassbaren Zeit von etwa 15 Jahren gelang es ihm dann tatsächlich aus der guten alten klassischen Mechanik zwei Gleichungen herzuleiten, die ihn nicht nur jubeln ließen, sondern auch sicher machten, auf dem richtigen Wege zu sein, bei dem Blümlein schien es sich also wirklich um etwas Vergessenes zu handeln. Damit wird sich das Problem in eine physikalisch begründete Regel fassen lassen, war er sich ab diesem Moment sicher, es sind nur noch Lösungen dieser Gleichungen zu finden, die sich mit den astronomischen Werten decken - dies war allerdings, vielleicht zum Glück, sehr euphorisch gedacht.
15 Jahre sind schon eine unglaublich lange Zeit, nun aber lagen mehr als 30 völlig erfolglose vor ihm und ohne die gefundenen Gleichungen hätte er ganz sicher aufgegeben.
Dann aber half der Zufall, als er sich 34 Jahre nach Herleitung der Gleichungen entschloss, wenigstens die Herleitung der Gleichungen zu Papier zu bringen, in der Hoffnung, dass vielleicht jemand anderes damit etwas anzufangen weiß.
Was dann in den darauf folgenden Jahren geschah, davon handelt dieses Buch. Die vielen Zweifel und Irrungen, aber auch Erkenntnisse und Ergebnisse auf diesem Weg, sind als eine Art innerer Diskussion mit einem fiktiven Wesen eingebunden, weil sich der Autor in der Tat nicht sicher ist, dass, was dabei herauskam, allein nur seinem eigenen Nachdenken entwachsen ist oder doch in seinem Kopf ein unbekanntes Wesen mitgeholfen hat.
Uwe Reichelt
Januar 2023
Diese Erzählung, die ein Protokoll meiner wissenschaftlichen Arbeit ist, widme ich den Physikern meiner Familie und allen, die mich mit geduldigem Zuhören, Rat und Tat unterstützt haben.
Wenn es Ihnen auch so geht wie mir, das heißt Sie zu jener Sorte Mensch zählen, die ständig über Dinge nachgrübelt, von denen er ganz genau weiß oder zumindest ahnt, eine brauchbare Antwort kannst du nicht finden, dann wünsche ich Ihnen, eine gleiche Erfahrung wie mir, vielleicht können Sie es sogar besser angehen.
Seit ich denken kann, treibt es mich um zu erfahren, wie die Dinge wohl wirklich liegen, was sich verbirgt hinter den sichtbaren Kulissen unserer Welt. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Haben Sie eine Erklärung, wieso wir gerade auf diesem Planeten leben und uns für die Krone der Schöpfung halten? Doch halt! Schöpfung ist ja vielleicht schon gar nicht richtig, davon zumindest ist sicher ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer Zeitgenossen und sicher auch unserer Vorfahren überzeugt. Sie würden vielleicht sagen: „Bisher höchste bekannte Stufe der Evolution.“ Am Ende aber bleibt es bei der gleichen Frage und gleichermaßen bleibt sie unbeantwortet. Zugegeben, das Beispiel ist nicht gerade glücklich gewählt, vielleicht aber kann man erkennen, was ich meine.
Als Physiker habe ich gelernt, dass alles dem allgemeinen Chaos zustreben muss, also einer maximalen Durchmischung, so sagt es der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der die Entropie definiert und ihr ständiges Zunehmen in abgeschlossenen Systemen fordert. Ehrlich gesagt, der Name „Entropie“ war mir nie sonderlich sympathisch, stammt als Kunstwort in Zusammensetzung aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie „Umwandlung“ oder „Wendung“, was ihn mir aber auch nicht angenehmer macht. Doch an Namen kann man bestenfalls herummäkeln, dieser kennzeichnet jedenfalls ein Maß für die Unordnung. Und da diese nun eigentlich nur zunehmen kann, habe ich ein Problem, wenn ich mich in der Natur umschaue und doch gewisse Ordnungsprinzipien zu erkennen glaube und gleichzeitig zur Kenntnis nehmen muss, am Anfang soll es schon eine extreme Durchmischung, also alles andere als Ordnung gegeben haben.
Ich sitze auf meinem Sofa und könnte den Fernseher anmachen, um mich von dieser Grübelei abzulenken, ich könnte ein Buch lesen, das mich in eine andere Welt voller Klarheit entführt. Aber zu all dem habe ich gar keine Lust, irgendwie sind mir die Grübeleien lieber.
Die Abendsonne wirft ihre letzten Strahlen seitlich auf meine Balkongeranien, die glutrot aufleuchten und sehr malerisch vor dem Hintergrund der grünen Stieleichen im vor meinem Balkon liegenden Park und dem zarten Blau der Züge des Erzgebirges wirken. Auch dieser schöne Anblick könnte mich vom Wirbel der Gedanken erlösen, er tut es nicht. Immer wieder schleicht sich der Gedanke, ganz ohne mein Wollen in den Vordergrund, ein Gedanke, der mehr eine Frage ist, die sich mir nicht beantworten will und die man sich eigentlich auch nicht stellen muss, die mich aber nicht loslässt. Es ist die vielleicht nicht zu beantwortende Frage, warum es jetzt in der Welt, in unserem Dasein offensichtlich Ordnung gibt, wie ich meine, eine Ordnung, die ganz und gar aus der vielleicht größten aller Unordnungen hervorgegangen ist, obwohl es gerade andersherum sein sollte nach meinem Verständnis und dem, was ich gelernt habe?
Das unsägliche Chaos des Urknalls hat sich doch bis zur heutigen Zeit in eine geordnete Welt gewandelt, selbst wenn der eine oder andere diese Ordnung mit Einschränkungen betrachten sollte, unumstößlich muss man zugeben, mehr Ordnung als zum Urknall ist in unserer Welt. Und dann steht da die Aussage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, dass sich alles zur „Unordnung“ hinbewegen muss! Wie geht das zusammen? Den zweiten Hauptsatz will ich nicht anzweifeln, versuche ich hier vielleicht etwas aufeinander anzuwenden, was man einfach nicht tun darf?
„Da musst du etwas gründlicher und systematisch mit deinen Gedanken umgehen“, meldet sich eine Stimme.
Ich sehe mich um. Im Zimmer ist niemand. Radio und Fernseher sind ausgeschaltet. Aber die Stimme war doch ganz deutlich zu vernehmen.
„Na klar, deutlicher als ich kann man nicht sprechen“, meldet sie sich wieder.
„Ich sehe dich nicht. Wo und wer bist du?“, frage ich unsicher und bin ziemlich fest davon überzeugt, darauf wird die Stimme nicht antworten.
„Ist mir klar, dass du mich nicht siehst“, zerbricht sie meinen Zweifel.
„Aber, ich höre dich doch“, ist alles, was ich zu entgegnen weiß.
„Als Physiker solltest du wissen, dass Hören etwas mit Schall und deinen Ohren zu tun hat.“
Richtig, darauf hatte ich noch gar nicht geachtet, es waren gar nicht meine Ohren, die diese Stimme wahrgenommen hatten. Auf irgendeine andere Art und Weise musste sie zu mir sprechen. Ein wenig wird mir unheimlich. Es ist offensichtlich nicht das, was ich bisher unter einer Stimme verstanden habe. Es ist eine mir unbekannte Vermittlungsform. Ich krame in meinem Gedächtnis nach wissenschaftlicher Erklärung und bin enttäuscht.
„Zerbrich dir nicht den Kopf, du kannst es ohnehin nicht herausfinden“, tröstet sie mich.
Jetzt versuche ich die Stimme zu analysieren, das wäre doch gelacht, wenn ich nicht dahinter käme. Ist sie weiblich oder männlich, jung oder alt, verraucht oder klar, spricht sie irgendeinen Dialekt? Doch zu meinem allergrößten Erstaunen kann ich keine dieser doch eigentlich sehr einfachen Fragen entscheiden. Sie spricht keinen Dialekt, sie ist weder männlich noch weiblich, nicht alt, nicht jung. Nicht einmal die Stimmlage kann ich zuordnen, rauchig klingt sie nicht und auch als klar kann ich sie nicht erkennen. Das gibt es doch nicht! Nun meldet sich der Physiker in mir zu Wort, wenn du sie nicht als Stimme einordnen kannst, dann nenn sie doch einfach „Nichtstimme.“
„Gar nicht mal so schlecht“, lacht die Nichtstimme. Ist das überhaupt ein Lachen? Nicht einmal das kann ich mit Sicherheit sagen. Woher weiß sie überhaupt, was ich denke?
„Wieso weißt du, was ich denke?“, frage ich ein wenig erbost.
„Warum soll ich das nicht wissen, ich weiß sehr viel, reg dich nicht auf, ich trage nichts weiter, darauf darfst du bauen.“
Ich beruhige mich. Dann aber packt mich die Neugier. „Wer bist du überhaupt, es wär schön und auch höflich, du stelltest dich mir vor. Wenn du in meine Gedanken schauen kannst und ich nicht einmal weiß, wer du bist, finde ich das sehr einseitig, gelinde ausgedrückt.“
„Da gebe ich dir recht und ich könnte mich auch gern vorstellen.“
„Wieso könnte? Was hindert dich?“
„Du stehst dem etwas im Wege.“
„Ich? Unsinn, ich möchte ja, dass du dich vorstellst. Warum soll gerade ich dem im Wege stehen?“
„Um mich vorzustellen, braucht es Geduld im Zuhören und auch etwas Zeit. Und Geduld vermisse ich an dir hin und wieder. Willst du Zeit und Geduld aufbringen, mir zuzuhören? Du weißt inzwischen, wie ich das mit dem Hören meine.“
„Natürlich will ich“, da ist jetzt Trotz und Neugier vereint in mir.
„Also gut, versuchen wir es“, ruhig und so als hätte ich sie nie darum ersucht sich vorzustellen, so als würde sie sich bei jeder Gelegenheit jemandem vorstellen, beginnt die Nichtstimme mit einer Frage, „kannst du dir vorstellen, dass vor allem Sein irgendetwas war?“
Das verblüfft mich nun doch. Eine Frage gleich zu Beginn? Aber ich spiele mit.
„Also, ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen. Was sollte vor allem Sein denn an Existenz überhaupt möglich sein?“
„Nun nehmen wir sehr vereinfacht an, du wolltest eine Kiste bauen“, fährt die Nichtstimme unbeeindruckt fort, „was käme da vor der Kiste?“
„Ist ja albern, natürlich würde ich mir einen Plan machen, eine Skizze oder so, aber was hat das mit dir zu tun?“
„Sehr viel, du wirst sehen, falls deine Geduld ausreicht.“
„Sie reicht bestimmt aus.“
„Dann hör zu. Demnach kannst du mir folgen, wenn ich sage, dass vor allem Sein auch so etwas wie ein Plan gewesen sein muss. Plan ist sehr primitiv gesagt, besser und für dich zugänglicher wäre wohl der Ausdruck Naturgesetz.“
„Das klingt mir sehr nach ‚Das Bewusstsein bestimmt das Sein’ und diese These kenne ich wohl, obwohl ich in meiner Ausbildungszeit das glatte Gegenteil behaupten musste, um zu bestehen. Ich selbst“, fällt mir dann ein, „habe übrigens heimlich doch schon immer angenommen, dass vor dem Sein das Bewusstsein kommt.“
„Also gut, dann gehen wir davon aus, dass vor dem Sein das kam, was das Sein bestimmt und regelt und nennen das die Naturgesetze, und meinen die wahren, nicht unbedingt nur die durch euch erkannten.“
„Ja, gut, aber wo sollen die Naturgesetze herkommen?“
„Langsam, eins nach dem anderen. Geh jetzt einfach nur davon aus, vor allem Sein, noch ehe auch nur das Winzigste einem Gesetz folgen konnte, musste das Gesetz existieren.“
„Na schön, bist du etwa das Gesetz?“
„Dann hätte ich dir das in einem Satz sagen können, was oder wer ich bin“, fährt mich die Stimme, wie ich heraushören kann, etwas unwirsch an und ich ärgere mich über meine unüberlegte Frage.
„Wenn nun Gesetze existieren, nach denen alles haargenau abzulaufen hat, ich meine ganz exakt, was wäre dann mit dem Sein, auf das die Gesetze unumschränkt wirken?“, geht eine neue Frage an mich.
Und diesmal will ich nicht vorschnell antworten und überlege. Nach einer Weile sage ich, „nun, dann wäre wohl alles so wie es in unserer Welt eben ist.“
„Da bist du verdammt schwer im Irrtum! Was wäre das für eine Welt, in der alles abläuft wie in einem Uhrwerk? Zu jedem beliebigen Zeitpunkt könntest du von diesem Zustand auf die Zustände zu jedem anderen Zeitpunkt eineindeutig schließen. Alles wäre bis aufs feinste bestimmt. Wozu, frage ich dich, soll es dann überhaupt ein Sein geben, wenn rein theoretisch alles bestimmt werden kann?“
„Ja, aber …“, will ich kontern, dass so etwas Kompliziertes doch wohl nie praktisch zu berechnen ginge, halte mich aber im letzten Augenblick zurück, an meiner Abstraktionsfähigkeit will ich keine Zweifel aufkommen lassen.
„Starre Gesetze würden sogar von vornherein verhindern, dass so etwas wie dieses Sein überhaupt existieren kann“, nimmt die Stimme unbeeindruckt ihre Rede wieder auf, als hätte sie meinen gedachten Einwand nicht wahrgenommen, was ich nach allem, das ich bisher von ihr weiß, sehr bezweifeln muss, „es gäbe mit solchen Gesetzen gar kein Sein“, schließt sie fast kategorisch.
„Wieso soll es mit starren Gesetzen ein Sein nicht geben können?“, bin ich nun doch verwundert, denn die Absolutheit der Aussage stört mich.
„Weil es kein Davor geben kann, denn auch im Davor hat ein solches Sein irgendeinen bestimmten Zustand, also gibt es kein Davor; weil dort ja auch schon Sein ist und wo es kein Davor gibt, gibt es auch kein Danach und ohne Danach kein Sein.“
„Hmm …“, ich will nicht zugeben, dass ich diesem Gedanken nicht ganz folgen kann, aber die Nichtstimme durchschaut mich.





























