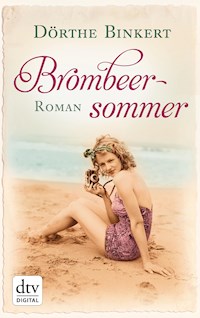Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Epochen, drei Frauen, drei Schicksale In den Geschichten von Martha, Maria und Magda im schlesischen Gleiwitz spiegelt sich die Geschichte einer Grenzregion wider: die Geschicke von Deutschen, Polen und Tschechen, Christen und Juden, die liebten und hassten, Familien gründeten und einander verließen, vertrieben wurden und sich wiederbegegneten. Gekonnt spannt Dörthe Binkert den großen Bogen von den 20er- bis zu den ausgehenden 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Mit viel Gespür und noch mehr Herzblut zeichnet sie das Porträt einer Zeit und einer Region, in der Freude und Leid nur einen Wimpernschlag voneinander entfernt waren.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dörthe Binkert
Vergiss kein einziges Wort
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
PERSONENVERZEICHNIS
Die Bewohner der Paulstraße
Carl Strebel, geb. 1869 in Breslau, Beamter bei der Deutschen Reichsbahn
Martha Strebel, geb. Wieczorek, geb. 1881 in Oppeln, seine Ehefrau, die beiden haben sieben Kinder, eines davon ist im ersten Lebensjahr gestorben
Konrad, geb. 1900, er heiratet 1922 die polnischstämmige Paulina Kuczynski aus Gleiwitz, Kinder: Erwin und Gerda
Heinrich, geb. 1902, er heiratet 1935Helga Mahlkorn, Kinder: Gudrun und Hermann
Ida, geb. 1904
Hedwig, geb. 1907
Anton, geb. 1915, gestorben im 1. Lebensjahr
Klara, geb. 1916
Emma Luise, geb. 1921, zieht später mit ihrer Tochter Traudel zu Maria Fabisch in die Daimlerstraße
Andere Hausbewohner
Agnes und Josef Liedka und ihre Töchter Bärbel und Rita
Familie Dombrowa
Familie Nowak
Familie Klossek
Das alte Ehepaar Pflaume
Die Witwe Josefa Baron (danach Herr Kowollik)
Maria Stolp
In der Annastraße
Ladenbesitzerin Anna Kuznik und ihre Tochter
Magda, geb. 1920, Luises beste Freundin
Die Bewohner der Daimlerstraße
Oben im Haus
Maria Fabisch, geb. Krause, geb. 1909, seit 1934 verheiratet mit
Wolfgang Fabisch, Postangestellter
Die Fabisch-Kinder:
Erika, geb. 1935
Peter (Peterle), geb. 1941
Wolf (Wölfchen), geb. 1944
Unten im Haus
Fritz Schomberra, geb. 1890, Schalterbeamter bei der Post
Hildegard Schomberra, geb. 1904
Die Schomberra-Kinder:
Isolde, geb. 1933
Lotte, geb. 1940
Josef (Josel), geb. 1943
Weitere Bewohner der Daimlerstraße
Der Blockwart Wagroschek
Adelheid Sossna und ihre Tochter Rosel, ziehen zum Kriegsende bei Maria Fabisch ein
Herr Piontek
Die Bewohner der Husarska
Magda Kuznik, nun verheiratet mit
Aron Sperber, geb. 1906 in Lemberg
Ewa, ihre gemeinsame Tochter
Florentyna Semkowicz aus Lemberg, ihre Mutter und ihre Schwester Leokadia
Der Strom der Geschichte schwemmt die kleinen Geschichten der Individuen fort und lässt sie untergehen, die Woge des Vergessens löscht sie aus dem Gedächtnis der Welt …
Schreiben bedeutet unter anderem auch, am Ufer entlanggehen, stromaufwärts fahren, schiffbrüchige Existenzen auffischen und Strandgut wiederauffinden, das sich an den Ufern verfangen hat, um es zeitweilig auf einer Arche Noah aus Papier unterzubringen …
Claudio Magris: Utopie und Entzauberung
Viele von uns glauben, dass die EU nach wie vor die außergewöhnlichste, ehrgeizigste und liberalste Allianz in den Annalen der Menschheitsgeschichte ist. Sie war die Hüterin einer bis dato einzigartigen, siebzig Jahre währenden Periode des Friedens und der Prosperität. Vor dem Hintergrund jahrhundertelangen Blutvergießens ist sie ein heroisches Projekt; nirgendwo sonst auf der Welt kam man näher an einen offenen, freidenkenden, toleranten Staatenbund zwischen Nationen, die sich einst bekriegten.
Ian McEwan
in seiner Rede am 12. Mai 2017
in der Central Hall in Westminster/London
Teil 1: 1921–1938
Der Archivar von Gleiwitz blättert behutsam in vergilbten Akten. Verblasste Handschriften, Abkürzungen, die keiner mehr kennt. Beschädigte Buchstaben alter Schreibmaschinen auf Kopien aus durchscheinendem Papier. Punkte, die in mürbes Papier schlagen wie Granatsplitter in Fassaden. Urkunden, Heiratsverträge, Testamente und Erbteilungen. Beglaubigungen, Verordnungen, Register.
Lebendige vergangene Zeit.
1921
Die ganze Nacht ging ein Wind durch die Straßen, wirbelte Flugblätter aus der Gosse auf, riss am hellen Grün der Junibäume.
Um Mitternacht setzten die Wehen ein. Carl schlief so fest, dass er nicht bemerkte, wie seine Frau aufstand und in die Küche ging. Auch im Bett der Mädchen regte sich nichts, nur eine seufzte leise im Schlaf, wahrscheinlich war das Ida, die so lebhaft träumte.
Die Wehen waren noch nicht sehr heftig, kein Grund, jemanden aufzuwecken. Nicht beim siebten Kind. Überhaupt wollte Martha nicht ins Krankenhaus. Sie würde nach der Hebamme schicken, wenn es so weit war – »falls das Kind nicht von allein rausrutscht«, wie die Hebamme bei der Untersuchung gesagt hatte, »es ist ja nicht Ihr erstes«.
Auf dem Küchentisch musste noch ein Krug mit kaltem Tee stehen, einen Becher fand Martha blind, ohne Licht zu machen. Handgriffe wie im Schlaf. Nicht, dass Klara noch aufwachte in ihrem Kinderbettchen.
Martha lehnte sich gegen das Fensterkreuz, in ihrem Rücken das schmerzhafte Ziehen und die dunkle, sternlose, windige Nacht. Der ruhige Atem Klaras. Der Frieden, der von schlafenden Kindern ausgeht. Das Knacken der Dielen, ein unregelmäßiges Geräusch, in dem man keine Gesetzmäßigkeit erkennt. Der Wind. Sonst war alles still. Das Haus in der Paulstraße schlief dem Tag entgegen, als stünde nichts bevor.
Am Morgen gingen Carl und die älteren Kinder wie gewöhnlich zur Arbeit und in die Schule. Die Brote für alle hatte Martha schon am Vorabend geschmiert, so, wie sie es immer machte. Auf dem Pergamentpapier blühten inzwischen fettige Stellen vom Griebenschmalz. Sechzehn Scheiben Brot, je zwei Klappstullen für die Männer, eine für die Mädchen. Und noch ein Glas eingemachte Gurken für Carl.
»Die Strebel-Gurken sind bei den Kollegen berühmt«, sagte Carl anerkennend und verstaute das Gurkenglas in der braunen Aktentasche. Es störte ihn, dass die Tasche sich dabei einseitig ausbeulte und unprofessionell gepackt wirkte, aber die Gurken waren es wert. Er kniff Martha unbeholfen in die Wange. »Wird schon alles gut gehen, Martha, wirst sehen.«
»Jetzt geh schon«, erwiderte Martha, »und sag der Frau Liedka unten Bescheid. Sie soll die Hebamme rufen, es ist bald so weit.«
»Ja«, nickte Frau Liedka und zog den geblümten Morgenmantel, gelbe Rosen auf blauem Grund, enger über der vollen Brust zusammen, als Carl vor ihr stand. »Sicher doch mach ich das.« Sie nahm ihm den Zettel aus der Hand, auf dem Martha mit ihrer winzigen, säuberlichen Schrift die nötigen Angaben notiert hatte. »Ich geh auch gleich hoch und sehe nach Ihrer Frau und der Kleinen. Die Klara kann solange hier unten mit meiner Rita und der Bärbel spielen. Es wird ja hoffentlich nicht so lange dauern … obwohl, man weiß nie.«
Aber erst öffnete sie das Fenster und sah Carl nach, wie er auf sein schwarzes Fahrrad stieg, die Paulstraße hinunterfuhr, nach wenigen Metern links in die Barbarastraße einbog und in Richtung Hindenburgbrücke verschwand, ein wenig schwankend im Wind, eine Hand am Hut.
Immer pünktlich aus dem Haus und bei der Arbeit, der Strebel, dachte Frau Liedka bei sich, ein richtiger preußischer Beamter. Der hält nicht bei jeder Destille an, weil er einen Schluck Gleiwitzer Kanalwasser braucht. Er kam ja auch von da oben aus Breslau, wo alles schöner, größer und besser und noch dazu näher bei Berlin war. Dafür sah man ihn bei der heiligen Messe nie, seine Frau und die Kinder ebenso wenig. Es war ihr, Agnes Liedka, gleich klar gewesen, dass sie Evangelen waren, als sie einzogen, so protestantisch, wie die Preußen sich das nur wünschen konnten. Aber hier, in diesem Haus in der Paulstraße, hielt man trotzdem auf gute Nachbarschaft. Egal, was in der Straße geredet wurde. Übrigens war die Martha Strebel Oberschlesierin, auch wenn sie nicht katholisch war, eine geborene Wieczorek aus Oppeln. Irgendwann beim Kaffee in der Küche hatte Martha Strebel, geborene Wieczorek, ihr erzählt, dass sie mit fünfzehn nach Breslau gegangen und »in Stellung« bei einer Advokatenfamilie war, als sie den Strebel kennenlernte. Eine gute Partie, der Carl, zwölf Jahre älter als die Martha und schon Beamter bei der Reichsbahn, als sie heirateten.
Noch ein Schrei, und das Kind ist da. Gerade als die Hebamme zur Tür hereinsegelt, als hätte der Wind, der immer noch nicht nachgelassen hat, sie mit einer heftigen Bö mitsamt ihrem Medizinalkoffer ins Zimmer geweht.
Die Hebamme sieht das Kind herausflutschen, ehe sie Martha noch richtig begrüßen kann. Frau Liedka aber kennt sich aus, sie hat alles vorbereitet, Wasser, Tücher.
Marthas strapazierter, erschlaffter, schweißnasser Körper. Frau Liedka wischt ihr mit einem feuchten Waschlappen die Stirn und streichelt ihr die Hand, während die Hebamme sich um das Kind kümmert. Der erste Schrei ist kräftig.
»Es ist ein gesundes kleines Mädchen«, sagt die Hebamme und legt Martha den Säugling in den Arm. »Wie soll es denn heißen?«
Das Kind soll Emma Luise heißen.
Es ist Samstag, der 4. Juni 1921.
Frau Liedka brachte Suppe.
»Eine Hühnerbrühe mit Nudeln, da kommt jeder zu Kräften, das bringt die schwächste Mutter wieder auf die Beine, auch Sie, Frau Strebel.« Sie büschelte das Kissen in Marthas Rücken, damit sie die Suppe besser löffeln konnte.
Martha lächelte erschöpft und ein bisschen vage, und Frau Liedka hielt das fremde Würmchen zärtlich in die Höhe.
»Die Heilige Mutter Gottes meint es gut mit Ihnen: sechs gesunde Kinder! Was soll ich da sagen mit meinen kümmerlichen zweien! Eine Wallfahrt nach Tschenstochau würde ich machen, Frau Strebel, auf den Knien! Aber nu ruhen Sie sich erst mal aus. Machen Sie sich keine Sorgen, die Kleinen spielen unten wie die Engelchen. Bärbel, meine Ältere, passt schon auf, dass sie keinen Unsinn machen. Bleiben Sie ja noch ein paar Stunden im Bett, und schicken Sie mir auch die Hedel runter, wenn sie von der Schule kommt. Es ist genug Suppe da.«
Ja, nickte Martha und war dankbar.
Sieben Kinder hatte sie geboren in zwanzig Jahren, zwei weitere vorzeitig verloren. Jetzt war sie eine Frau von vierzig, und während sie ständig in anderen Umständen gewesen war, ihr Leib anschwoll und abschwoll, waren Reiche zusammengebrochen, Monarchen gestürzt, hatte der Krieg die Welt verändert.
Aber was verstand sie schon davon. Ihr Lebensweg war gesäumt von Schwangerschaften und Geburten. Martha zählte es an den Fingern nach. Konrad war der Erste, er war im Jahr 1900 zur Welt gekommen, da war sie gerade mal neunzehn. Konrad, ihr Erstgeborener, ihr Liebling …
Und dann war es weitergegangen mit Heinrich, Ida, Hedwig, und nach zwei Fehlgeburten, als schon niemand mehr dachte, dass sie ein weiteres Kind austragen könnte, kam der kleine Anton. Ach Gott, wie blau und winzig er bei der Geburt gewesen war! Ganze vier Monate hatte er leben dürfen, und nichts hatte sie, hatte der Arzt für ihn tun können.
»Manchmal sind auch wir Ärzte machtlos«, hatte Dr. Wolfssohn gesagt, den Kopf geschüttelt und das tote Kind behutsam zugedeckt. »Sein Herz war nicht stark genug. Es konnte den kleinen Anton nicht durchs Leben tragen.«
Kurz nach Antons jämmerlichem Tod war sie wieder schwanger geworden. Sie hatte sich nicht darüber freuen können, erbrach sich über Monate, als hätte sie das Kind am liebsten hervorgewürgt und ausgespuckt. Dabei war Klara gesund, ein kleines, gesundes, unschuldiges Mädchen, das in Marthas Trauer um drei verlorene Kinder hineingeboren wurde. Mit dem neuen Kind, dessen Name ihr noch nicht leicht über die Zunge ging, war es jetzt endgültig genug. Doch das sagte sie nicht. Nicht der Frau Liedka.
Und das Luischen lag nun auf ihrer Brust. Wie ein kleiner Frosch. Mit O-Beinen. Ja, genau so.
Das helle Hufgeklapper leichter Reitpferde dringt bis ins Schlafzimmer hinein, wo Martha einnickt und immer wieder aufschreckt. Hedwig hat sich nach der Schule rührend um alles gekümmert. Sie hat das Luischen begeistert auf dem Arm gewiegt und das neue Strebel-Kind herumgetragen, so ernst und bedeutungsvoll, als wäre sie die Säuglingsschwester vom Dienst. Jetzt öffnet sie aber das Fenster und lehnt sich gefährlich weit hinaus, um Pferde und Reiter zu entdecken, die blonden Zöpfe baumeln in der Luft. Doch vom ersten Stock aus sieht man nicht viel, und das Trappeln entfernt sich auch schon wieder.
Plötzlich ist Martha voller Unruhe, als hätte das ungewohnte Geräusch sie aus der Mutter-Kind-Blase in die Welt zurückgeholt. Sie wickelt sich in den blauen Häkelschal, den Ida ihr zu Weihnachten geschenkt hat, und stellt sich zu Hedwig ans Fenster.
»Siehst du den Vater kommen, Hedel? Wo bleibt der nun wieder, ausgerechnet heute! Und die andern sollten auch schon längst da sein. Heinrich. Und Ida. Ida müsste auch nicht immer mit ihren Freundinnen auf der Wilhelmstraße rumtrödeln nach der Arbeit.«
»Er kommt!«, ruft Hedwig, den Kopf immer noch draußen im Freien, und Martha, die einen Schwächeanfall hat und auf einen Küchenstuhl gesunken ist, sagt ärgerlich zu ihrem Mann, als er die Wohnung betritt: »Da bist du ja.«
Carl antwortet nichts darauf, nimmt den Hut ab, hängt ihn auf einen Haken, stellt die ohne das Gurkenglas nun wieder schmalbrüstig eingesunkene Aktentasche darunter auf den Boden, besinnt sich erst jetzt darauf, dass er vermutlich ein Kind bekommen hat, und sieht Hedwig, die das Luischen, rosafarben eingewickelt, ihm hinstreckt, als hätte sie es zur Welt gebracht.
»Da haben wir also eine neue Tochter«, sagt Strebel und räuspert sich, weiß der Himmel, ob aus Verlegenheit, Enttäuschung oder Rührung. Er nimmt das Kind, schaut auf es nieder und reicht es gleich darauf mit ausgestreckten Armen Hedwig zurück.
»Einen haushohen Frauenüberschuss produzierst du da, Martha«, entfährt es ihm mit einem zwischen Schnurrbart und Kinnbart eingeklemmten Lächeln. Sein Gesicht ist rot und angestrengt. Eigentlich ist er mit seinen Gedanken gar nicht richtig da. Endlich schafft er es doch, Martha zu umarmen. Er zieht sie vom Stuhl hoch und drückt sie an sich. Streicht ihr kurz über das Haar und den Rücken.
»Ich sag dir, das gibt wieder Krieg«, murmelt er über ihren Kopf hin, »die Stimmung brodelt. Ich bin kaum durchgekommen, die Straßen sind verstopft von Volk. Nur weil das Oberkommando der alliierten Streitkräfte hier stationiert ist, schießen sie nicht aufeinander. Niemand traut sich, die Franzosen anzugreifen, obwohl die durch die Stadt reiten, als wären sie die neuen Könige von Preußen. Und dabei weiß jeder, dass sie gemeinsame Sache mit den Polen machen. Das sieht ein Blinder, Frankreich will, dass Polen Oberschlesien kriegt beim großen Verteilfest der sogenannten Friedensverhandlungen von Versailles. Mit unserer ganzen blühenden oberschlesischen Industrie, Martha. Der Erzfeind Deutschland soll nicht mehr auf die Beine kommen, das wollen die Franzosen.«
Wie angestrengt er atmet. Wut und Bitterkeit nehmen ihm die Luft.
»Mein Gott, Carl«, sagt Martha, »jetzt setz dich doch erst mal hin! Wie du dich wieder aufregst! Du wirst die Weltpolitik nicht ändern und auch nicht, dass wir den Krieg verloren haben. Immerhin setzt du ein Kind nach dem andern in die Welt, egal, wie die Welt da draußen aussieht.«
»Den Krieg verloren! Martha! Was plapperst du da? Kein feindlicher Soldat hat einen Fuß nach Deutschland gesetzt in diesem Krieg. Erst jetzt hocken die Franzosen als Besatzer im Ruhrgebiet. Und hier bei uns, wo sie für Frieden sorgen sollen und stattdessen Feuer schüren! Nein, Martha, ich versteh die Welt nicht mehr.«
Er schüttelt den Kopf. Er will sich aufregen. Er spricht laut, und es ist ein Wunder, dass das neugeborene Luischen, noch fremd in der Welt, nicht zu weinen anfängt bei dem Polterton.
»Oberschlesien ›urpolnisches Gebiet‹? Dass ich nicht lache! Müssen wir den Polen erklären, dass Kasimir der Große schon 1335 freiwillig auf Schlesien verzichtet hat? Seitdem ist Schlesien nicht mehr polnisch gewesen. Zu Böhmen hat es gehört, zu Österreich, zu Preußen, zum Deutschen Reich. Und jetzt erkennen Korfanty und seine Spießgesellen nicht mal die Volksabstimmung an. Dabei waren die Modalitäten der Abstimmung mit Polen abgesprochen! Neunundfünfzig Prozent der Menschen haben für den Verbleib bei Deutschland gestimmt. Ist das keine klare Aussage?«
Da steht er vor ihr, Martha hat sich längst hingesetzt, die Worte rauschen in ihren Ohren, knacken und kratzen, als wäre das Radio nicht richtig eingestellt.
»Aber ich sag dir, Martha: Dass es im März überhaupt eine Abstimmung gegeben hat, das haben wir nur den Engländern zu verdanken. Die sorgen sich nämlich um das Gleichgewicht der Kräfte auf dem Kontinent.«
Carl sinkt erschöpft auf einen Stuhl. Martha schweigt, wiegt das Luischen leise in ihrem Arm, müde ist sie, sehr müde.
»Bring mir ein Bier, Hedel«, sagt Carl. Und ehe er noch trinkt, ehe Malz und Hefe ihn vielleicht beruhigen, grollt er: »Am Boden wollen sie uns halten, die Franzosen. Uns die Industrie nehmen. Dazu die irrwitzigen Reparationsforderungen, die keiner erfüllen kann. Und jetzt sehen sie einfach wohlwollend zu, wie Korfanty sich mit Gewalt holen will, was die Abstimmung den Aufständischen verweigert hat! Aber das sag ich dir: Oberschlesien hat abgestimmt, Oberschlesien hat sich geäußert. Zum Deutschen Reich wollen wir gehören. So ist es, und so wird es bleiben. «
Mein Gott, wie schnell war das neue, das zwanzigste Jahrhundert, das so ehrgeizige Erwartungen genährt hatte, in das Deutschland so kraftstrotzend eingetreten war, auf Grund gelaufen!
Carl hatte die deutschen Größenfantasien geteilt, während Martha lediglich froh gewesen war, dass Carl 1914, als der Krieg ausbrach, nicht eingezogen wurde. Die anfängliche Kriegsbegeisterung war denn auch wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen, als der schnelle Sieg sich nicht einstellte und immer mehr Krüppel nach Hause kamen, Schwerverletzte, Amputierte, Kriegsblinde, leibhaftige Beweise der Niederlage. Martha hatte genug damit zu tun, die Kinder irgendwie durchzubringen, es herrschte ja Mangel an allem, sie mischte sich in die ewigen Diskussionen über den Ausgang des Krieges nicht ein. Für die Politik war Carl zuständig, mit der Politik hatte sie sich nie beschäftigt. Aber kaum war der elende Krieg 1918 vorbei gewesen, gingen die Kämpfe in Schlesien weiter, weil die Polen ihrem neu gegründeten Staat auch Oberschlesien einverleiben wollten. Blutige Aufstände hatten sie angezettelt in Oberschlesien, die Polen, einen Haufen Tote hatte es gegeben. Darum war auf Beschluss der Siegermächte am 21. März dieses Jahres die Volksabstimmung abgehalten worden. Aber wozu stand französisches, italienisches und englisches Militär in Schlesien, wenn sie nicht mal nach der Abstimmung für Ruhe sorgen konnten?
Martha ist es, als bliese noch immer der Wind, als bliese er durch ihren widerstandslosen, ausgelaugten Körper hindurch und nähme sie mit. Und das wollte sie: mitgenommen werden vom Wind, irgendwohin, wo keine Soldaten durch die Stadt ziehen und niemand aufeinander schießt, schon gar nicht Polen und Deutsche, die doch auf demselben Stück Land zu Hause sind. Irgendwohin, wo Männer ihren Frauen einen Ring oder Blumen bringen, wenn sie ein Kind bekommen haben, und zärtliche, leise Worte finden.
Aber der Wind hat sich gelegt, und es hat zu regnen begonnen.
***
Ida, Jahrgang 1904, die älteste der Strebel-Töchter und inzwischen siebzehn, allgemein »die schöne Ida« genannt, als sei die Schönheit nicht ohne sie und sie nicht ohne die Schönheit zu denken, macht eine Schneiderinnenlehre bei Frau Munske in der Moltkestraße. Schon als kleines Kind hat sie gern Stoff angefasst. Martha konnte sie für Stunden beschäftigen, wenn sie ihr Stoffreste und Wollfäden zum Spielen gab. Idas Tastsinn war womöglich noch ausgeprägter als ihre Schönheit, und sie entwickelte früh Sinn für Eleganz und Luxus, was ihr später fälschlich als Hochmut oder Koketterie ausgelegt wurde. Aber sie ertrug nun mal am besten Samt und Seide auf der Haut, und ordinäre Wolle juckte sie bis zum Wahnsinnigwerden. Martha, die weder Samt noch Seide zu bieten hatte, musste für Ida seit je spezielle Unterwäsche nähen, aus mercerisierter Baumwolle oder Kunstseide, langärmelig, damit das Kind in den eisig kalten Wintermonaten warme Wollsachen darüber tragen konnte. Es lag nahe, dass Ida den Schneiderinnenberuf wählte, allein schon, damit sie ihre Kleidung bald einmal selbst nähen konnte. Martha hatte noch genug andere Kinder zu behäkeln, zu bestricken und mit Kleidern auszustatten.
»Ida schlägt deiner Großmutter nach«, pflegte Martha manchmal vor dem Einschlafen zu Carl zu sagen, »sie hat einen Sinn fürs Elegante wie Großmama Strebel. Hier in der Provinz wird sie nicht glücklich werden. Einen eigenen Salon in Breslau sollte sie aufmachen, die Ida! Am Anfang könnte sie doch bei deiner Mutter wohnen …« Geradezu schwärmerisch hing Martha an diesem Gedanken.
»Und wer, bitte schön, zahlt ihr die Einrichtung für den eigenen Salon?«
»Ach, Carl, du weißt sehr gut, die Omama hat deiner Mutter so einiges hinterlassen, und deine Mutter mag die Ida, weil sie hübsch ist und gute Manieren hat.«
Carl kürzte das Ganze ab. Er redete nicht gern Jahre im Voraus über möcht’ und würd’ und könnte. »Und schon näht unsere Ida den Gräfinnen Schaffgotsch und Ballestrem die Ballkleider für die Wintersaison in Breslau und Berlin. Und geht gleich mit auf den Ball. Dort, wo die Prinzen warten. Sei nicht albern, Martha!«
»Bei dir darf man von gar nichts träumen«, sagte Martha gekränkt. »Aber mit deiner Mutter red ich trotzdem.«
Jetzt ist Ida an diesem 4. Juni 1921 endlich zurück in der Paulstraße und hat schon Streit mit Heinrich, ihrem knapp zwei Jahre älteren Bruder, der von dem neuen Kind kurz Kenntnis genommen hat und schon wieder dabei ist, das Haus zu verlassen.
»Sie haben mich heute auf dich angesprochen«, sagt er und knufft Ida unsanft in die Seite. »›Die schöne Ida umgibt sich gern mit einem ganzen Pulk von Männern‹, hat es geheißen. ›Die zieht die Lehrlinge von der Dachdeckerfirma Felke & Sohn aus der Moltkestraße wie einen Kometenschweif hinter sich her.‹ Vielleicht solltest du mal ein bisschen auf deinen Ruf achten, liebe Ida!«
»Ich bin nicht deine ›liebe Ida‹, und worauf du angesprochen wirst, ist mir wurscht. Ich arbeite in der Moltkestraße und die Jungen von der Dachdeckerfirma auch. Soll ich vielleicht die Straßenseite wechseln, wenn die da längskommen?« Angewidert ist sie, die Ida. »Ach, kümmer dich doch um deine eigenen Angelegenheiten. Die sind sowieso viel erhabener. Maschinenbau- und Hüttenschule Gleiwitz, wenn das keine Ausbildung ist … oder wäre, falls du’s schaffst! Ein Ingenieur steht natürlich so hoch oben, dass er auch einem Dachdecker auf den Kopf spucken kann!«
»Ida, was ist das für ein Ton! Heinrich, Schluss jetzt, was ist denn bloß los mit euch!« Das ist Martha.
»Dem Heinrich passt es nicht, dass unter den Dachdeckerlehrlingen auch Polen sind, das ist los«, ruft Ida hitzig. »Und es passt ihm nicht, wenn einer aus seinem Verband der Heimattreuen Oberschlesier seine Schwester mit einem Polen auf der Straße stehen und sprechen sieht.«
Heinrich packt die Wut. Schlag auf Fall verlässt er die Küche und knallt die Tür hinter sich zu, ohne ein Stück von dem Streuselkuchen gegessen zu haben, den Ida aus der Konditorei mitgebracht hat.
Kaum hat sich die Lage etwas beruhigt, Carl hat sogar ein Stück vom Kuchen genommen, Hedwig albert mit Klara herum, nur Ida schweigt verstockt, da wird die Tür aufgerissen, und Heinrich stürmt noch einmal herein.
Er haut mit der Faust auf den Tisch und schreit: »Hast du das gehört, Vater? Das ist die Höhe! Die Alliierten haben den Bahnhof von Kattowitz den Polen überlassen! Der Bahnhof Kattowitz in der Hand der Aufständischen! Das heißt Transportmöglichkeiten, Nachschub … Die verdammten Schweine die.«
Seit ein paar Stunden erst ist das Luischen auf der Welt. Aber das scheint schon keinen mehr zu kümmern. Die Welt dreht sich weiter und irgendwie nicht in die richtige Richtung. Martha wird es schwarz vor Augen. Nur einen Moment, dann geht es wieder. Sie ist zu früh aufgestanden, man verliert doch eine Menge Blut, denkt sie, auch wenn alles gutgeht. Sie merkt, wie die Erschöpfung ihr den Schweiß auf Stirn und Oberlippe treibt. Sie wird sich hinlegen mit dem Luischen, das gar nicht schreit trotz des Lärms.
Sie zieht den Vorhang im Schlafzimmer zu, liegt im Dämmerlicht, denkt an Konrad, ihren Ältesten. Wenn ihm nur nichts passiert da draußen, in dieser aufgeheizten Stimmung. Es gibt genug Leute, die wissen, dass er mit einer Polin befreundet ist. Mein Gott, das genügt schon. Da braucht nur einer mit dem Finger auf ihn zu zeigen und loszuschreien, dann ist er doch schon in Gefahr …
Die kleine Luise schläft. Sie hat richtig viele dunkle Haare auf dem Kopf. Martha drückt das kleine Wesen an sich und sagt leise: »Schlaf du nur, Luischen, und sei froh, dass du dich noch nicht weiter mit der Welt da draußen beschäftigen musst. Hauptsache, die Mama ist da und hält dich warm und hält dich fest und singt dir ein Liedchen in dein kleines Ohr.«
***
Am Sonntag gibt es im ersten Stock der Paulstraße, in der Stube, die Martha zuvor gelüftet hat, um den Mief von genau einer Woche zu vertreiben, schlesische Klöße und Rindsrouladen, gefüllt mit Gurke und Speck.
»Die Klöße sind 1a, Mutter, die kriegt niemand so hin wie du«, sagt Konrad und greift gleichzeitig nach Paulinas Hand, damit sie nicht womöglich denkt, dass es ihm bei ihr weniger schmeckt. Er ist dunkelhaarig wie seine Mutter, überhaupt gleicht er der Wieczorek-Seite, und Paulina, seine Verlobte, ist eine Blonde mit blitzenden dunklen Augen.
Die Haare in der Familie Strebel sind so verteilt: Konrad, Ida: dunkel wie Martha. Heinrich, Hedwig, Klara: blond wie Carl und die Strebels. Und nun Luise. Die würde den Ausschlag geben, ob es auf halbe-halbe käme, aber das lässt sich jetzt noch nicht sagen.
Konrad nimmt seine neue Schwester vorsichtig aus der Wiege und hält sie hoch in die Luft, den kleinen Kopf in der Hand. »Willkommen in der Familie Strebel, Luischen, ob du nun blond oder dunkel wirst. Gut hat die Mutter dich hingekriegt, du gefällst mir. Wenn die Paulina und ich erst … no, da hast du Nichten und Neffen zum Spielen.«
Carl runzelt die Stirn bei diesen Worten, aber Martha, die sich mit einem dankbaren Blick zu Hedel, die den Tisch abräumt, auf der Chaiselongue niedergelassen hat, bemerkt es nicht. Man konnte Gott dankbar sein für das Mädel. Hedel war anstellig, flink und hilfsbereit und für alles Praktische begabt. Die Küche machte sie mit ihren vierzehn Jahren schon jetzt mit links, wenn es sein musste. Martha dachte seit Längerem, dass das Mädchen am besten Krankenschwester werden sollte, das war ein angesehener Beruf, passte zu einer Frau und kam Hedels Charaktereigenschaften blendend entgegen. Und es war doch so: Mit der Schwesterntracht war eine Frau immer gut angezogen, egal, ob sie viel Geld hatte oder keins, und wurde von jedem respektiert. Die schöne Ida mit eigenem Modesalon und Hedwig Stationsschwester im Städtischen Krankenhaus – ein Stolz wäre das doch für alle Eltern!
»Mutter, können wir mal das Fenster aufmachen?«, fragt Konrad in ihre Zukunftsträume hinein. Er schaut besorgt auf Paulina, die blass ist, und Martha, unversehens auf die Erde zurückgeworfen, denkt sogleich, ob da vielleicht was Kleines im Anzug ist. Ach Gott, dann müsste recht bald geheiratet werden, und grade nach ihrem Luischen wäre schon das erste Enkelkind da.
Und kaum hat sie das gedacht, fragt Konrad ruhig und lächelnd in die Runde: »Findet ihr nicht, dass es eigentlich schade ist, dass die Stube nur am Sonntag benutzt wird? Ein ganzes Zimmer, das leer steht und nur für Gäste und Feiertage da ist? Es gibt so wenig Wohnungen hier, Gleiwitz platzt ja aus allen Nähten, eine Katastrophe ist das mit der Wohnungsnot. In so einem Zimmer könnte glatt eine ganze Familie Platz finden.«
Also, das geht nun doch zu weit. Konrads Worte fallen auf kälteklirrendes Schweigen.
Nur Ida flüstert: »Ich zieh sofort aufs Sofa«, und feixt zu Hedel hinüber, die sich immer beschwert, dass Ida nachts herumrudert und dass es eine Zumutung ist, mit ihr in einem Bett zu schlafen.
»Eine ganze Familie vielleicht. Aber ganz sicher nicht deine.« Das ist Heinrich. Er ist vom Tisch aufgesprungen, als wollte er sich auf den Bruder stürzen.
»Setz dich«, sagt Carl. Aber Heinrich setzt sich nicht.
»Dass du dich überhaupt noch hertraust mit deiner Polin, während wir unser Blut lassen für ein deutsches Oberschlesien.«
»Du lässt dein Blut überhaupt nicht …«
Konrads Stimme kann so schneidend werden, das mag Martha nicht an ihm, dann kennt sie ihn fast nicht wieder.
»Die Abstimmung«, fährt Konrad fort, »ist für Deutschland ausgegangen. Ja, stimmt, in den absoluten Zahlen und in den Städten. In den Städten, da wohnen die Deutschen, die mit der guten Ausbildung und den guten Posten. Die Leute auf dem Land haben nichts. Die waren Leibeigene. Das Land, auf dem sie ackern, gehört den Grafen Ballestrem, Tiele-Winckler, Schaffgotsch oder dem Fürsten von Pless. Auf dem Land reden die Leute Polnisch, und auf dem Land haben die Leute für Polen gestimmt. Wenn du nach Gemeinden zählst, dann haben mehr Gemeinden für Polen gestimmt als für Deutschland.«
»Du Verräter! Du dreckiger Landesverräter!«
Heinrich wird zuschlagen, Martha sieht es in seinem Gesicht, an den Fäusten, an denen die Knöchel weiß hervortreten. »Weißt du, was man mit denen macht?«
»Carl!«, ruft Martha entsetzt, springt von der Chaiselongue auf, stellt sich schützend hinter Konrads Stuhl. »Carl, sag doch was! Greif endlich ein!«
Da setzt sich Heinrich wieder hin, ehe der Vater eingreift, sagt aber noch, drohend diesmal und leise: »Man sollte dich rauswerfen aus diesem Haus.«
»Komm, wir gehen«, sagt Konrad tonlos in das Schweigen hinein und zieht Paulina vom Stuhl hoch.
Wie erstarrt sitzen sie alle da. Nur Klara winkt den beiden zum Abschied fröhlich zu. Sie liebt Konrad und Paulina. Sie ist fünf.
***
Ich hab ihn nicht rausgeworfen, denkt Carl, Konrad ist gegangen, weil er nicht mehr mit Heinrich das Zimmer teilen will. Heinrich schießt über das Ziel hinaus, und Konrad ist stur. Zwei Streithähne. Schon immer. Er, Carl, liebt seine Kinder, auch Konrad, das versucht er sich immer wieder zu sagen, auch wenn ihm Konrad, ausgerechnet sein Erstgeborener, vom Wesen her fremder ist als Heinrich. Konrad hat wohl mehr von den Wieczoreks, die haben schon im Namen die Nähe zum Polnischen. Auch im Äußeren gleicht er der Mutter, so sehr gleicht er ihr, als wäre er ohne Carls Zutun, ganz ohne einen Strebel zustande gekommen. Carl spürt eine unbehagliche Enge im Herzraum, wenn er an den Sonntagabend denkt. Da ist Konrad zurückgekommen und hat seine Sachen gepackt.
»Ich habe nichts gegen Paulina«, hat Carl gesagt. »Und ich habe Heinrich zurechtgewiesen. So spricht man nicht zum eigenen Bruder. Das dulde ich nicht. Aber ich kann es auch nicht dulden, dass mein anderer Sohn in dieser Zeit, in der ich mich als Deutscher und als Beamter unverbrüchlich auf die Seite des Staates stelle, eine unklare Position bezieht. Ich weiß, dass es Deutsche hier in Oberschlesien gibt, die nicht nur Polnisch sprechen, sondern auch Polnisch denken. Ich will aber keinen Zweifel aufkommen lassen, nicht den geringsten, dass jemand aus meiner Familie darunter sein könnte. Ich verbiete dir die Heirat mit Paulina. Paulinas Eltern werden die Ehe ihrer Tochter mit einem Protestanten sowieso nicht zulassen.«
Für Carl war die Sache damit erledigt. »Also, pack deine Sachen wieder aus. Du hast weder Geld noch eine Wohnung.«
Sie standen sich gegenüber, gleich groß, Konrad weniger massig als der Vater, aber kräftig, dunkel, Augen wie die Wieczoreks aus Oppeln. Und er gab Widerwort.
»Du weißt genau«, sagte Konrad, die Stimme hoch und scharf, »dass ich beim Plebiszit für Deutschland gestimmt habe. Schlesien ist unsere Heimat. Seit Generationen. Ich bin ein Deutscher. Aber warum will niemand in diesem Land von den sozialen Konflikten sprechen? Nationale, patriotische Gefühle sind das eine, aber Korfanty hat es geschafft, die polnisch-nationale mit der sozialen Frage zu verbinden. Eine Ewigkeit waren die Menschen hier einen Dreck wert, Leibeigene der adligen Großgrundbesitzer, sie waren Gegenstände wie die Hütten, in denen sie hausten, Besitz der Gutsherren wie die Äcker, die sie umgruben. Kauften die Herren ein Grundstück, ein Dorf, kauften sie die Menschen, die da lebten, mit. Als man die Bodenschätze entdeckte, schufteten die Bauern auf dem Acker und noch dazu in den Gruben, denn auch die gehörten den Adligen, weil ihnen der Boden gehörte, in dem die Kohle und die Erze lagen. Und als die Leute nach der Landreform endlich Land erwerben durften, hatten sie das Geld nicht. Unsere Schwerindustrie wächst und gedeiht. Möglich machen’s die Bergleute aus Polen. Aber die sollen gefälligst Arbeiter bleiben. Schulen, Bildung, Aufstiegsmöglichkeiten für polnische Bauern und Grubenarbeiter? Nein, bei Gott, das ist nicht vorgesehen. Schau dir an, wie die meisten Bergarbeitersiedlungen aussehen. Unter welchen Bedingungen die Kumpel arbeiten. Die Streiks der polnischen Grubenarbeiter? Schnell vergessen! Nicht von Interesse! Gib den polnischen Kindern Schuhe, ihren Eltern eine menschenwürdige Wohnung, und sie votieren das nächste Mal für Deutschland …«
Da war Carl außer sich geraten und hätte seinen Sohn am liebsten geohrfeigt. »Was redest du da! Bist du nicht bei Trost? Hast du dich jetzt auf die Seite der Sozialisten geschlagen? Dann lass es dir gesagt sein: Sozialisten und Kommunisten haben in meinem Haus nichts zu suchen. Nichts! Vor dem Namen Korfanty spucke ich aus, bevor ich ihn ausspreche. Und die Bolschewisten sind die Feinde unseres Staatswesens. Du scheinst dich mit beiden anfreunden zu wollen. Ich sag es noch einmal: nicht in diesem Haus!«
Und der stolze Konrad, einundzwanzig Jahre alt, gerade hatte er die Ausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen, schwieg zu den Worten des Vaters, verließ das Haus, das Zimmer, das er mit einem Bruder teilte, mit dem er sich noch nie verstanden hatte, verließ die Mutter, die weinend versuchte, ihn zurückzuhalten. Kam mit seinem einen Koffer bei einem Freund unter, fand auf der Gleiwitzer Grube in der kaufmännischen Verwaltung eine schlecht bezahlte Stelle und schließlich ein Bett in einer elenden Kellerwohnung, feucht, mit Schimmelpilz an den Wänden, denn in Gleiwitz war der Wohnraum knapp, und suchte die Versöhnung mit dem Vater nicht.
***
Carl Strebel, geboren 1869 in Breslau, protestantisch, Beamter bei der Deutschen Reichsbahn, zweiundfünfzig Jahre alt, ist zuverlässig deutsch gesinnt. Die Versetzung von Breslau nach Oberschlesien war mit einer Beförderung verbunden. Wer hätte auch schon von Breslau weg ins Kohlerevier gewollt, wo die Kumpels mit dem Butterbrot in der Rocktasche und der Kaffeekanne in der Hand zur Schicht gehen und auf dem Heimweg in der nächsten Destille einen Korn kippen oder auch zwei und den Kohlenstaub auf die Straße spucken, der sich aus den verklebten Lungen löst. Wo die Menschen in der Freizeit Kaninchen und Tauben züchten und ihre Gartenlaube mit Dachpappe verschönern. Martha hatte viel weniger Probleme als er mit dem Wechsel, vielleicht weil sie Oberschlesierin war. Die meisten Breslauer Ehefrauen hätten jedenfalls gejammert, als würden sie in die Wüste geschickt.
Seit drei Jahren war Carl jetzt in Gleiwitz, in der Paulstraße 13, aber es hatte gedauert, bis er hier wirklich angekommen war. Breslau, das war eine andere Welt, eine reiche, elegante Universitätsstadt am Strom, anders als dieser wie von riesigen Maulwürfen um- und umgewühlte Boden mit den ewig rauchenden Schornsteinen darauf, den düsteren Kokshalden, auf denen es nachts unheimlich irrlichterte, den Zechen mit ihrem monotonen Gesang der Fördertürme, den Schmelzöfen. Überall Kohle, Stahl, Eisen. Vorherrschende Farbe: schwarz. Das Flüsschen, die Klodnitz, mickrig und stinkend. Dagegen die Oder in Breslau, das war ein Fluss! Wenn man da zur Dominsel hinüberging! Und hier: der Gestank, der Dreck in der Luft! Der blieb an den Häusern hängen, hellgrau bis anthrazit, und an den Kleidern auch. Wenn man sich abends den Hals wusch, lohnte sich das immer. Da sah man, wo der Hemdkragen aufhörte.
Aber mit der Zeit fand Carl Gründe, stolz auf den neuen Wohnort zu sein.
Gleiwitz wuchs rasant in diesen Jahren, zusammen mit der Industrie, die Region war wichtig für das Reich, goldener Boden für die Wirtschaft, und die Stadt hatte durchaus etwas zu bieten mit ihren prächtigen Gründerzeithäusern in der Wilhelmstraße, die schnurgrade vom Marktplatz zum Bahnhof führte. Wer an der Wilhelmstraße ein Geschäft besaß, stieß sich bald gesund, kaufte ein Auto und wohnte irgendwann in der Kreidelstraße oder am Stadtpark. Da sprossen die Villen aus dem Boden.
Aber für Preußen und für das Deutsche Reich war der südliche Teil Schlesiens politisch ein unsicherer Kandidat, wegen der großen polnischen Minderheit. Das hatte der Alte Fritz schon so gesehen, als er Schlesien den Habsburgern abnahm. Aber er hatte auch das Potenzial erkannt, das im Bergbau lag. Die Deutschen und die Polen, die lebten seit Ewigkeiten nebeneinander und – auch das konnte niemand abstreiten – miteinander auf diesem Boden. Auch Tschechen mischten sich drunter, denn böhmisch war das Gebiet ja auch mal gewesen. Die Frage, die Berlin beschäftigte, war, ob die Deutschstämmigen hier überhaupt noch loyale Preußen und Reichsdeutsche waren. In Oberschlesien war davon auszugehen, dass die polnischen Minderheiten, von Deutschen regiert, mit dem Anschluss an ein wiederauferstehendes Polen liebäugelten. Und Korfanty, dieser Aufwiegler und Anführer der polnischen Insurgenten, bewies, dass es so war. Ein Pulverfass war das plötzlich, was vorher nur ein Landzipfel weit im Osten, am fernen Rand des Reiches gewesen war.
Insgesamt aber lebte Carl inzwischen nicht ungern in Gleiwitz, er hatte sich an die neue Umgebung gewöhnt. Er war auch kein Polenhasser, bisher hatten ihm die Polen nichts getan. Aber Unordnung und vor allem Aufruhr gegen die Staatsgewalt konnte er nicht billigen. Da war Schluss, da hörte das Verständnis auf.
»Martha«, sagte er, »da ist einfach Schluss. Selbst wenn du recht hast, dass beide Seiten hetzen. Die Staatsgewalt ist die Staatsgewalt.«
***
Frau Liedka würde jetzt eine Messe lesen lassen, damit die Dinge wieder ins Lot kamen, aber Martha liegt es fern, sich beim evangelischen Pfarrer Trost zu holen. Konrad kommt nicht nach Hause zurück, das weiß sie.
Sie steht am Fenster und sieht hinaus auf die nächtliche Straße. Ein Mann, was reitet den nun wieder, versetzt den leeren Milchkannen vor dem Haus einen Tritt, sie scheppern übers Pflaster und rollen in die Gosse. Der Milchmann wird sie morgen früh nicht einsammeln, außer er hat seinen Laufburschen, den Hottek, dabei. Alle schlafen, aber Martha erträgt Carls Schlaf nicht und nicht Heinrichs Schlaf, der ruhige, selbstgerechte Schlaf der beiden macht sie schlaflos. Sie steht und schaut hinaus und weint, weil ihr Ältester sein Zuhause verloren hat und sie es ihm nicht wiedergeben kann.
»Hör auf, mir aus dem Weg zu gehen und mich anzuschweigen«, sagt Carl zu Martha. »Ich hab Konrad nicht aus dem Haus gejagt. Er hat seine Sachen gepackt, er ist gegangen. Ich bin kein strenger Vater. Ich habe die Kinder nie aus Prinzip geschlagen oder um ihren Widerstand zu brechen. Und ich schlag auch nicht alles entzwei, weil ich getrunken habe, wie der Liedka unten.«
Aber Martha sieht immer noch an ihm vorbei. »Mein Sohn ist gegangen. Wortlos ist er gegangen, und du hast ihn nicht zurückgehalten. Aus seinem Zuhause hast du ihn vertrieben. Als hätte er nicht das Recht, hier zu sein wie du und ich und die andern. Dabei ist Heinrich der viel größere Hitzkopf, unbedacht und fanatisch.«
»In Gottes Namen, Martha, lass ein paar Wochen vergehen. Dann kannst du Konrad von mir aus zum Essen am Sonntagmittag einladen.«
»Mit Paulina!«
»Wenn es sein muss. Aber sei dir im Klaren darüber, dass es jedes Mal wieder Streit geben wird, solange Heinrich zu Hause wohnt. Und falls unser Sohn Paulina heiraten sollte, was ich nicht hoffe, sind wir getrennte Leute. Das ist dir hoffentlich auch klar. Das lasse ich nicht zu, und das lässt die Lage nicht zu. Du hast hoffentlich nie mit dem Gedanken gespielt, sie könnten hier bei uns wohnen. Es gibt Grenzen. Und ich will kein Widerwort hören, Martha. Herrgott noch mal, wo sind wir denn!«
***
Wenn Frau Liedka mal vor sich hin träumen und den Alltag hinter sich lassen musste, was häufiger vorkam, weil ihr Leben nicht ganz einfach war, betrachtete sie das schöne farbige Andachtsbild von der heiligen Agnes, ihrer Namenspatronin. Das vertraute sie Martha eines Nachmittags an, als sie zusammen die monatliche Wäsche machten. Martha benutzte zum Träumen andere Hilfsmittel, aber dass man manchmal eine andere Welt braucht, darin waren sie sich einig.
»Immer nur dunkle Kleider, dreckige Luft und die strengen Winter, das hält ja niemand nich aus«, meinte Frau Liedka, »abgesehen von dem übrigen Elend, na, Sie wissen schon.«
Martha ihrerseits versteckte eine Keksdose unter ihrer Wäsche, Leibniz-Kekse von Bahlsen waren mal drin gewesen. Die Dose enthielt die wichtigen Erinnerungsstücke aus ihrem Leben. Zum Beispiel die Zeichnung aus dem Modejournal, das die gnädige Frau ihr damals in Breslau geschenkt hatte, als sie es nicht mehr brauchte. Die Seite hatte sie ausgeschnitten und verwahrt.
Wenn sie das Bild aus der Dose nimmt und anschaut, öffnen sich die weiß lackierten Flügeltüren, und man erblickt einen Ballsaal, schöner als im Schloss von Sanssouci. Ein großes Funkeln ist das, in den wandhohen, gold gerahmten Spiegeln verdoppelt sich das Licht der vielen Kronleuchter, jeder einzelne glitzernd von Kristall. Mit rotem Plüsch bezogene Sesselchen und Stühle warten auf die Gäste, die soeben eintreffen und den Saal betreten. Da kommt Martha! Das schwere dunkle Haar kunstvoll aufgesteckt, mit eingeflochtenen Blumen darin. In einem hinreißenden roten Kleid – eben dem aus dem Journal von Frau Dr. Hillermann –, schlichte, vollendete Eleganz, man kann den Blick nicht abwenden. Ein junger Mann hat sie erspäht, kaum, dass sie den Saal betreten hat, er kommt auf sie zu mit einer Gewissheit, wie nur die Liebe auf den ersten Blick sie verleiht, und bittet sie zum Tanz. Er sieht ein bisschen aus wie ihr Konrad, nur eleganter, und sein Frack sitzt wie angegossen über dem blütenweißen Hemd. Manchmal fällt ihm eine Locke in die Stirn, die streicht er lächelnd zurück, ohne den Blick von ihr zu wenden. Sie tanzen den ganzen Abend, bis sich alles in Marthas Kopf dreht und die Eltern zum Aufbruch drängen. Ihr Vater ist ein Advokat wie Dr. Hillermann oder vielleicht sogar noch was Besseres. Und am nächsten Tag bringt ein Laufjunge einen Rosenstrauß ins Haus, und ein anderer bringt eine riesige Bonbonniere am Tag darauf. Und am dritten Tag kommt ein Brief, in dem der junge Mann darum bittet, sich ihren Eltern näher vorstellen und sie ausführen zu dürfen, was ihre Eltern auch erlauben, denn einen so höflichen und galanten jungen Mann hat die Welt noch nicht gesehen.
Als sie den Carl Strebel damals nach Hause mitgebracht und ihren Eltern vorgestellt hat, haben die Eltern auch genickt, aber ohne das Entzücken, das die Menschen befällt, wenn sie begreifen, dass in diesem Moment sich etwas Wunderbares ereignet, etwas Einmaliges, das es so nicht wieder geben wird. Aber die Eltern gingen ja auch nicht auf Bälle, und schon gar nicht mit Martha. Zufrieden waren sie aber gewesen, sehr sogar. Mit dem Strebel war die Martha versorgt, besser, als man es erwarten konnte.
Den Carl hat sie in einer Drogerie in Breslau kennengelernt, wo sie für Frau Dr. Hillermann Kalodermaseife kaufen musste. Beim Einpacken fiel ihr das Portemonnaie hinunter, und Carl hat es aufgehoben, er war als Nächster dran. Das war freundlich und auch höflich, fast galant, könnte man sagen. Aber Liebe auf den ersten Blick war es nicht, weil er ihr ziemlich alt vorkam, er hatte ja damals schon tiefe Geheimratsecken. Außerdem war er blond, und seine Augen waren ein bisschen blass. Sie mochte die Dunkelhaarigen lieber, etwas zigeunerisch Leidenschaftliches hätte sie sich gewünscht. Eine Spur Verwegenheit vielleicht. Nun gut, verwegen war der Carl nicht, aber er hatte andere gute Seiten.
Und das Träumen kann einem ja keiner verbieten, sagte Frau Liedka immer. Nicht, dass man oft Zeit dafür fände. Aber hier und da gibt es solche Momente. Dann ist das Leben richtig schön.
***
Am 19. Juni 1921 wurde das Luischen in der Evangelischen Kirche an der Bahnhofstraße ohne großes Brimborium getauft. Leider war der Juni dieses Jahr ungewöhnlich kühl, und Martha hätte die Taufe gern noch ein paar Wochen hinausgeschoben, bis der Jasmin blühte und seinen betörenden, sommerlichen Duft verbreitete. Aber Carl hatte darauf gedrängt, nicht lange zuzuwarten, weil niemand wissen konnte, wie die politische und militärische Lage sich noch entwickeln würde. Am 9. Juni hatte er in der ›Oberschlesischen Volksstimme‹ gelesen, dass wegen der Kämpfe zwischen deutschen und polnischen Truppenverbänden die Oderschifffahrt in Oberschlesien eingestellt werden müsse. Wenige Tage später verfügte die Interalliierte Kommission ein Auseinanderrücken der Truppen, aber trotz dieser Atempause war die Stimmung während der Taufe nicht die beste.
Martha hatte schweren Herzens Konrad, der nicht ohne Paulina kommen wollte, gebeten, der Taufe fernzubleiben, um keinen Unfrieden aufkommen zu lassen. Aber am Vortag der Taufe hatte der alliierte Stadtkommandant von Gleiwitz die ›Oberschlesische Volksstimme‹ verboten, weil sie den Oberschlesischen Selbstschutz aufgefordert hatte, trotz Waffenruhe das von den polnischen Aufständischen besetzte Gebiet zurückzuerobern. Die Zeitung war zwar nicht Carls Leibblatt, aber viele der geladenen Gäste ereiferten sich darüber.
»Pah, und genau das werden wir, wir werden das besetzte Gebiet zurückerobern. Waffenruhe? Na und! Was kümmert uns das«, prahlte Heinrich, der den ganzen Tag davon sprach, dass er sich jetzt den Freikorps anschließen wollte. »Wir werden doch nicht tatenlos zusehen, wie die Polen die deutschen Kaufleute schon jetzt dazu zwingen wollen, ihre Firmenschilder auf Polnisch umzuschreiben. Als hätten Korfanty und Co. den Kampf gewonnen! Und das nach der Niederlage vom Annaberg!«
»So, jetzt wollen wir aber gleich in Ruhe Kaffee trinken«, sagte Martha, »schließlich ist dank dem Luischen ein schönes Familienfest zu feiern. Schön, dass ihr alle da seid.«
Neben Carls Mutter – die Omama Strebel war zu alt, um noch zu reisen – waren Marthas Eltern gekommen.
»Ida«, fuhr Martha fort und versuchte, den Überblick zu behalten, »steh nicht so gelangweilt da, geh zu Liedkas runter und leih noch ein paar Stühle aus, das hab ich heute früh vergessen. Und Liedkas können überhaupt gleich mit raufkommen, ich hab gesagt, um drei bei uns. Und du, Hedel, hilfst mir in der Küche.«
Hedel, sonst fleißig wie eine Biene, hatte eine unzufriedene Phase, sie pubertierte wieder mal gewaltig.
»Immer ich«, maulte sie. »Warum nicht Ida? Die drückt sich, wo sie kann!« Dann verkündete sie der Runde, dass sie ihre blonden Zöpfe abschneiden wolle, aber niemand hörte zu.
Nur Martha strich ihr übers Haar und sagte: »Hedel, die Zöpfe stehen dir so gut. Die kannst du dann mal abschneiden, wenn du heiratest. Dann kannst du eine Dauerwelle machen, wenn du willst. Aber jetzt schneid mal den Blechkuchen auf.«
Alle Nachbarn aus dem Haus waren eingeladen, und in der Menge der Besucher, die alle laut durcheinanderredeten, ging Heinrichs Stimme unter. »Könnt ihr mal Platz machen«, mussten die Helferinnen rufen, wenn sie Nachschub aus der Küche in die überfüllte Stube brachten, und so steigerte sich die Heiterkeit mit jedem Kuchenblech, das hereingetragen wurde.
Emma Luise verschlief den ganzen Zinnober. Nur am Morgen, als der Pfarrer ihr in der Kirche das Weihwasser auf die Stirn tropfte und ihr ein Tropfen ins Auge geriet, hatte sie kräftig geschrien.
Alle auswärtigen Familienmitglieder wollten am Abend wieder zurückfahren, was Frau Liedka im Stillen bemängelte. Da hatten sie schon so wenig Familie, die Strebels, und dann blieben die Gäste nicht mal über Nacht. Wenn es lustig wurde und die Frauen Likör, die Männer Schnaps tranken und erst so richtig gesungen und gelacht wurde, waren die ja schon wieder weg. Das war bei Liedkas denn doch anders.
»Aber ihr bleibt sicher noch ein bissel«, sagte Martha, die in Frau Liedkas Miene las, als Carl die Eltern zum Bahnhof begleitete.
»No, ein bissel schon noch«, antwortete Frau Liedka, und die anderen Hausbewohner nickten.
»Aber die Politik lassen wir aus«, stellte Martha klar, »vor allem, weil der Herr Dombrowa vom zweiten Stock noch eine Flasche Schnaps mitgebracht hat.«
1922
Das ist hier so Sitte, Frau Strebel«, sagte Frau Liedka zu Martha, »da kommen Sie nicht drum rum. Das muss gefeiert werden. Sicher macht das auch der evangelische Pfarrer für Sie, der lebt ja schließlich hier, und hier is das nun mal so. Wenn das Luischen ein Jahr alt wird, müssen Sie eine Messe lesen lassen. Die Patin trägt das Luischen um den Altar herum, geschmückt mit einem Myrtensträußchen, und dann gibt es eine schöne Einladung.«
Zu Beginn, als Strebels in die Paulstraße zogen, hätte Agnes Liedka sich natürlich nicht zu solchen Dingen geäußert, aber jetzt, nach gut drei Jahren, waren Martha Strebel und Agnes Liedka doch so weit, dass sie über Verschiedenes miteinander sprachen, wenn auch gegebenenfalls nur in Andeutungen, falls Schamhaftes berührt wurde. Der erste Geburtstag und die Altarumrundung gehörten nicht dazu, das konnte man ganz offen ansprechen. Neulich hatten sie aber über einen heiklen Punkt im Leben einer Frau gesprochen, den man nicht einfach mit irgendwem erörterte, Martha wusste jedenfalls nicht, mit wem sonst außer mit Frau Liedka.
»Ich weiß, Sie hätten gern mehr Kinder«, hatte Martha begonnen. »Aber ich hab ja nun sechs, und drei weitere durften nicht leben.« Sie machte eine Pause und überlegte, wie sie aufs Thema kommen könnte. Aber Frau Liedka hatte schon verstanden.
»Nu nehmen Sie noch eine Tasse Kaffee und ein Stück vom Mohnstrudel. Den hab ich frisch gebacken. Also, wenn Ihr Mann sich nähert, dann ziehen Sie das Nachthemd ganz straff und kreuzen die Arme über der Brust, das sieht etwas verschlossen aus, aber nicht streng abweisend, ohne dass Sie was sagen müssen. Und wenn das nich hilft, können Sie immer noch sagen, dass doch die Mädel, also wenigstens die Ida, aber auch schon die Hedel, in dem Alter sind, wo sie eine Menge mitkriegen und vielleicht nur so tun, als würden sie schlafen. Das wär doch unangenehm. Aber man ist nun mal zu mehreren in einem Raum, das ist ja auch wieder normal, solange man nicht eine Villa am Stadtpark bewohnt. Und mit der Zeit wird sich Ihr Mann daran gewöhnen, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste.«
In Martha waren einige Zweifel zurückgeblieben, ob die Liedka-Methode erfolgversprechend war. Josef Liedka, Fuhrunternehmer, war ein Stier von einem Mann und eher aufbrausend als sanft. Ob Agnes Liedka mit gekreuzten Armen dagegen ankam, schien ihr fraglich. Aber nun ja, sie hatte nur zwei Mädel, die Frau Liedka.
Aber was die Altarumrundung anbelangte, da ließ sie sich überzeugen. Ein Fest war gut für alle in diesen schwierigen Zeiten. Das Geld war zwar knapp, Carl war nur mittlere Laufbahn, und da stand man finanziell nicht rosig da. Aber lumpen lassen wollte Martha sich auf keinen Fall, aus Prinzip nicht. Da würde sie eben auf die Handtasche verzichten, die sie im Warenhaus Barasch gesehen und mit der sie schon länger geliebäugelt hatte.
»Ist gut, Frau Liedka«, sagte sie. »Das Luischen ist so ein fröhliches Kind, das macht einem keine Sorgen, es trinkt, es isst, es schläft. Da soll es auch ein schönes Fest kriegen zu seinem ersten Geburtstag.«
Frau Liedka freute sich, dass sie Martha für den Opfergang gewonnen hatte, und weil sie sich freute, wagte sie einen weiteren Vorstoß, denn ganz durfte man den Kampf um die ketzerischen und darum verlorenen Seelen bei aller Duldung nicht aufgeben. Das sagte auch Pfarrer Aniol, mit dem sie sich in dieser Frage manchmal austauschte.
»Es ist ja nun Mai«, sagte sie also, »und so schönes Wetter! Wenn die Birkenwälder leuchten, da möchte man doch grad raus. Und ich hab mir gedacht, ich könnt Sie doch fragen, ob Sie nicht mal auf eine kleine Wallfahrt mitkommen wollen. Nächste Woche geh ich mit nach Deutsch-Piekar, das ist ganz nah, also die Straßenbahn geht ja sogar bis dahin. Das letzte Mal war es sehr schön. Man kommt eben nicht jedes Mal bis zum Annaberg oder nach Tschenstochau. Und Sie müssen ja nicht barfuß gehen, das machen sowieso nicht alle. Manche machen das nur, um die Schuhe zu schonen. Wir gehen hinter dem Kreuz her, das wird schön mit Blumen geschmückt, wir singen und beten und laufen neben den Straßenbahngleisen her, der Weg ist ganz einfach. Bis zur Gnadenkirche und zum Gnadenbild der Gottesmutter. Man kann auch noch weiter bis zur heiligen Quelle, da sieht man in die unendliche Weite der Ebene hinein. Wunderschön ist das.«
»Und auf den Knien wird nicht gerutscht?«, wollte Martha wissen. »Ich dachte, man rutscht auf Knien?«
»No ja, ein bisschen. Das Stück zum Gnadenbild hinauf. Die Stufen rauf, das schon. Das hat schließlich auch der Sachsenkönig August der Starke geschafft.«
»Ah ja?«, sagte Martha.
»Sicher doch. Er ist ja dort zum allein seligmachenden Glauben übergetreten.«
»Ach.«
»Sonst hätt er nicht König von Polen werden können.«
»Und dann ist er König von Polen geworden?«
»Ja doch. In Deutsch-Piekar ist er über die Grenze. In Warschau ist er zum König gewählt und in Krakau gekrönt worden. Da war er dann König August II. von Polen.«
Martha war beeindruckt. Dass die Agnes Liedka das alles wusste!
»Das hab ich in der Schule gelernt. Der August ist auch in Polen gestorben und in der Kathedrale des Krakauer Schlosses beigesetzt. Nur das Herz kam in einer silbernen Kapsel nach Dresden. Und innen war die Kapsel vergoldet.«
»So was! Ich hab nur gewusst, dass er viele Mätressen und einen Haufen uneheliche Kinder hatte.«
»Ja, das auch«, sagte Agnes Liedka. »Das ist ja nun wieder weniger fromm. Jetzt muss ich aber runter und kochen. Sie können ja noch mal überlegen und mir dann sagen, ob Sie mitkommen wollen nächste Woche. Die Mutter Gottes würde es sicher freuen, Frau Strebel.«
***
Das Taufkleidchen passte Luise nicht mehr, aber Martha würde ein Kleid von Klara umarbeiten, oder vielleicht bekam ja Ida einen guten Stoffrest umsonst.
Die schöne Ida hatte ihre Schneiderlehre bei Frau Munske beendet, aber das Verhältnis zwischen den beiden war nicht makellos, jedenfalls hatte Frau Munske Ida nicht angeboten, fest in ihr Schneideratelier einzutreten. Vielleicht war sie eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die Ida bei den Kunden auf sich zog. Aber eher war es wohl so, dass man Frau Munske ein angemessenes finanzielles Angebot hätte unterbreiten müssen. Martha hatte Carl deshalb bedrängt, doch Carl weigerte sich, die Omama oder seine Mutter um Geld anzugehen.
Trotzdem hatte Ida jetzt das große Los gezogen und schritt seit Neuestem umher wie ein Pfau. In der Wilhelmstraße war das neue Seidenhaus Weichmann eröffnet worden, ein skandalös moderner Bau ohne jeden Schnörkel. Den meisten Leuten gefiel das Haus weniger, aber in der Presse war ausführlich darüber berichtet worden, weil der Entwurf von Erich Mendelsohn, einem bekannten Berliner Architekten, stammte. Der Textilhändler Erwin Weichmann hatte zur Eröffnung eine Verkäuferin mit »ausgezeichneten Textilkenntnissen« gesucht. Ida war die Auserwählte, dabei hatten sich unglaublich viele Frauen beworben. Aber sie hatte ja nun wirklich Kenntnisse vorzuweisen!
Seit sie bei Weichmann arbeitete, war Ida die Eleganz in Person, immer nach dem neuesten Schrei gekleidet.
»Das erwartet Herr Weichmann von mir«, sagte sie herablassend, wenn Heinrich sich darüber aufregte, dass sie sich die Lippen anmalte, Kurzhaarfrisur und Stöckelschuhe trug. Also in die Paulstraße, fand er, passte das nicht.
»Na gut, in die Paulstraße vielleicht nicht. Aber meinst du, die eleganten Kundinnen im Seidenhaus wollen von einem Landei beraten werden? Und wer sagt denn, dass ich in der Paulstraße bleibe?«
Im Moment wohnte Ida aber noch zu Hause, wenn sie sich dort auch ziemlich rarmachte.
»Zurzeit wohne ich bei meinen Eltern«, ließ sie ihre Bewunderer wissen, als ob das nur gerade im Moment der Fall wäre.
An diesem Abend wartete Martha ungeduldig darauf, dass Ida nach Hause kam. Der Opfergang rückte näher, und sie wollte schauen, ob Ida für den festlichen Anlass nicht auch noch einen hübschen Kragen für Hedels Sonntagskleid hatte organisieren können; sie hatte Ida schon ein paar Mal gedrängt, sich darum zu kümmern.
»Wie spät du wieder nach Hause kommst, Ida!«, sagte sie ärgerlich, als sich der Schlüssel im Schloss drehte und Ida beschwingt in die Küche trat. »Du kannst froh sein, dass der Vater schon schläft. Nur weil die Frauen in Berlin sich die Nächte in Revues, in Tanzsälen und im Kino um die Ohren schlagen, heißt das nicht, dass ein Mädel in Gleiwitz, das noch nicht mal volljährig ist, dasselbe darf. Du jedenfalls darfst nicht.« Marthas Ärger war mit jeder halben Stunde gewachsen, die sie mit fruchtlosem Warten in der Küche verbracht hatte.
»Ja, ja, schon gut«, sagte Ida bestens gelaunt, »jetzt kannst du ja ins Bett. Der Antek Smuda hat mich nach der Arbeit ins Café Schnapka eingeladen. Da hättest du auch nicht Nein gesagt.«
»Und getrunken hast du was! Likör oder Schlimmeres.«
»Herrje, ich hab Wein getrunken, na und? Komm her, Mamuscha, du wirst dich gleich freuen. Sieh mal, was ich mitgebracht habe.«
Und Ida packte aus. »Ein schönes Stück weißer Batist für Luise. Ein weißer Kragen für Hedel, mit nur einem ganz kleinen Flecken auf der Seite, der wahrscheinlich mit Seife rausgeht. Einen dunkelgrünen Samtgürtel für dich und eine geschwungene, neumodische Feder für deinen langweiligen Hut. Deinem Hut fehlt ein Accessoire, Maman!« Ida gab sich gern französisch, seit sie im Seidenhaus Weichmann arbeitete. »Und alles geschenkt, stell dir vor!«
»Vom Herrn Weichmann?«
»Vom Herrn Weichmann. Für Luises Geburtstagsfest.«
Martha wiegte anerkennend den Kopf. Und bei sich dachte sie, vielleicht war er ja hinter der schönen Ida her, der Weichmann, möglich war es durchaus. Auf jeden Fall waren seine Geschenke ein Lichtblick, denn die Inflation fraß Carls Gehalt schneller auf, als man hinsehen konnte. Sie wusste gar nicht mehr, wie sie damit wirtschaften sollte, selbst wenn sie so viele Vorräte wie nur möglich anschaffte, sobald er das Geld heimbrachte. Ehe es schon wieder nichts mehr wert war.
Martha ging nicht mit Agnes Liedka auf die Wallfahrt nach Deutsch-Piekar, aber sie ertappte sich nach dem Gespräch manchmal bei dem Gedanken, dass ein solcher Ausflug etwas Abwechslung in ihr Leben gebracht hätte und natürlich eine Pause. Man wäre vielleicht in der Menge der Wallfahrer unauffällig bei sich, dachte sie, mit den anderen murmelnd und singend nicht allein und doch auf erholsame Weise in Ruhe gelassen. Wenn die Wallfahrer zurückkehrten und unter dem Gebraus der Orgel das Kirchenschiff der Allerheiligenkirche oder das von Peter und Paul betraten, in dem die Menschen sich zur Messe versammelt hatten, konnten sie sich erhoben fühlen. Und sie waren ja wirklich dem Alltag und in höhere Sphären entflohen und wurden dafür noch feierlich begrüßt, wenn sie wiederkamen.
Solche Gedanken kamen ihr zum Beispiel in den Sinn, wenn Ida und Hedel sich wieder mal in die Haare kriegten. Die beiden schliefen immer noch in einem Bett in Marthas und Carls Schlafzimmer, denn selbst wenn Konrad nicht mehr zu Hause wohnte, es konnte ja keines der Mädchen mit Heinrich in einem Zimmer schlafen. Mein Gott, die beiden Mädel sind schon sehr unterschiedlich, dachte Martha. Das war schon immer so, aber seit Konrad erwähnt hatte, dass in der Stube doch Platz sei, zankten sie sich noch häufiger. Alle paar Wochen drohte Ida wutentbrannt, sie würde auf die Chaiselongue in der Stube ziehen, weil Hedel behauptete, sie schlafe unruhig und schlage in der Nacht um sich wie ein Kerl.
»Die Hedel sollte wirklich besser mit Klara in einem Bett schlafen, die Klara ist doch inzwischen viel zu groß für das Kinderbett in der Küche. Außerdem ist das Klarachen lammfromm, ob sie nun schläft oder wacht, die schlägt keinem in die Rippen«, empfahl sie giftig.
»Die Stube geb ich nicht frei«, erklärte Martha mit bitterer und fast kämpferischer Entschlossenheit. »Wenn, könnt eine ganze Familie da einziehen, Konrad, Paulina und ein Enkelkind zum Beispiel. Aber nur weil ihr euch zankt – kommt nicht infrage. Und hört jetzt auf zu maulen.«
Irgendwann würde sich das Problem schon von selber lösen. Entweder ging die schöne Ida nach Breslau, um Karriere zu machen, wenn sie nicht heiratete, oder Hedwig, die tatsächlich Krankenschwester werden wollte, zog in ein Schwesternheim. Die Situation mit Konrad quälte Martha viel mehr. Konrad hatte bisher verhindert, dass seine Mutter ihn besuchte, aber gerade deshalb malte sie sich die schrecklichste Unterkunft aus. Und sie hatte mit ihren Befürchtungen sogar recht. Er wohnte, und er war damit nicht der einzige Gleiwitzer, in einem Loch, in das man lieber niemanden einlud.
Konrad kam zwar ab und zu wieder am Sonntag zum Essen, aber er brachte Paulina nicht mehr mit und schwieg sich über sein Privatleben aus, selbst – und das kränkte sie sehr – Martha gegenüber. Etwas war zerbrochen. Konrad litt selbst darunter, und Martha, die ihren Konrad manchmal nur schweigend an sich drückte, konnte nicht vergessen, dass Carl sich in dem Streit, der zu Konrads Auszug geführt hatte, nicht gegen Heinrich durchgesetzt hatte.
***
Carl hörte nur mit halbem Ohr zu, als Martha die Feierlichkeiten für Luischens ersten Geburtstag mit ihm durchging. Er war ganz absorbiert vom Neubau des Gleiwitzer Bahnhofs, mit dem gerade begonnen wurde.
Natürlich hatte niemand im Jahr 1846, als Gleiwitz an das preußische Eisenbahnnetz angeschlossen wurde, ahnen können, dass die ganze Region sich wirtschaftlich derart rasant entwickeln würde. Aber nun passte der schöne alte Bahnhof mit seiner Baumallee nicht mehr zur Bedeutung der Industrie- und Großstadt Gleiwitz. Der neue Bahnhof sollte etwas weiter südöstlich vom alten Bahnhofsgebäude entstehen, am Ende oder – je nachdem, wie man es nahm – am Anfang der Wilhelmstraße.
»Du musst dir das riesig vorstellen, Martha«, sagte Carl versonnen, als Martha mit ihren Plänen für das Mittagessen durch war.
»Um genau zu sein: Die Haupthalle ist auf dreihundertsiebzig Quadratmeter geplant. Und eine Höhe von elf Metern soll die haben. Martha! Stell dir das mal vor! Und alles ganz schlicht im Stil. Funktionell, streng in den Formen, groß, modern. Wie es zu unserer Zeit passt.«
»Aber der alte Bahnhof ist so hübsch!«, sagte Martha.
»Hübsch, aber kein bisschen imposant. Neu wird es eine Gepäckaufbewahrung geben und getrennte Fahrkartenschalter für die erste bis dritte Klasse, dazu die entsprechenden Wartesäle.«
»Und für die vierte Klasse?«, fragte Martha, die daran dachte, dass nicht alle Menschen umsonst Bahn fahren konnten wie die Bahnbeamten.
»Die Reisenden der vierten Klasse müssen sich mit den einfachen Räumlichkeiten im linken Bahnhofsflügel begnügen.«
»Und du? Die Büros? Wo seid ihr untergebracht?«
»Das Ganze wird L-förmig angelegt, und seitlich entstehen die Verwaltungsgebäude.«
»Da ziehst du rein?«
»Ja«, sagte Carl zufrieden. »Da haben wir endlich mehr Platz. Wurde auch Zeit.«
»Und mehr Geld kriegst du auch?«
»Wie kommst du darauf? Mit dem Neubau wird ja nicht jeder gleichzeitig eine Stufe befördert. Im Gegenteil. Das verschlingt einen Haufen Geld. Die Stadt Gleiwitz, die wird durch den neuen Bahnhof befördert.«