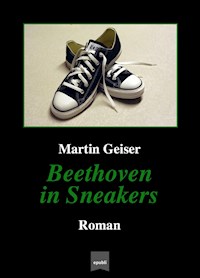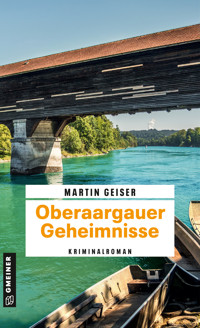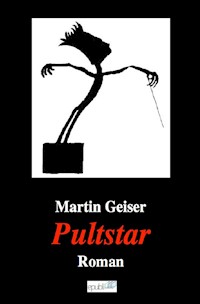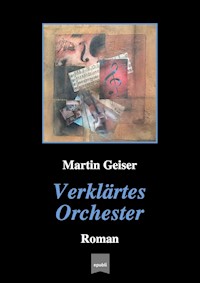
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mikrokosmos Orchester: Edgar sieht nach dem Tod seiner Frau keinen Sinn mehr im Leben. Noras Mutter beschließt, mit dem Sprechen aufzuhören. Su-min findet sich an ihrem neuen Wohnort überhaupt nicht zurecht. Antoine ist auf der Suche nach der großen Liebe. Und der Dirigent Manuel kommt zurück in seine Heimat und findet alles verändert vor. Und da ist noch diese geheimnisvolle Hannah, die mit ihrem Auftritt alle verzaubert ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Geiser
Verklärtes Orchester
Roman
Titelbild:
Gabriela Strupler: »Verklärtes Orchester«, 2017
Autorenfoto: © Bernhard Jörg
Verklärtes Orchester
Martin Geiser
Copyright: © 2017 Martin Geiser
Lektorat: SID Sprachen GmbH Solothurn,
Jacqueline Joss
Druck: epubli ein Service der neopubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-7418-8994-3
Printed in Germany
Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
www.martin-geiser.com
Es fühlte sich an, als ob sich ein Schmetterling auf ihrer Wange niedergelassen hätte und ihr mit seinen zarten, dünnen Flügeln einen feinen Hauch frische Luft zufächelte, dessen angenehme Kühle sich von diesem Punkt aus in ihrem ganzen Körper verbreitete und die Hitze, die sich in ihrem Kopf gestaut hatte, zu lindern vermochte.
Die Klänge, die sich in ihr festgesetzt hatten, waren plötzlich in den Hintergrund gerückt und tönten dumpf und leise, als ob sie von weit her durch eine dünne Wand vernehmbar wären. Dafür brummte ein regelmäßiges Summen in ihren Ohren, welches sich über die Klänge schob und das sie nicht einmal so sehr als unangenehm empfand.
Sie schaute zur stuckverzierten Decke hoch und wurde augenblicklich von einem starken Glücksgefühl überwältigt, welches ihr endlich die notwendige Sicherheit gab, die ihr bisher gefehlt hatte.
Gleichzeitig aber begannen ihre Hände zu zittern; die Aufregung machte sich bemerkbar, und sie blickte in aufgewühlter Erregung nach links und rechts, musterte die aufmerksamen Gesichter in ihrer Reihe, die natürlich nicht mitbekommen hatten, welch enorme Wandlung sich in diesem Moment in ihr abgespielt hatte.
Sie war sich nun sicher, was sie zu tun hatte. Es war wie eine Befreiung, als ob die Ketten, die sie eingeengt hatten, plötzlich gesprengt waren und ihr damit wieder Luft zum Atmen verschafft wurde.
Und gleichzeitig stellte sie tief in sich drinnen eine Leichtigkeit fest, welche sie beinahe erschreckte. Wie klar sie doch von einem Moment auf den anderen plötzlich alles sah! Wie deutlich ihr doch alles erschien, als ob ihr Schuppen von den Augen gefallen wären. Wie hatte sie nur so blind sein können!
Wie von magischer Hand geführt erhob sie sich mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit ganz langsam und spürte augenblicklich die erstaunten und ärgerlichen Blicke rund um sie herum, die ihr zugeworfen wurden und die sie jedoch in keiner Art und Weise an ihrer Absicht hindern konnten.
Lächelnd drängte sie sich, die zischenden Beleidigungen ignorierend, Schritt für Schritt an den angezogenen Knien vorbei. Einem älteren Herrn trat sie mit ihrem Absatz auf die Zehen, worauf dieser kurz aufschrie; sie warf ihm für das Missgeschick einen entschuldigenden Blick zu und formte mit ihren Lippen ein Sorry, das allerdings seine Wirkung verfehlte, wenn sie das zornige Funkeln in seinen Augen richtig deuten konnte.
Als sie den Mittelgang erreicht hatte, blieb sie einen Augenblick stehen und blickte nach vorne, von wo die traurigen und berührenden Klänge herkamen, die sich jetzt wieder mit voller Wucht in ihr Bewusstsein geschoben hatten. Sie spürte ein Kribbeln in ihren Fingerspitzen und fragte sich für einen kurzen Moment, ob es nicht doch das Beste wäre, umzudrehen und den Saal zu verlassen.
War das wirklich ein ernsthaftes Zögern?
Da vorne stand er; mit seinen eleganten und bestimmten Bewegungen zog er sie und die anderen Anwesenden in seinen Bann, und mit den Klängen, die er hervorzauberte, gelang es ihm, sie in eine andere Welt zu versetzen, in der Zeit und Raum keine Rolle mehr spielten.
Als ob er magnetische Eigenschaften hätte, wurde sie von ihm unweigerlich angezogen, und die Gedanken an einen Abgang waren augenblicklich weggewischt.
Sie hob den Kopf und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen, so als wolle sie jeglichen Lärm vermeiden. Langsam, aber zielstrebig, näherte sie sich der Bühne, während die Zuschauer erstaunt ihre Köpfe drehten und sie mit offenem Mund anstarrten.
Ihr weißes Sommerkleid aus reiner Seide verlieh ihr etwas Engelhaftes, und im Nachhinein sollte sich der eine oder andere Anwesende nicht mehr so ganz sicher sein, ob ihre Füße überhaupt den Boden berührt hätten. Es entstand beinahe der Eindruck, als ob sie schwebend nach vorne gleiten würde.
Der erste Zuschauer stand auf, als sie etwa die Mitte des Saales erreicht hatte, und es sollte fürwahr nicht der einzige bleiben. Einer nach dem anderen erhob sich von seinem Sitz und blickte staunend auf die Gestalt, die nach vorne zur Bühne schritt, und es war – durch die helle Kleidung bedingt –, wie wenn sich eine Lichtquelle im Raum vorwärts bewegen würde.
Als ob es abgesprochen wäre, erhob sich von hinten nach vorne Sitzreihe um Sitzreihe, und irgendwann wurde es den Cellisten am vordersten Pult zu unheimlich und sie hörten auf zu spielen, was sich innerhalb weniger Momente auf das gesamte Orchester übertrug. Die Musiker, die zuhinterst saßen, standen auf, damit sie sehen konnten, was im Saal unten vor sich ging, und der Dirigent ließ seine Arme fallen und drehte sich um.
Inzwischen war sie ganz vorne angekommen und blieb vor der Bühne stehen. Sie strahlte ihn an, während rund um sie herum komplette Stille herrschte.
Sie sah hoch, ein zurückhaltendes und geheimnisvolles Lächeln auf ihrem Gesicht, und öffnete ganz leicht ihren Mund.
Er sollte sich im Nachhinein nicht mehr so sicher sein, ob er die Worte tatsächlich gehört oder ob er sie bloß von ihren Lippen abgelesen hatte.
D A V O R
MANUEL
»Entschuldigen Sie, Sir.«
Ich zucke zusammen, und dabei fällt mir der Laptop, der immer noch auf meinen Knien liegt, beinahe zu Boden.
Einen kurzen Moment brauche ich, um aus meinem Schlummer wieder in die Wirklichkeit einzutauchen und blicke etwas orientierungslos nach links und rechts. Erst als ich den Druck in meinen Ohren spüre, realisiere ich, wo ich mich befinde.
Die Flugbegleiterin nickt mir freundlich zu und reicht mir ein warmes, flauschiges Tuch, das angenehm nach Zitrone duftet.
»Sie haben gewünscht, rechtzeitig vor der Landung geweckt zu werden, damit Sie sich noch etwas frisch machen können.«
»Habe ich lange geschlafen?«, frage ich, immer noch leicht verwirrt und zupfe mir die Stöpsel aus meinen Ohren.
Die Frau wirft den Kopf zurück und lässt ein tiefes, kehliges Lachen ertönen, das ich sehr attraktiv finde und das mich definitiv wieder in der Gegenwart ankommen lässt.
»Sie haben nicht viel vom Flug mitgekriegt, wenn ich das so offen sagen darf«, meint sie. »Sie müssen todmüde gewesen sein und haben geschlafen wie ein Murmeltier. Ich habe mich jedenfalls nicht getraut, Sie zum Essen zu wecken. Aber ich kann Ihnen gerne noch etwas bringen, wenn Sie möchten.«
Das Knurren in meinem Magen nimmt mir die Antwort ab; sie lacht erneut.
»Einen kleinen Moment bitte. So hungrig darf ich Sie auf gar keinen Fall von Bord gehen lassen. Das würde ich mir nie verzeihen.«
Ich nicke ihr dankbar zu, wickle das Kabel der Kopfhörer um meine Hand und verstaue es in der Hemdtasche. Dabei blicke ich zum Fenster hinaus aufs Wolkenmeer, das von den Strahlen der aufgehenden Sonne in ein unbeschreibliches Licht getaucht worden ist. Ich vertiefe mich einen Moment in das sich mir bietende Schauspiel und lasse mich vom Farbenspektakel hinreißen.
Dann drücke ich auf eine Taste meines iBooks und betrachte den wieder zum Leben erwachenden Bildschirm. Er zeigt zwei geöffnete Fenster, zum einen meine iTunes-Mediathek und zum anderen eine PDF-Datei mit einem Gedicht von Alexander Skrjabin: Seine Hymne an die Kunst, die er im letzten Satz seiner ersten Symphonie zu einem Schlusschoral verarbeitet hat, ähnlich wie Beethoven mit der Ode an die Freude in seiner letzten Komposition dieser Gattung, die heute jedes Kind als Europahymne kennt.
Immer noch gefangen von Skrjabins wunderbaren Werk, das ich vor wenigen Tagen aufgeführt habe, stelle ich meinen Sitz in eine angenehme Position und reibe meinen verspannten Nacken.
Mein Blick überfliegt das Gedicht auf dem Bildschirm und bleibt bei den Zeilen hängen, die momentan am ehesten meinen Gemütszustand widerspiegeln:
In jener düsteren und kalten Stunde,
in der die Seele voller Verwirrung ist,
findet in dir der Mensch
die lebendige Freude des Trostes.
Ja, denke ich mir. So muss es wohl sein. Ich bin schon fast wieder in die Stimmung eingetaucht, in die mich das Gedicht und die pathetische Musik zu versetzen vermögen, als sich ein Schatten in mein Gesichtsfeld drängt, in welchem ich die Flugbegleiterin erkenne. Sie reicht mir ein Tablett und nickt mir freundlich zu:
»Lassen Sie es sich schmecken. Sie müssen einen Bärenhunger haben.«
Ich klappe meinen Laptop zu, lege ihn neben mir auf den freien Sitz und nehme die Mahlzeit entgegen. Als ich die Folie von der Schale entfernt habe, steigt mir der exotische Geruch eines Currygerichts in die Nase.
Erneut werfe ich einen Blick nach draußen, wo das Spektakel des Sonnenaufganges mittlerweile beendet ist und lasse einen tiefen Seufzer erklingen.
Bald bin ich zurück in meiner Heimat, in der Stadt, in der ich studiert habe, unweit des kleinen Dorfes, in dem ich aufgewachsen bin und das ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe. Eine Menge Gedanken rasen durch meinen Kopf, zahlreiche Erinnerungen machen sich in mir breit und lassen mich mit gemischten Gefühlen die Landung erwarten.
Viele bekannte Gesichter werden mir wohl während meines Aufenthaltes hier begegnen, doch ich denke nicht, dass sich die Art von Vertrautheit bei mir einstellen wird, die mich eigentlich beim Eintauchen in meine Vergangenheit begleiten sollte.
Und dann ist da noch Hannah.
»Sir?« Wieder die Flugbegleiterin. Ihr fragender Blick. »Mögen Sie kein Curry? Soll ich Ihnen etwas anderes bringen?«
Lächelnd winke ich ab und murmle ein paar entschuldigende Worte. Irgendwie ist mir der Appetit vergangen, und ich glaube, den Grund dafür zu kennen.
SU-MIN
Gerade als sie eine Kanne Grüntee aus Südkorea aufsetzen wollte, stellte Su-min fest, dass sie in dieser Woche noch mit niemandem richtig gesprochen hatte. Sie hielt einen kurzen Moment inne und versuchte, sich an ihre letzte ernsthafte Konversation zu erinnern.
Klar, ein paar wenige Worte hatte sie in den vergangenen Tagen mit diversen Leuten gewechselt. So hatte sie zum Beispiel eine Eintrittskarte und eine kleine Tüte Popcorn im Kino um die Ecke gekauft und sich den hochgelobten Animationsfilm angeschaut, deren Botschaft ihr aber verschlossen geblieben war. Kopfschüttelnd war sie in den grellen Sonnenschein hinausgetreten und hatte sich gefragt, ob ihre Intelligenz zu bescheiden oder die Ansprüche des Regisseurs an sein Publikum zu groß waren.
An der Sprache konnte das Verständnis für das technisch durchaus bemerkenswerte Werk nicht gescheitert sein – waren es doch die Bilder, die für sich gesprochen hatten, und die Musik hatte das ihrige zum Gesamtkunstwerk beigetragen. Aber der tiefere Sinn? Su-min hatte ihn nicht verstanden, genauso wie es ihr riesige Probleme bereitete, die Menschen in dieser Stadt, in diesem Land zu verstehen.
Das Fremdsein zog sich momentan wie ein roter Faden durch ihr Leben; vor einem halben Jahr hatte sie ihre Heimat verlassen und lebte seither in dieser Stadt, wo sie eine Orchesterstelle als Cellistin erhalten hatte.
Alle ihre Familienmitglieder und Freunde hatten sie vor diesem Schritt gewarnt.
»Wer soll sich denn um dich kümmern, meine Kleine?«, hatte ihre Tante Myung-soon beispielsweise gejammert. »So weit weg von uns! In einem fremden Land, in dem alles anders ist als hier! Du wirst einen gewaltigen Kulturschock erleiden!« Sie intonierte ihre Sätze immer mit Ausrufezeichen, und in der damaligen Situation hätte man gar zwei dieser Satzzeichen setzen müssen, damit ihre Verzweiflung adäquat zum Ausdruck gekommen wäre.
»Solch ein Blödsinn, Tante!« Sung-jong, Su-mins älterer Bruder hatte verständnislos den Kopf geschüttelt und war gar etwas laut geworden, was ihm einen tadelnden Blick seines Vaters eingebracht hatte. »Du darfst von deiner Generation nicht auf unsere schließen. Wir leben nicht auf einem fremden Planeten, wie ihr das scheinbar immer noch tut. Der Westen ist für die jungen Südkoreaner just around the corner. Ein Kulturschock – ich bitte dich. In welcher Zeit leben wir denn eigentlich!«
Seine Worte hatten Su-min vorläufig zu beruhigen vermocht, doch jetzt, wenn sie sich nach einem halben Jahr in der Fremde die Szene damals in ihrem Elternhaus wieder vor Augen führte, musste sie zugeben, dass die Bedenken von Tante Myung-soon ihre Berechtigung hatten.
Das Wasser kochte, und Su-min nahm die Pfanne von der Herdplatte. Sie goss den Inhalt in eine gläserne Kanne, die sie von ihrem Bruder Sung-jong als Abschiedsgeschenk erhalten hatte, und fügte die Blätter ihrer Lieblingsteesorte hinzu, grüner Daejak aus Hadong. Der aromatische Duft, der ihr in die Nase stieg, ließ sie einen kurzen Augenblick lang vergessen, dass sie sich fernab ihrer Heimat befand. Seufzend schloss sie die Augen und fühlte sich in die Wohnung ihrer Eltern versetzt.
Sie ist wieder ein kleines Mädchen und sitzt gemeinsam mit ihrem nervigen Bruder am Küchentisch, von wo aus sie beide ihrer Mutter beim Kochen zuschauen. Sung-jong quengelt, weil er wieder ins Wohnzimmer zurück möchte, um das neuste Computerspiel auszuprobieren und beginnt mangels Alternativen seine Schwester zu triezen. Die Mutter, die gerade rote Paprika in feine Streifen schneidet, dreht sich um und schimpft mit lauter und energischer Stimme, sodass Sung-jong sofort den Kopf einzieht und ehrfürchtig zu seiner Mutter hochblickt.
Wie oft hätte Su-min ihn auf den Mond schießen können! Wie froh wäre sie, wenn er jetzt hier wäre und sie in seine Arme schließen könnte.
Sie öffnete die Augen und sah vor sich die Teekanne, deren Inhalt schon deutlich an Farbe gewonnen hatte. Da sie aber einen sehr intensiven Geschmack bevorzugte, musste sie den Tee noch eine Weile ziehen lassen.
Und sonst? Nichts war vom imaginären Ausflug in ihre südkoreanische Vergangenheit übrig geblieben. Die Bilder waren verflogen, und an ihre Stelle war die einfache Zweiraum-Wohnung getreten, welche sie seit einem halben Jahr bewohnte und die der Orchestermanager für sie organisiert hatte. Es gab noch viel zu tun, was die Einrichtung anbetraf. Su-min fühlte sich in ihren vier Wänden überhaupt nicht wohl, doch sie hatte noch nicht die Energie aufgebracht, sich mit ihren verspielten Dekorationen, die sie so sehr mochte, zu beschäftigen und die Läden nach passenden Gegenständen abzuklappern.
Es war im Moment einfach alles zu viel für sie. Und das, obwohl sie schon ein halbes Jahr hier war. Hier in Europa, in dieser fremden Stadt, in der ihr die Menschen und alles drumherum so fremd waren. Könnte sie doch bloß wieder nach Seoul zurück!
EDGAR
Edgar stellte den Futternapf in die Spüle und drehte den Wasserhahn auf volle Leistung, sodass die gesamte Arbeitsplatte vollgespritzt wurde. Er ließ es geschehen und schaute dem Strahl zu, welcher die Fläche aus Chromstrahl in einen kleinen See verwandelte, aus dem einzelne Tropfen langsam wieder ins Becken zurückflossen.
Durch einen Vorhang aus Tränen hindurch beobachtete er die sich vor ihm ausbreitende Überschwemmung. Sein Kinn schlug gegen die Brust, und stoßweise kamen schluchzende Laute tief aus seinem Inneren heraus.
Verzweifelt suchte er in seinen Hosentaschen nach einem Taschentuch, und als er keines finden konnte, wischte er sich die Augen mit dem Handrücken wieder trocken. Dann griff er zu einer Bürste und schrubbte den Futternapf unter dem Wasserstrahl so lange sauber, bis nur noch die Kratzer auf dem blauen Plastik deutlich erkennen ließen, dass es sich bei dem Gefäß nicht um eine Neuerwerbung handelte.
Die Tränen waren mittlerweile versiegt, und Edgars Blick richtete sich starr zum Fenster hinaus, das sich oberhalb des Spülbeckens befand, während er den Napf fünf Minuten lang mit einem rot-weiß karierten Geschirrtuch trocken rieb. Als er mit dem Ergebnis zufrieden war, stellte er das Plastikteil sorgfältig vor sich auf die Arbeitsfläche und entnahm dem Küchenschrank einen Karton mit Katzennahrung. Hochkonzentriert zupfte er jeden Beutel einzeln aus der Box und richtete sie akkurat neben dem Futternapf aus. Fünf Mahlzeiten waren übrig geblieben, allesamt Fischgerichte mit Gemüse in Gelee. Caruso hatte sie geliebt, jedes einzelne Menü.
Mit versteinerter Miene griff er nach der Futterschale und warf sie mitsamt den Mahlzeiten in den Abfalleimer.
Zitternd schloss er die Schranktür und lehnte sich mit der Schulter daran. Seine Augenlider zuckten unkontrolliert, und er ballte die Hände zu Fäusten. Er konnte die Tränen erneut nicht mehr zurückhalten und rutschte die Holzverkleidung hinunter auf den Boden, wo er sitzenblieb und sich seiner Trauer hingab.
Er wusste nicht, wie lange er so dagesessen hatte; jegliches Zeitgefühl war ihm abhanden gekommen. Seine Augen waren verklebt, und er begab sich ins Badezimmer, um sich wieder einigermaßen frisch zu machen. Als er sein Antlitz im Spiegel erblickte, erschrak er und trat einen Schritt zurück. Beinahe hätte er sich nicht wieder erkannt, und daran waren nicht nur die geröteten Augen schuld. Die Trauer hatte tiefe Spuren hinterlassen; sein zerfurchtes Gesicht legte ein deutliches Zeugnis davon ab.
Er sah grauenhaft aus und ekelte sich vor der abstoßenden Gestalt, die ihm aus dem Spiegel entgegenblickte. Während er das Waschbecken mit Wasser füllte, erinnerte er sich an eine Textstelle des großen Schweizer Schriftstellers Friedrich Glauser, der einmal geschrieben hatte, dass es die Tiere nicht störe, ob jemand schön oder hässlich sei. Der Satz hatte Edgar damals, als er ihn gelesen hatte, sehr berührt und war für immer in seinem Gedächtnis haften geblieben.
Auch jetzt stellte er fest, dass seine Lippen wieder zu zittern begannen. Er drehte den Wasserhahn zu und tauchte sein Gesicht so lange ins Waschbecken, bis er es nicht mehr aushielt und laut prustend nach frischer Luft schnappte.
Tiere sind die besseren Menschen.
Wie oft hatte er diesen Satz zu Paula gesagt, und sie hatte ihm lächelnd mit der Hand über seine Wange gestrichen und gemeint:
»Was wirst du bloß einmal ohne Caruso machen, mein Liebling?«
Ja, er musste sich tatsächlich eingestehen, dass er momentan keinen Sinn mehr in seinem irdischen Dasein sah.
MANUEL
»Sind Sie mit Ihrer Suite zufrieden?«
Die strahlend weißen Zähne der Rezeptionistin hinter dem Tresen blitzen auf, und ihre dunklen, nahezu schwarz schimmernden Augen leuchten mir erwartungsvoll entgegen. Ihre cremefarbene Bluse bildet einen starken Kontrast zu ihrer mahagonibraunen Haut, und als ich zu ihr trete, kann ich ihren Namen auf dem Anstecker lesen, unter dem Logo der noblen Hotelkette: Jala.
Ich stütze mich auf die Theke und atme tief durch. Meine Lider sind schwer, und ich reiße mich zusammen, um etwas Konversation zu betreiben. Der Jetlag hat mich noch fest im Griff, die Müdigkeit ist enorm, und ich bereue es bereits, nicht im riesigen und weichen Bett geblieben zu sein.
»Mein Zimmer gefällt mir sehr gut.« Ich vermeide es strikt, den Begriff Suite zu benützen; zu aufdringlich, zu pompös erscheint er mir und deckt sich nicht mit den einfachen Verhältnissen, in denen ich aufgewachsen bin. »So wie Ihr Name«, fahre ich fort, froh darüber, einen Anknüpfungspunkt gefunden zu haben. »Er ist außergewöhnlich, ich habe ihn noch nie gehört. Hat er eine spezielle Bedeutung?« Das Lächeln fällt mir schwer.
Das Strahlen wird noch intensiver, und das Leuchten in ihren Augen verrät ihre Freude über meine Neugier.
»Es ist ein afrikanischer Name, er kommt aus dem Suaheli und bedeutet Die Besondere.«
»Und woher kommen Sie, wenn ich fragen darf?«
Ich zwinge mich, ihrem Blick nicht auszuweichen. Am liebsten würde ich die Augen schließen und an Ort und Stelle weiterschlafen. Das gleichmäßige Gemurmel, das aus der Hotellobby in meine Ohren dringt, verstärkt meine Müdigkeit.
»Meine Eltern kommen aus Tansania. Aber ich wurde hier in dieser Stadt geboren – und bin auch hier geblieben. Es gefällt mir hier.«
Hier, hier, hier.
Ich nicke nachdenklich und greife nach einem Prospekt, der auf dem Tresen liegt. Mit dem Finger streiche ich über den Seitenrand, ohne auch nur einen Blick auf den Inhalt der Broschüre zu werfen.
Ein kräftiger und herber Duft sticht mir in die Nase, mein eigenes Rasierwasser. Ich bin wohl wieder etwas zu großzügig damit gewesen, denke ich mir und fächle den Geruch mit dem Prospekt in Jalas Richtung. Die Empfangsdame strahlt mich immer noch an und scheint eine Reaktion auf ihre kurzen biografischen Angaben zu erwarten. Ich räuspere mich und setze ein gewinnendes Lächeln auf.
»Auch ich bin hier groß geworden.«
»Sie sind auch hier in der Stadt geboren?«
»Nein, ich habe lediglich hier studiert.«
Hier, hier, hier.
Jala blickt mich erwartungsfroh an, und ich spüre, dass sie gerne noch mehr erfahren würde. Doch ich habe keine Lust auf Konversation und schicke mich an, mich von ihr abzuwenden und dem Ausgang entgegen zu steuern. Strahlender Sonnenschein draußen.
»Also dann ...«
Da hebt sie die Hand, als ob sie mich in meinem Bestreben stoppen wolle, und wirft ein:
»Entschuldigen Sie bitte, aber würden Sie mir das hier vielleicht signieren?«
Sie hält mir das Booklet einer CD und einen Filzstift entgegen. Ich werfe einen flüchtigen Blick auf das Cover – Madama Butterfly – und frage mich, ob sich die junge Dame wirklich für klassische Musik interessiert. Als ob sie meine Gedanken lesen könnte, fügt Jala hinzu:
»Es ist nicht für mich, meine Arbeitskollegin hat mich darum gebeten. Sie ist bis nächste Woche im Urlaub. Könnten Sie bitte Für Sarah schreiben?«
Eine leichte Enttäuschung macht sich in mir breit, und ich ertappe mich dabei, dass ich lieber eine Widmung für Jala aufs Booklet gekritzelt hätte. So erfülle ich ihre Bitte, gebe ihr das Büchlein und den Filzschreiber zurück, nicke ihr mit ein paar entschuldigenden Blicken zu und verlasse mit raschen Schritten die Hotellobby.
Das Sonnenlicht blendet mich, als ich durch die Drehtür trete, und für einen kurzen Moment werde ich von einem Schwindel befallen und versuche, mich irgendwo festzuhalten. Ich spüre eine Hand auf meiner Schulter und genieße den Augenblick der Entspannung.
Verantwortung abgeben. Mich fallen lassen. Am besten gehe ich auf mein Zimmer zurück.
»Ich Ihnen nicht gut? Sie sind ganz bleich! Soll ich einen Arzt rufen?« Der Portier blickt mich besorgt an.
Ich atme tief durch, spüre die warmen Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht und schließe meine Augen, suche mein Gleichgewicht. Die stützenden Hände geben mir Sicherheit, lassen mich wieder zu Kräften kommen. Ich lasse meinen Kopf kreisen und mache vorsichtig einen Schritt vorwärts.
»Es ist alles in Ordnung.« Ich nicke dem uniformierten Türsteher dankbar zu und suche in meiner Hemdtasche nach etwas Geld. »Bloß ein kleiner Schwindelanfall. Zu viel Stress in letzter Zeit. Zum Glück waren Sie zur Stelle!« Ich stecke ihm einen Schein zu und trete auf den Gehsteig. Erst jetzt nehme ich den Autolärm wahr und schaue mich um. Erstaunt bemerke ich, dass ich den Prospekt, den ich vom Tresen genommen habe, immer noch in der Hand halte. Kurz bevor ich ihn entsorgen will, werfe ich noch einen Blick darauf und stocke für einen kurzen Moment.
Wöchentliche Kulturagenda lese ich und überfliege die aufgelisteten Veranstaltungen. Ausstellungen, Lesungen, Theateraufführungen, Konzerte. Ich studiere die letzte Rubrik etwas genauer, und tatsächlich finde ich da auch mein Konzert. Dahinter, in fetten Lettern: ausverkauft!
Auf der letzten Seite der Broschüre entdecke ich außerdem ein Foto von mir und ein paar Zeilen über die außergewöhnliche Situation des Anlasses. Nur beiläufig interessiert überfliege ich den Text und frage mich, wie alt das Bild wohl sein mochte; ich vermag mich nicht zu erinnern, wann die Aufnahme gemacht worden ist, entschließe mich aber, sie scheußlich zu finden. Ich muss unbedingt meinem Manager Mario den Auftrag geben, die offiziellen Fotos einmal durchzuschauen und allenfalls einen Termin mit einem guten Fotografen zu vereinbaren.
Ich werfe einen letzten Blick auf das Bild, bevor die Broschüre im Abfalleimer landet.
Naja, ein wenig eitel wird man ja wohl sein dürfen!
NORA
»Das darf doch nicht wahr sein!«
Nora umklammerte die weiße Tasse mit dem extra großen Caramel Macchiato so fest, dass sich ihre Knöchel hell abzeichneten. Ihr Mund stand offen, und die Augen weiteten sich so stark, dass selbst ein Außenstehender das Erstaunen, von dem sie in diesem Moment umschlungen war, problemlos von ihrem Gesicht hätte ablesen können. Der Blick ging nach draußen, durch die Scheiben des Starbucks Cafés, auf die Straße, in der gerade ein nachtblauer Mercedes seitwärts einparkte.
»Kennst du den?« Ihre beste Freundin Sophie verfolgte das Parkmanöver und freute sich heimlich diebisch darüber, dass es dem Fahrer, einem attraktiven Mittvierziger, nicht im ersten Versuch gelungen war, seinen Wagen wunschgemäß abzustellen. Dieser schien gemerkt zu haben, dass er beobachtet wurde und sah kurz zu Sophie rüber, die ihm ihr bezauberndstes Lächeln schenkte. Er lief knallrot an, was selbst auf diese Distanz festzustellen war, senkte seinen Blick und drehte wie wild an seinem Steuerrad.
Sophie lachte laut.
»Ich finde den schnuckelig. Du darfst mich gerne mit ihm bekannt machen.«
Nora blickte verständnislos zu ihrer Freundin und stellte erst jetzt fest, dass sie nicht über das Gleiche sprachen.
»Nein, ich meine doch nicht den Mercedes«, meinte sie etwas zu laut, sodass sie ein paar verärgerte Blicke vom Nebentisch erntete. Sie stellte ihre Tasse ab und zeigte mit dem Finger nach draußen, zwei Wagen weiter rechts, wo sich gerade ein Mann mit langen weißen Haaren und einem ebensolchen Bart von der Parkuhr abwandte. Die dreckigen Jeans waren ihm viel zu weit, und das rosafarbene Poloshirt hatte zweifelsohne auch schon bessere Tage hinter sich – abgesehen davon, dass es überhaupt nicht zu seiner hellen Haut und den weißen Haaren passte.
»Ach, du meinst diesen Pseudo-Nikolaus?« Sophie klang verärgert und blickte wieder zum Mercedesfahrer, der mittlerweile seinen Wagen geparkt hatte und ausgestiegen war. Er hatte seine Fassung wieder gewonnen und zwinkerte Sophie mit einem schelmischen Lächeln zu, sodass diese nun verlegen wurde und sich abwandte, um wieder in die Richtung des alten Mannes zu blicken.
Nora beobachtete jede seiner Bewegungen wie hypnotisiert und warf mit flüsternder Stimme ein:
»Das ist doch Mirandas Vater!«
»Welche Miranda meinst du?« Sophies Interesse war nun geweckt.
»Wie viele Mirandas kennst du denn?« Nora wirkte genervt.
»Miranda? Unsere ehemalige Schulkameradin, mit der du am Klassentreffen letzten Monat so angeregt getratscht hast?«
Nora überhörte die spitze Bemerkung ihrer Freundin, knuffte sie stattdessen in den Oberarm und deutete wieder nach draußen. Sie konnte sich fast nicht beherrschen.
»Siehst du? Er tut es schon wieder!«
Tatsächlich war der Alte zur nächsten Parkuhr geschlendert, hatte sich verstohlen nach links und rechts umgeschaut und dann seine Finger in die Münzausgabe gesteckt. Einen kurzen Moment konnte man die Enttäuschung in seinem Gesicht ablesen, dann steckte er die Hände wieder in seine Hosentaschen, vergewisserte sich nochmals, dass ihn niemand beobachtet hatte und nahm die nächste Parkuhr ins Visier.
Jetzt hatte tatsächlich auch Sophie vor lauter Erstaunen vergessen, ihren Mund zu schließen. Nora nickte ihr zu und deutete ihr an, etwas näher zu ihr hin zu rutschen. In verschwörerischem Tonfall erzählte sie:
»Ich bin mir ganz sicher, dass es Mirandas Vater ist. Sie wohnte mit ihrer Familie nämlich gleich um die Ecke, als wir gemeinsam zur Schule gingen. Er war schon früh ergraut, und den Bart hatte er bereits damals stehen lassen. Ich glaube, er leitete eine Bankfiliale, wenn ich mich nicht täusche. Miranda hat mir am Klassentreffen erzählt, dass er letztes Jahr in Rente gegangen sei und dass er kurz darauf seine Frau wegen einer schweren Krankheit verloren habe.«
»Mirandas Mutter?«
»Nein, die beiden trennten sich, kurz nachdem Miranda aus der Schule gekommen war. Ihre Mutter lebt alleine, der Vater hat wieder geheiratet.«
»Aber was macht er denn da?«, fragte Sophie erstaunt und folgte dem weißhaarigen Mann mit ihren Blicken weiter die Straße hinunter, wo sich an jeder Parkuhr die gleiche Prozedur abspielte.
»Wonach sieht es denn aus?« Nora schüttelte verständnislos den Kopf. »Er sucht nach Kleingeld.«
»So wie ein Penner?« Das war Sophie nun etwas zu laut herausgerutscht, und auch sie erntete verärgerte Blicke vom Nebentisch, wo sich zwei Herren mit Krawatte über ihren Laptop beugten.
Die zwei Frauen steckten ihre Köpfe näher zusammen und Sophie verfiel wieder in einen Flüsterton:
»Aber sagtest du nicht, dass er in einer Bank gearbeitet hat? Der hat doch bestimmt eine anständige Rente und muss nicht die Stadt nach Kleingeld abklappern.«
»Ja, das dachte ich eigentlich auch. Es ist merkwürdig.« Noras Stimme war völlig tonlos, und synchron mit Sophie beugte sie sich nach vorne, um den alten Mann nicht aus ihrem Sichtfeld zu verlieren.
Der war inzwischen an der nächsten Parkuhr angelangt, in die er nach dem obligaten Blick nach links und rechts wieder die Finger steckte – und innehielt. Scheinbar war er fündig geworden, denn ein kurzes Lächeln erhellte sein Gesicht, bevor er die Hand wieder in die Tasche steckte.
Sophies Mund stand immer noch offen, als sie ihren Kopf wieder zurückdrehte – und enttäuscht feststellte, dass der nachtblaue Mercedes mit dem attraktiven Fahrer inzwischen verschwunden war.
ANTOINE
Für Léa, den leuchtenden Sonnenstrahl, der die düstere Wolkendecke durchbrochen und mein Leben wieder mit funkelndem Licht erfüllt hat.
Mit schwungvoller Schrift hatte Antoine die Widmung auf ein weißes Blatt Papier geschrieben und las sie immer wieder durch.
Ein wenig gar pathetisch, überlegte er sich und strich den ganzen Zusatz durch, sodass nur noch Für Léa stehen geblieben war. Unzufrieden schüttelte er den Kopf, zerknüllte das Papier und nahm ein neues vom Stapel, vor welchem er in Gedanken versunken sitzen blieb.
Für Léa, meinen Sonnenschein.
Nein, nein, nein! Das tönte irgendwie nach einer Eltern-Kind-Beziehung. Unmöglich! Das Blatt folgte seinem Vorgänger in den Mülleimer.
Für Léa, die Liebe meines Lebens.
Aber war sie das denn auch wirklich?
Er hatte sie in den Semesterferien kennengelernt, die er zu Hause bei seinen Eltern am Meer verbracht hatte. Es waren herrliche Monate voller Unbeschwertheit, Ruhe und Entspannung gewesen, bevor er das Praktikum als Flötist beim Orchester antreten würde. Er hatte sich mit Freunden getroffen, mit denen er gemeinsam groß geworden war, aber schon lange nicht mehr gesehen hatte.
Seit er hierher gezogen war, um zu studieren, hatte er sich darum bemüht, die Kontakte mit den Menschen aus seiner Heimat nicht abbrechen zu lassen – wozu gab es schließlich die sozialen Medien. Aber trotzdem hatte er sie enorm vermisst und es kaum erwarten können, ihnen wieder gegenüber zu sitzen, über alte Zeiten zu plaudern und zu erzählen, was er in der Fremde so alles erlebt hatte.
Viele Stunden hatte er mit ihnen in den kleinen Bistros und Cafés am Strand verbracht und sich bis spät in die Nacht mit ihnen ausgetauscht. Abfeiern und Party machen war nicht so sein Ding, er zog eine gemütliche Runde unter guten Bekannten dem pulsierenden Lärm und den verschwitzten Körpern in einem Club vor. Auf diese Art hatte er auch die Bekanntschaft von Léa gemacht: Raymond, ein guter Freund, mit dem er früher stundenlang Pétanque gespielt hatte, hatte sie eines Abends mitgebracht und sie Antoine vorstellt. Der war vom ersten Augenblick an Feuer und Flamme für das junge Mädchen und umgarnte sie den ganzen Abend lang, versprühte seinen gesamten Charme, Witz und Esprit, bis sie schließlich in ein Rendezvous am nächsten Abend einwilligte.
Bei diesem Date war sie plötzlich viel interessierter und gesprächiger als noch am Vorabend, das Eine führte zum Anderen und ehe sich beide versahen, landeten sie zusammen im Bett, und Léa beteuerte ihm am Morgen danach, wie ernst es ihr mit ihm sei – auch wenn er nach seinem Urlaub viele Kilometer entfernt von ihr sein Praktikum beginnen würde.
»Eine Fernbeziehung ist eigentlich nicht das, was ich mir gewünscht habe«, flüsterte sie ihm ins Ohr, »aber Liebe kennt ja bekanntlich keine Distanz.«
Ihre Worte klangen in ihm noch nach, als ob er sie gestern vernommen hätte. Die Bilder seines Urlaubs liefen wie ein Film vor seinem geistigen Auge ab. Seufzend stützte er seinen Kopf in die Hände und blickte auf das weiße Blatt, das vor ihm auf dem Tisch lag, und die Gegenwart holte ihn wieder ein.
Für Léa, die Liebe meines Lebens.
Ja, das war die Widmung, die sie verdiente! Nun musste ihm bloß noch die passende Komposition dazu einfallen! Das eine oder andere Motiv war ihm bereits durch den Kopf gegangen und wartete auf seine Verarbeitung.
Er wollte gerade zur Flöte greifen und sich die Melodien in Erinnerung rufen, als die Tür seines Zimmers unsanft aufgerissen wurde.
»He, Anton. Kann ich das haben?«
Max, einer seiner beiden Mitbewohner streckte den Kopf hinein und hielt einen Becher Schokoladen-Joghurt hoch. Niemand nannte ihn hier bei seinem richtigen Namen.
»Schon mal was von Anklopfen gehört?« Antoines Ton war vorwurfsvoll und genervt. Max würde es wohl nie lernen.
»Sorry. Was ist denn jetzt mit dem da?« Er deutete auf den Joghurt.
»Das soll morgen mein Frühstück sein, das ich gemeinsam mit einer guten Tasse Kaffee gerne zu mir nehmen würde.«
»Boah, was labberst du denn so geschwollen?« Max verzog sein Gesicht. »Man könnte meinen, du seist der Sprachspezialist hier im Haus.«
Scott, der Dritte im Bunde der WG, studierte Germanistik, und wenn er so richtig in Fahrt kam, dann sprudelten die hochkompliziertesten, ineinander verschachtelten Sätze aus seinem Mund, die allesamt druckreif waren und seine beiden Mitbewohner nicht mehr aus dem Staunen kommen ließen.
Antoine warf Max einen wütenden Blick zu, der diesem signalisieren sollte, dass das Gespräch für ihn beendet war. Dieser war noch nicht bereit, die Waffen zu strecken.
»Ich könnte morgen ja rasch beim Bäcker vorbei gehen und frische Croissants mitbringen.« Er betonte das Wort mit einem übertriebenen, französischen Akzent.
Natürlich, dachte sich Antoine. Wenn ich beim Frühstück sitze, dann wälzt du dich noch eine Runde verschlafen im Bett.
»Komm schon, Anton.« Max gab nicht auf. »Ich habe mich den ganzen Tag mit Picasso rumgeschlagen«, die blaue Periode war das Thema von Max’ Masterarbeit, »und – ich – habe – Hunger!«
»Da wird dir ein Joghurt nicht viel weiterhelfen«, warf Antoine ein. »Warum gehst du nicht zum Chinesen um die Ecke? Du könntest mir auch gleich was mitbringen.«
»Anton!« Max’ Blick glich demjenigen eines treuherzigen Hundes. »Hab doch keine Zeit um rauszugehen. Ich brauch bloß ein wenig Energie und Vitamine.«
»Das alles aus einem Joghurt?«
»Bitte ...«
»Na schön! Guten Appetit!« Antoine stand auf und griff nach seiner Jacke. Der Gedanke an das nahegelegene China-Restaurant hatte seine Sparvorsätze über den Haufen geworfen. Heute würde er es sich so richtig gut gehen lassen!
EDGAR
»Du hast es gut, du musst nicht mehr in dieser Welt leben.«
Edgar wischte sich eine Träne aus den Augen und wickelte das Krepppapier von den Blumen. Er kniete vor dem Grab nieder und wischte mit einer zärtlichen Handbewegung einen imaginären Fleck vom Granitstein. Für einen kurzen Augenblick stellte er sich vor, er würde Paulas Wange streicheln und dafür aus ihren wunderschönen dunklen Augen einen dankbaren Blick voller Liebe und Vertrauen erhalten. Er erinnerte sich an unzählige Momente, in denen er am Rand ihres Spitalbettes gesessen und ihre Hand fest umschlossen hatte. Als ob er ihr damit signalisieren wollte, dass sicher alles gut kommen würde, obwohl sie beide es besser wussten.
Paula hatte Tulpen geliebt. »Sie stehen für die Vergänglichkeit und mahnen uns immer wieder an unser begrenztes Dasein«, hatte sie jeweils gemeint, schon lange bevor die Leukämie bei ihr diagnostiziert worden war.
Und so brachte er ihr jede Woche frische Tulpen an ihre letzte Ruhestätte und achtete sorgsam darauf, dass er die Pflanzen mit den dunkelrotesten Blütenblättern auswählte. Je dunkler desto schöner, hatte er von Paula gelernt.
Seine Frau hatte für alles immer eine Antwort parat gehabt, und es schien ihm, als hätte sie für jede Situation eine Weisheit zitieren können, die Ordnung und Klarheit in sein Leben gebracht hatte.
Edgar drapierte die Blumen sorgfältig vor dem Grabstein, erhob sich und trat anschließend einen Schritt zurück, um sich zu vergewissern, dass der Gesamteindruck zu seiner Zufriedenheit ausfiel.
Seufzend entnahm er seiner Tasche eine kleine, runde Urne, etwas größer als ein Tennisball, in der sich Carusos Asche befand. Er nahm die blaue Tonkugel, die mit kleinen, feinen Sternen gesprenkelt war, in beide Hände und kniete erneut vor Paulas Grab nieder.
»Nun wirst du unseren lieben Kater wieder in deine Arme schließen können«, flüsterte er und suchte nach der passenden Stelle, an der die Urne am besten zur Geltung kommen würde.
Sie hatten beide ihr Haustier geliebt und vergöttert. Es war ihr Ersatz für das Kind gewesen, das sie nie hatten bekommen können, nachdem Paula eine Fehlgeburt erlitten hatte. Ihre Trauer war unendlich groß gewesen, und nachdem sie sich eine Katze zugelegt hatten, die sie aber schon nach kurzer Zeit wegen einer schlimmen Krankheit hatten einschläfern lassen müssen, war Caruso in ihr Leben getreten und blieb beinahe zwanzig Jahre lang ihr Liebling.
Er hatte Paula überlebt, wenn auch nur für kurze Zeit. Schon zu ihren Lebzeiten hatte der Tierarzt bei dem Kater eine unheilbare, chronische Niereninsuffizienz festgestellt, die man mit Tabletten und Diätfutter aufzuschieben versuchte.
Tatsächlich hatte sich Caruso noch fünf Jahre lang bester Gesundheit erfreut, auch wenn er kontinuierlich an Gewicht verlor, was für diese Krankheit aber normal sei, wie ihnen der Tierarzt versicherte.
Nach Paulas Tod war aber auch Carusos Zerfall innerhalb von kurzer Zeit stark fortgeschritten, sein Fell wurde filzig, er urinierte in sämtliche Ecken der Wohnung, weil er sein Wasser nicht mehr halten konnte, und wog weniger als zwei Kilogramm. Nachdem ihm die Kortison-Spritze eher geschadet als geholfen hatte, empfahl der Tierarzt, den Kater gehen zu lassen, wie er sich ausdrückte.
Für Edgar brach eine Welt zusammen. Innerhalb von weniger als einem Jahr hatte er mit Paula und Caruso alles verloren, was ihm wichtig war – beinahe. Noch blieb ihm die Musik, welche ihm Trost zu spenden vermochte. Er legte Bachs Sonaten und Partiten auf sein Notenpult und ließ sich beinahe Tag und Nacht von der Schlichtheit und Raffinesse der Kompositionen berauschen.
Die klare Struktur der Musik gab ihm wieder Halt und Ordnung, wusch ihn rein und ließ ihn erneut ins Leben eintauchen, das er aber, so hatte er den Eindruck, bloß noch aus einer verschwommenen und verzerrten Optik wahrnahm. Es war, als ob sich um seinen Körper herum ein durchsichtiger Kokon gebildet hatte, der sämtliche Gefühle von ihm abhielt und ihn emotionslos werden ließ.
Er war nun alleine auf dieser Welt, es blieb ihm noch seine Anstellung im Orchester, eine Tätigkeit, die er normalerweise mit viel Leidenschaft ausübte, die jedoch in seinem momentanen Zustand eher zur Belastung als zur Ablenkung geworden war.
Wenn er alleine musizierte, so war es ihm möglich, in eine Welt einzutauchen, in der alles in Ordnung zu sein schien. Er konnte über den Auf- oder Abstrich selber entscheiden, es war seine Entscheidung, ob in diesem Takt ein ritardando angebracht war oder nicht, und das richtige Tempo erschloss sich ihm quasi von selbst und wurde nicht von einem selbstverliebten Dirigenten vorgegeben.
Er hatte noch mehr als zehn Jahre vor sich, bevor er in Rente gehen, die Orchesterdienste hinter sich lassen und nur noch das tun konnte, was ihm wirklich Spaß bereitete.
Doch was war das eigentlich?
SU-MIN
Das Probespiel!
Mit Schaudern erinnerte Su-min sich daran, obwohl ihre Bewerbung erfolgreich ausgefallen war. Sie hatte lange gezweifelt, ob sie sich auf eine Orchesterstelle in Europa melden sollte. Im asiatischen Raum hatte sie bloß ein paar wenige Ausschreibungen entdeckt, in denen eine Cellistin oder ein Cellist gesucht wurde – und immerhin war Europa so etwas wie die Wiege der Kultur, gerade was die klassische Musik anbelangte. Amerika hatte sie nie gereizt. Zu groß, zu unpersönlich, zu wenig Tradition. Schon an der Hochschule für Musik, an der Sunhwa Art School, wurden die europäischen Orchester über den grünen Klee gelobt und als das Maß aller Dinge hochgejubelt.
So war es für Su-mins musikalische Entwicklung eigentlich nichts als logisch gewesen, dass sie sich nach Orchesterstellen in Europa umsah, nachdem sie das Cellodiplom mit Auszeichnung erworben hatte. Ob es für ihre persönliche Entwicklung auch das Beste wäre, daran zweifelte sie stark. Allerdings teilte sie ihre Ängste vor der Fremde mit niemandem, so wie es ihrer zurückhaltenden Art entsprach. Im besten Fall hatte vielleicht Seo-yun, ihre Studienkollegin und beste Freundin an der Sunhwa, etwas von Su-mins Sorgen mitbekommen. Nicht aber, weil die angehende Cellistin darüber gesprochen hätte, nein, eher daher, dass Su-min sich noch leiser und zurückhaltender als gewöhnlich verhielt, wenn über das Leben in Europa gesprochen wurde.
Und so bewarb sich Su-min auf verschiedene Orchesterstellen, auch zwei aus Japan waren darunter, und wurde in dieser Stadt in Europa, in der sie sich nun befand, zu einem Vorspiel eingeladen.
Mit klopfendem Herzen organisierte sie die Reise. Seo-yun hatte selber Vorspieltermine und konnte sie nicht begleiten, und so wandte sie sich an ihren großen Bruder und bat ihn, für das Vorspiel mit nach Europa zu kommen.
»Ich war noch nie so weit weg«, sagte sie ihm mit leiser Stimme. »Einmal China, zweimal Japan, aber Europa ...« Und damit wurde sie noch leiser. »Ich habe Angst.«
Sung-jong betrachtete seine kleine Schwester aufmerksam. Er sah in ihr immer noch das zarte, feingliedrige, schüchterne und zurückhaltende Mädchen, das sie schon immer gewesen war, und eigentlich musste er sich eingestehen, dass sie sich mit ihren fünfundzwanzig Jahren nicht groß verändert hatte.
»Aber weshalb willst du denn überhaupt nach Europa gehen, wenn du dich so davor fürchtest?«, fragte er sie mit Besorgnis. Sie verbarg den Kopf in den Händen und wimmerte vor sich hin.
»Weil es so sein muss«, glaubte er zu verstehen. Er nahm ihre Hände weg vom Gesicht und legte sie in die seinen. Lange betrachtete er sie eindringlich. Sie versuchte, seinem Blick auszuweichen, doch er zwang sie, ihn anzusehen.
»Hör mir zu, Schwester«, begann er, »wenn du wirklich deine Heimat verlassen willst, weg von Südkorea, dann werde ich dich unterstützen, wo ich nur kann. Ich habe schon Tante Myung-soon, der alten Schwarzseherin, gesagt, dass der viel beschriebene Kulturschock von uns Asiaten in Europa bloß noch ein Problem der älteren Generation ist.«
Su-min erinnerte sich an die Szene bei ihrer Tante, die ihre musikalische Ausbildung finanziell unterstützte, indem sie ihr ein hochwertiges Instrument gekauft hatte, dessen warmer Ton Su-min vom ersten Moment an in ihr Herz schloss und auf dem sie viele, viele Stunden geübt und sich die Finger blutig gespielt hatte.
»Ja«, sagte sie zu Sung-jong, der ihr mit dem Daumen eine Träne von der Wange wischte. »Ich werde es mir gut überlegen.«
Und so waren sie einen Monat später unterwegs nach Europa zum Probespiel, dem Su-min aufgeregt entgegenfieberte. Als Pflichtstück war der erste Satz aus Haydns C-Dur-Konzert gefordert, ein Werk, das Su-min liebte und bereits zweimal mit dem Hochschulorchester gespielt hatte.
Der Vorhang, der zwischen der Jury und den Kandidaten aufgehängt war, vereinfachte Su-min das Vorspielen. Dadurch, dass sie nur gemeinsam mit einer Pianistin auf der Bühne saß und nicht in den Zuschauerraum blicken konnte, in der sich der Wahlausschuss befand, fiel die Nervosität etwas von ihr ab, und sie stellte sich vor, dass sie sich alleine in ihrem Zimmer befand und das Stück spielte.
Die Klavierspielerin, eine ältere Dame mit einem freundlichen Gesicht, die viel Geduld ausstrahlte, spielte auf dem Flügel vier Takte vor dem Einsatz, und Su-min nahm die farbenvolle Vorgabe dankbar auf und setzte kraftvoll mit dem verspielten Thema Haydns ein.
Sie hatte sich gerade so richtig warm gespielt, als die Pianistin die Begleitung abbrach, es waren gewiss nicht mehr als drei Minuten vergangen, und ihr mit einem lächelnden, aber bestimmten Nicken deutete, dass ihr Vorspiel beendet sei.
Etwas verwirrt verließ Su-min die Bühne und fragte sich, ob ihr Vortrag so schlecht gewesen war, dass man sie nur so kurz hatte vorspielen lassen. Als sie im Foyer ihrem Bruder in die Arme fiel und anschließend beobachtete, dass auch all ihren Nachfolgern nur so wenig Zeit zur Verfügung gestellt wurde, um sich zu präsentieren, beruhigte sie sich wieder etwas.
Sie hatte allerdings nicht das Gefühl, dass ihr das Vorspielen besonders gut gelungen war und war erstaunt, dass am Ende des ersten Durchgangs, nach rund fünfzig Kandidaten, ausgerechnet sie in die zweite Runde aufgeboten wurde, in die es nur noch acht weitere Bewerber geschafft hatten.
Als sie ihren Namen hörte, setzte ihr Herzschlag beinahe aus, und sie fiel Sung-jong in die Arme.
»Ich habe es dir doch gesagt, meine kleine Su-min«, flüsterte er ihr stolz ins Ohr. »Um solch ein Talent wie du es bist, kommen sie gar nicht herum. Jetzt wirst du nochmals so richtig Vollgas geben.«
Su-min konnte ihre Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Sie stand in enger Umarmung mit ihrem Bruder mitten im Raum, in dem die einen enttäuschten Cellisten ihre Instrumente zusammenpackten und die anderen glückstrahlend auf die nächste Runde warteten.
»Oh, my dear, that was just the first round«, hörten sie einen distinguierten Engländer mit näselnder Stimme sagen, der enttäuscht mit dem eingepackten Instrument an ihnen vorbeischritt.
»Chugha«, gratulierte ihnen ein Landsmann, der die erste Runde ebenfalls nicht überstanden hatte und klopfte ihr aufmunternd auf die Schultern.
Plötzlich begannen Su-mins Beine zu zittern, und sie hielt sich an ihrem Bruder fest. Es wurde ihr bewusst, dass eigentlich noch gar nichts gewonnen war.
MANUEL
Meine noch sehr junge Karriere als Dirigent ist in den letzten paar Jahren mit rasanter Geschwindigkeit vorangetrieben worden. Ob tatsächlich meine künstlerischen Fähigkeiten als Orchesterleiter dafür ausschlaggebend waren oder die raffinierte PR-Strategie von Mario, meinem Manager – das möchte ich einmal dahingestellt lassen.
Gustav Mahler soll einmal gesagt haben: »Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.« Wie habe ich mich während meines Studiums immer wieder auf dieses Zitat bezogen und meine Kommilitonen damit beinahe in den Wahnsinn getrieben!
Wenn ich mir heute allerdings anhören muss, wie gewisse Dirigenten versuchen, Anton Bruckner im Stile Franz Schuberts darzubieten oder seine Symphonien mit so zerdehnten Tempi dirigieren, dass sie beinahe auseinanderfallen und doppelt so lange dauern, wie der gute Anton das ursprünglich beabsichtigt hatte, so muss ich mich von Mahlers Ausspruch deutlich distanzieren. Am liebsten würde ich den Frevlern dann zurufen: »Schaut zuerst einmal in die Noten und macht euch die Mühe, das nachzuvollziehen, was der Komponist beabsichtigt hat, bevor ihr eure Ego-Trips der Welt als die einzig wahre Anschauung einer Bruckner-Symphonie verkauft! Beschäftigt euch zunächst einmal damit, was auf dem Blatt geschrieben steht, bevor ihr zwischen den Zeilen lesen wollt!«
Ich selber habe Bruckners achte Symphonie erst einmal dirigiert, nicht lange nach meinem Einstand als Orchesterleiter. Rückblickend muss ich sagen: Katastrophe!
Diesem Werk verdanke ich ein Erlebnis, das mein Leben und meine künstlerische Entwicklung verändert hat. In jungen Jahren, ich hatte meine Ausbildung an der Musikhochschule gerade erst begonnen, gastierte der große Victor Steinmann in der Stadt und leitete eine Aufführung dieser Symphonie. Ich hatte damals schon viel über diesen Klangmagier gehört, wie man ihn nannte. Noch nie hatte ich aber eines seiner Dirigate erleben können – bis auf diesen Abend. Ich hatte mir zu einem Sündenpreis eine Karte ergattern können – einer der billigsten Plätze, nur so nebenbei. Mein Blick auf die Bühne war eingeschränkt, und ich musste mich recken und strecken, wenn ich überhaupt etwas vom Maestro sehen wollte. Doch das war gar nicht nötig.
Schon als er die Bühne betrat, spürte ich eine Aura, die sich im Raum ausbreitete und ihn vibrieren ließ, noch bevor Steinmann auch nur den Arm erhoben hatte, um den Einsatz zu geben.
Völlig entrückt und mit offenem Mund lauschte ich den Klängen, die der Maestro dem Orchester entlockte und die mich in eine andere Welt katapultierten. Doch es war nicht nur dieser einmalige Klang, der mich verzauberte, nein, es war die Gesamtkonzeption, mit welcher der Pultstar das Werk den Zuhörern darbot: eindringlich, bestimmt, souverän. Ohne zu deuten, nein, von Interpretation zu sprechen wäre verwegen gewesen – er ließ bloß das spielen, was in den Noten steht. Was für eine Kunst!
Als nach dem gleichzeitigen Erklingen sämtlicher Themen das Werk in strahlendem C-Dur endete – ein völliger Sieg des Lichts über die Finsternis – saß ich wie narkotisiert im Sessel, unfähig Applaus zu spenden und schwebte immer noch in spätromantischen Sphären. Nichts mehr war so wie zuvor! Alles schien sich für mich geändert zu haben.
Mit Demut blieb ich auch noch sitzen, als die anderen Zuhörer sich an mir vorbeidrängten und wahrscheinlich ihren Unmut über mich ausließen, dass ich nicht aufstand und ihnen damit genug Platz zum Durchgehen bot.
Ich wusste: Das wollte ich auch machen! So wollte ich Musik auch darbieten können, und von diesem Moment an war Victor Steinmann mein größtes Idol, mein Vorbild, mein Abgott – und ich war unfassbar entsetzt und verstört, als ich in der Zeitung von seinem gewaltsamen Tod lesen musste.
Und so versuchte ich eben damals, als ich die achte Symphonie zum ersten Mal aufführte, mich an diesen magischen Abend zu erinnern und es Victor Steinmann gleich zu tun. Das konnte nur in einer Katastrophe enden – für mich persönlich. Das Konzert war ein Erfolg, das Publikum begeistert, die Kritiken wohlwollend. Doch ich hatte gemerkt, dass ich aufhören musste, meinem Vorbild nachzueifern und dass ich meinen eigenen Weg finden musste, um mich mit der Musik auseinanderzusetzen.
Und gibt es dazu eine bessere Gelegenheit, als dies hier in dieser Stadt zu versuchen? Hier, wo ich meine Studien begonnen und meine ersten Schritte als Dirigent unternommen habe. Hier soll es geschehen! Hier will ich allen zeigen, welchen Reifeprozess ich in den vergangenen Jahren durchgemacht hatte! Hier soll Bruckners Achte so erklingen, wie es der gute Anton unter ständigem Zweifel an sich selbst notiert hatte.
Ich bin bereit! Es werde Licht!
ANTOINE
»Ich hab die Schnauze so was von voll von dieser Trümmerliteratur!«