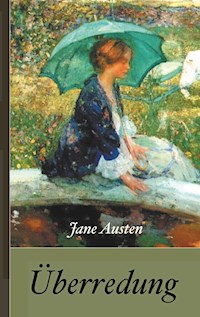7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die feine englische Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts: Nach dem Tod ihres Vaters stehen die Schwestern Elinor und Marianne Dashwood beinahe mittellos da. Kein Wunder also, dass sie sich nach einer guten Partie umsehen. Doch wie verschieden sind die beiden Schwestern. Während Elinor all ihren Verehrern kühl gegenübertritt, schwärmt die hübsche Marianne von der romantischen Liebe. Und Marianne scheint auch das große Los gezogen zu haben. Der junge, stattliche Willoughby macht ihr Geschenke und bietet ihr lange Kutschfahrten und romantische Spaziergänge. Um so schlimmer für die zarte Marianne, als er sie bitter enttäuscht. "Einmal im Leben sollte jede das Recht haben, aus Liebe zu heiraten." Jane Austen Jane Austens Kunst der Seelenanalyse mutet bis heute modern an. "Austen war kein zahmes Huhn, das in seinem literarischen Vorgärtchen pickte, sondern das eleganteste satirische Talent des ausgehenden 18. Jahrhunderts." Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jane Austen (Stahlstich nach einer Skizze ihrer Schwester Cassandra)
Jane Austen
Vernunft und Gefühl
Roman
Aus dem Englischenvon Erika Gröger
Impressum
Titel der Originalausgabe
Sense and Sensibility
ISBN 978-3-8412-0625-1
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, März 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die vorliegende Übersetzung erschien erstmals 1972 bei Aufbau, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung morgen, Kai Dieterich unter Verwendung eines Fotos von Kai Dietrich/bobsairport
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Zweites Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Drittes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
ERSTES BUCH
Erstes Kapitel
Die Dashwoods waren eine alteingesessene Familie in Sussex. Sie hatten ein großes Besitztum und wohnten auf Norland Park inmitten ihrer Ländereien, wo sie seit vielen Generationen ein so achtbares Leben geführt hatten, daß sie im ganzen Bekanntenkreis in hohem Ansehen standen. Der letzte Eigentümer dieses Besitzes war ein Junggeselle, der ein sehr hohes Alter erreichte und viele Jahre seines Lebens hindurch seine Schwester als ständige Gefährtin und Haushälterin bei sich hatte. Doch ihr Tod – sie starb zehn Jahre vor ihm – zog große Veränderungen in seinem Hause nach sich; denn um ihren Verlust zu ersetzen, nahm er die Familie seines Neffen Mr. Henry Dashwood bei sich auf, welcher der rechtmäßige Erbe des Besitzes Norland war und dem er ihn auch zu vermachen gedachte. In der Gesellschaft seines Neffen und seiner Nichte sowie ihrer Kinder verbrachte der alte Herr behaglich seinen Lebensabend. Er schloß sie alle in sein Herz. Die ständige Aufmerksamkeit Mr. und Mrs. Henry Dashwoods gegenüber seinen Wünschen, die nicht etwa bloßem Eigennutz, sondern echter Herzensgüte entsprang, gewährte ihm alle Labsal, die ihm bei seinem Alter noch zuteil werden konnte, und das fröhliche Treiben der Kinder verschönte seine Tage.
Aus erster Ehe hatte Mr. Henry Dashwood einen Sohn, von seiner jetzigen Frau drei Töchter. Der Sohn, ein gesetzter, achtbarer junger Mann, war durch das große Vermögen seiner Mutter, dessen eine Hälfte ihm bei Erlangung der Volljährigkeit zufiel, reichlich versorgt. Überdies hatte er durch seine Ehe, die er bald darauf schloß, seinen Reichtum noch vermehrt. Für ihn war daher das Erbe von Norland nicht so lebenswichtig wie für seine Schwestern; denn deren Vermögen konnte nur klein ausfallen, wenn nicht dadurch etwas hinzukam, daß ihr Vater dieses Besitztum erbte. Ihre Mutter hatte nichts, und ihr Vater verfügte bloß über siebentausend Pfund; denn die verbleibende Hälfte des Vermögens seiner ersten Frau war gleichfalls ihrem Kind vermacht, und er bezog daraus nur eine Lebensrente.
Der alte Herr starb; sein Testament wurde verlesen, und wie fast jedes Testament rief es ebensoviel Enttäuschung wie Freude hervor. Er war weder so ungerecht noch so undankbar, sein Gut einem andern zu hinterlassen als seinem Neffen, doch er hinterließ es ihm unter Bedingungen, die den halben Wert der Erbschaft zunichte machten. Mr. Dashwood hatte sie sich mehr um seiner Frau und seiner Töchter als um seiner selbst und seines Sohnes willen gewünscht; aber sie war seinem Sohn und dessen Sohn – einem Kind von vier Jahren – auf eine Weise sichergestellt, daß ihm selbst keine Möglichkeit blieb, diejenigen zu versorgen, die er am meisten liebte und die auf eine Versorgung, sei es durch eine Hypothek auf das Gut oder durch den Verkauf seiner wertvollen Wälder, am meisten angewiesen waren. Das Ganze war zugunsten dieses Kindes festgelegt, das bei einigen Besuchen mit seinem Vater und seiner Mutter auf Norland das Herz seines Onkels durch reizvolle kleine Eigenheiten, die bei zwei- bis dreijährigen Kindern beileibe nichts Ungewöhnliches sind – mangelnde Sprechfertigkeit, einen ausgeprägten Willen, zahlreiche listige Streiche und viel Lärm –, so sehr für sich eingenommen hatte, daß sie bei ihm mehr ins Gewicht fielen als alle Aufmerksamkeiten, die ihm jahrelang von seiner Nichte und ihren Töchtern erwiesen worden waren. Er wollte sich jedoch keineswegs lieblos zeigen, und so hinterließ er jedem der drei Mädchen eintausend Pfund als Zeichen seiner Zuneigung.
Im ersten Augenblick war Mr. Dashwoods Enttäuschung groß, doch er war von Natur aus heiter und ein Optimist, und er durfte mit Recht hoffen, noch viele Jahre zu leben und, wenn er sparsam lebte, eine ansehnliche Summe aus dem Ertrag eines Besitzes zurückzulegen, der an sich schon groß war und in allernächster Zeit noch vergrößert werden konnte. Aber der Reichtum, der so lange hatte auf sich warten lassen, gehörte ihm nur ein Jahr. Länger überlebte er seinen Onkel nicht, und zehntausend Pfund einschließlich der jüngst hinzugekommenen Legate waren alles, was seiner Witwe und seinen Töchtern verblieb.
Sobald man erkannte, daß er in Lebensgefahr schwebte, schickte man nach seinem Sohn, und ihm legte Mr. Dashwood mit aller Kraft und allem Nachdruck, die er bei seiner Krankheit noch aufbringen konnte, das Wohl seiner Stiefmutter und -schwestern ans Herz.
Mr. John Dashwood hatte kein so empfindsames Gemüt wie die übrigen Mitglieder der Familie, doch eine derartige Bitte in einem derartigen Augenblick ging ihm nahe, und er versprach, alles zu tun, was in seiner Macht stand, um für ihr Auskommen zu sorgen. Eine solche Versicherung beruhigte seinen Vater, und dann hatte Mr. John Dashwood Muße, zu überlegen, wie viel wohl bei gebührender Umsicht in seiner Macht stehen mochte.
Er war kein übel gearteter junger Mann, es sei denn, man hielte ein ziemliches Maß an Kaltherzigkeit und Selbstsucht für üble Art; aber er war im allgemeinen gut angesehen, weil er sich seiner üblichen Pflichten mit Anstand entledigte. Hätte er eine liebenswertere Frau geheiratet, dann wäre aus ihm vielleicht ein noch angesehenerer Mann geworden: vielleicht wäre er sogar selbst liebenswert geworden; denn er war noch sehr jung, als er heiratete, und hatte seine Frau sehr gern. Aber Mrs. Dashwood war ein bloßes Zerrbild seiner selbst – noch engstirniger und selbstsüchtiger.
Als er seinem Vater das Versprechen gab, erwog er innerlich, das Vermögen seiner Schwestern durch ein Geschenk von tausend Pfund für jede zu vergrößern. In diesem Augenblick glaubte er sich wirklich dazu in der Lage. Bei der Aussicht auf jährlich viertausend zusätzlich zu seinem jetzigen Einkommen, neben der verbleibenden Hälfte des Vermögens seiner Mutter, wurde ihm warm ums Herz, und er hatte das Gefühl, freigebig sein zu können. Jawohl, er würde ihnen dreitausend Pfund geben – das wäre großzügig und anständig von ihm! Damit könnten sie reichlich auskommen. Dreitausend Pfund! Eine beträchtliche Summe, die er ohne große Schwierigkeit erübrigen könnte. Den ganzen Tag dachte er darüber nach, und noch eine Reihe von Tagen, und bereute seinen Vorsatz nicht.
Kaum war sein Vater beerdigt, da traf Mrs. John Dashwood, ohne ihre Schwiegermutter von ihrer Absicht zu benachrichtigen, mit ihrem Kind und ihren Bediensteten ein. Niemand konnte ihr Recht zu kommen bestreiten: das Haus gehörte ihrem Mann von dem Augenblick an, da sein Vater verschieden war; die Taktlosigkeit ihres Benehmens aber war um so größer und mußte auf eine Frau in Mrs. Dashwoods Lage, selbst wenn sie nur normal empfand, höchst abstoßend wirken; in ihrem Innern jedoch lebten ein so ausgeprägtes Ehrgefühl, eine so romantische Seelengröße, daß eine derartige Kränkung, wer immer sie begangen oder erfahren haben mochte, für sie eine Quelle unüberwindlicher Abneigung war. Mrs. John Dashwood war bei keinem aus der Familie ihres Mannes je besonders beliebt gewesen, aber bisher hatte sie noch nie Gelegenheit gehabt, zu zeigen, mit welcher Rücksichtslosigkeit gegenüber den Gefühlen anderer Menschen sie handeln konnte, falls es die Umstände geraten erscheinen ließen.
Als so kränkend empfand Mrs. Dashwood dieses schroffe Benehmen und so heftig verachtete sie deshalb ihre Schwiegertochter, daß sie bei deren Ankunft das Haus für immer verlassen hätte, wäre sie nicht durch die dringenden Bitten ihrer ältesten Tochter veranlaßt worden, erst zu bedenken, ob es auch schicklich sei; und ihre zärtliche Liebe zu ihren drei Kindern bestimmte sie hernach, zu bleiben und um ihretwillen einen Bruch mit ihrem Stiefsohn zu vermeiden.
Elinor, die älteste Tochter, deren Ratschlag so wirksam gewesen war, besaß eine Verstandeskraft und eine Nüchternheit des Urteils, die sie befähigten, trotz ihrer neunzehn Jahre bereits die Ratgeberin ihrer Mutter zu sein, und sie häufig in die Lage versetzten, zu ihrer aller Wohl der überschwenglichen Gemütsart Mrs. Dashwoods entgegenzuwirken, die doch meist zu Unbesonnenheiten führen mußte. Sie besaß ein vortreffliches Wesen – ihr Herz war zärtlich, und ihre Gefühle waren stark, doch sie wußte sie zu beherrschen; das war etwas, was ihre Mutter noch lernen mußte und was die eine ihrer Schwestern nie zu lernen entschlossen war.
Mariannes Fähigkeiten entsprachen in vieler Hinsicht durchaus denen Elinors. Sie war verständig und intelligent, doch in allem überschwenglich: ihr Kummer, ihre Freude kannten kein Maß. Sie war hochherzig, liebenswert, anziehend – sie war alles, nur nicht besonnen. Die Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrer Mutter war verblüffend.
Elinor sah das Übermaß der Empfindsamkeit ihrer Schwester mit Besorgnis, Mrs. Dashwood aber schätzte und förderte es noch. Jetzt bestärkten beide einander in ihrem bitteren Weh. Der heftige Schmerz, der sie im ersten Augenblick überwältigt hatte, wurde aus freiem Entschluß erneuert, herbeigesehnt, ständig neu erzeugt. Sie gaben sich ganz ihrem Kummer hin, suchten ihr Leid mit jedem geeigneten Gedanken zu vertiefen und waren fest entschlossen, sich nie wieder trösten zu lassen. Auch Elinor war tief betrübt, aber sie war dennoch imstande, zu kämpfen, sich zu bemühen. Sie war imstande, sich mit ihrem Bruder zu beraten, ihre Schwägerin bei ihrer Ankunft zu empfangen und mit der gebührenden Aufmerksamkeit zu behandeln und ihre Mutter zu gleichen Bemühungen aufzurütteln und zu gleicher Nachsicht zu bewegen.
Margaret, die andere Schwester, war ein gutmütiges, freundliches Mädchen, doch da sie bereits einen beträchtlichen Teil von Mariannes romantischen Vorstellungen in sich aufgenommen hatte, ohne indes Mariannes Verstand zu besitzen, erweckte sie mit ihren dreizehn Jahren nicht den Eindruck, daß sie in einem späteren Lebensalter ihren Schwestern gleichen würde.
Zweites Kapitel
Mrs. John Dashwood richtete sich jetzt als Herrin von Norland ein, und ihre Schwiegermutter und ihre Schwägerinnen wurden zu Besuchern degradiert. Als solche jedoch wurden sie von ihr mit gelassener Höflichkeit behandelt und von ihrem Mann mit so viel Freundlichkeit, wie er für jemand anders als sich selbst, seine Frau und sein Kind aufbringen konnte. Er nötigte sie sogar – nicht ohne einigen Eifer –, Norland als ihr Heim zu betrachten, und da sich Mrs. Dashwood nichts Besseres bot, als zu bleiben, bis sie in einem Haus in der Nähe unterkommen könnte, nahm sie seine Einladung an.
An einem Ort zu verweilen, wo alles sie an einstige Freuden erinnerte, war genau das richtige für ihr Gemüt. In heiterer Laune konnte niemand heiterer sein als sie oder ein höheres Maß an schwärmerischer Vorfreude auf das Glück empfinden, die allein schon Glück ist. Im Kummer aber erlag sie in gleicher Weise ihrer Stimmung und ließ sich dann ebensowenig trösten wie in der Freude zügeln.
Mrs. John Dashwood war ganz und gar nicht damit einverstanden, was ihr Mann für seine Schwestern zu tun gedachte. Dreitausend Pfund von dem Vermögen ihres lieben Kleinen wegzugeben hieße ja, ihn ganz entsetzlich in Armut zu stürzen. Sie bat ihn, die Sache doch noch einmal zu bedenken. Wie könnte er es vor sich selbst verantworten, sein Kind, und noch dazu sein einziges Kind, einer so großen Summe zu berauben? Und welches Recht hätten die Misses Dashwood, die doch nur halbe Blutsverwandte von ihm seien, was sie überhaupt nicht als Verwandtschaft betrachte, von seiner Großmut eine so beträchtliche Summe zu erwarten? Bekanntlich gebe es zwischen Kindern aus verschiedenen Ehen eines Mannes keinerlei Zuneigung, und wieso wolle er da sich selbst und ihren lieben kleinen Harry dadurch ruinieren, daß er sein ganzes Geld an seine Halbschwestern wegschenkte?
»Es war der letzte Wunsch meines Vaters«, erwiderte ihr Mann, »daß ich seine Witwe und seine Töchter unterstützen sollte.«
»Wahrscheinlich wußte er gar nicht mehr, was er sprach; ich möchte wetten, er war schon nicht mehr ganz richtig im Kopf. Wäre er noch bei klarem Verstand gewesen, dann wäre er nicht auf den Einfall gekommen, dich zu bitten, das halbe Vermögen deines Kindes wegzuschenken.«
»Er nannte keine bestimmte Summe, meine liebe Fanny; er bat mich bloß ganz allgemein, sie zu unterstützen und ihre Situation angenehmer zu gestalten, als es ihm selbst möglich war. Vielleicht wäre es richtig gewesen, wenn er das völlig mir überlassen hätte. Er konnte ja wohl kaum annehmen, daß ich nicht für sie sorgen würde. Aber da er mir das Versprechen abverlangte, blieb mir nichts weiter übrig, als es ihm zu geben – wenigstens glaubte ich das in dem Augenblick. Ich habe ihm also mein Versprechen gegeben und muß es auch halten. Etwas muß man für sie tun, wenn sie Norland verlassen und sich ein neues Heim einrichten.«
»Na, dann wird man eben etwas für sie tun; aber dieses Etwas müssen ja nicht gleich dreitausend Pfund sein. Überlege doch mal«, fügte sie hinzu, »ist das Geld erst fort, kommt es nie wieder. Deine Schwestern werden heiraten, und dann ist es für immer dahin. Ja, wenn es eines Tages wieder unserem armen Kleinen zufallen würde …«
»Allerdings«, sagte ihr Mann sehr ernst, »das wäre freilich etwas ganz anderes. Es kann einmal eine Zeit kommen, wo es Harry leid tun wird, daß wir eine so bedeutende Summe weggegeben haben. Wenn er zum Beispiel später eine große Familie hat, wäre das Geld ein sehr angenehmer Zuschuß.«
»Und ob.«
»Dann wäre es vielleicht für alle Beteiligten besser, wenn die Summe um die Hälfte verringert würde. Fünfhundert Pfund wären doch eine gewaltige Erhöhung ihres Vermögens!«
»Oh, eine ganz ungeheure Erhöhung! Finde erst mal einen Bruder auf der Welt, der auch nur halb soviel für seine Schwestern täte, selbst wenn es seine richtigen Schwestern wären! Und unter diesen Umständen – bloß Halbverwandte! – Aber du hast ja einen so großzügigen Charakter!«
»Ich möchte mich keinesfalls schäbig benehmen«, erwiderte er. »Bei solchen Anlässen tut man lieber zuviel als zuwenig. Zumindest kann mir dann niemand nachsagen, ich hätte nicht genug für sie getan – nicht einmal sie selbst können mehr erwarten.«
»Niemand weiß, was sie erwarten«, sagte seine Frau, »aber wir können uns sowieso nicht nach ihren Erwartungen richten, sondern es geht allein darum, wieviel du dir leisten kannst, wegzugeben.«
»Gewiß, und ich denke, ich werde es mir leisten können, jeder fünfhundert Pfund zu geben. Schon so, ohne daß ich etwas dazulege, werden sie nach dem Tode ihrer Mutter jede über mehr als dreitausend Pfund verfügen – für ein junges Mädchen ein sehr stattliches Vermögen.«
»Das ist es in der Tat, und eigentlich finde ich, daß sie überhaupt keinen Zuschuß brauchen. Sie werden sich einmal zehntausend Pfund teilen können. Wenn sie heiraten, dann sind sie versorgt oder stehen sich sogar gut, und wenn sie nicht heiraten, dann können sie mit den Zinsen von zehntausend Pfund alle zusammen sehr angenehm leben.«
»Sehr richtig, und deshalb frage ich mich auch, ob es nach alledem nicht ratsamer wäre, statt für sie lieber etwas für ihre Mutter zu tun, solange sie noch lebt – ich denke zum Beispiel an eine Art Rente. Das würde meinen Schwestern ebenso zugute kommen wie ihr. Von hundert Pfund im Jahr könnten sie alle sehr angenehm leben.«
Seine Frau hatte jedoch einige Bedenken, diesem Plan zuzustimmen.
»Allerdings«, sagte sie, »es ist jedenfalls besser, als fünfzehnhundert Pfund auf einmal wegzugeben. Aber laß andererseits Mrs. Dashwood noch fünfzehn Jahre leben, dann sind wir ganz schön hereingefallen.«
»Noch fünfzehn Jahre? Meine liebe Fanny, sie wird nicht mehr halb so lange leben!«
»Sicher nicht; aber das wird dir auch schon aufgefallen sein: Leute, denen eine Rente gezahlt wird, leben ewig, und sie ist sehr kräftig und gesund und kaum vierzig. Eine Rente ist eine sehr ernste Angelegenheit: jedes Jahr erscheint sie von neuem, und man wird sie nie wieder los. Du ahnst nicht, auf was du dich da einläßt. Mit Renten habe ich schon große Scherereien erlebt; denn meine Mutter war gezwungen, drei auf einmal zu zahlen, die ihr mein Vater durch sein Testament aufgebürdet hatte – an alte, ausgediente Domestiken, und es ist kaum zu glauben, was ihr das für Unannehmlichkeiten bereitete. Zweimal im Jahr mußten diese Renten gezahlt werden, und dann die Umstände, den Leuten das Geld zuzustellen, und dann hieß es, einer von ihnen sei gestorben, und hinterher stellte sich heraus, daß es gar nicht an dem war. Meiner Mutter hing das Ganze zum Halse heraus. Ihre Einkünfte gehörten ihr ja gar nicht, sagte sie, wenn diese ewigen Ansprüche darauf lasteten, und es war um so herzloser von meinem Vater, als meine Mutter andernfalls frei hätte über das Geld verfügen können, ohne jede Einschränkung. Das hat in mir eine derartige Abneigung gegen Renten entwickelt, daß ich mich um nichts in der Welt darauf festnageln lassen würde, jemandem eine zu zahlen.«
»Es ist bestimmt sehr unangenehm«, erwiderte Mr. Dashwood, »wenn einem jedes Jahr die Einkünfte auf diese Weise beschnitten werden. Man ist nicht mehr Herr seines Vermögens, wie deine Mutter sehr richtig sagt. Auf die regelmäßige Zahlung einer solchen Summe an jedem Fälligkeitstag festgelegt zu sein ist alles andere als wünschenswert: man verliert dadurch seine Unabhängigkeit.«
»Zweifellos, und außerdem dankt es dir auch keiner. Sie betrachten sich als gesichert; du tust bloß das, was man von dir erwartet, und das erweckt keinerlei Dankbarkeit. Ich an deiner Stelle würde alles, was ich für sie tue, von meinem eigenen Ermessen abhängig machen. Zu einem jährlichen Unterhalt würde ich mich nicht verpflichten. Manches Jahr kann es uns sehr ungelegen kommen, hundert oder auch bloß fünfzig Pfund von unsern eigenen Ausgaben einsparen zu müssen.«
»Ich glaube, du hast recht, meine Liebe; es ist also besser, wir sehen keine Jahresrente für sie vor. Wenn ich ihnen gelegentlich etwas gebe, dann ist ihnen damit weit mehr gedient als mit einer jährlichen Unterhaltssumme, denn sie würden doch bloß größeren Aufwand treiben, wenn sie sich eines höheren Einkommens sicher wüßten, und am Jahresende wären sie um keinen Penny reicher. Bestimmt ist das die beste Lösung. Ein gelegentliches Geschenk von fünfzig Pfund wird verhindern, daß sie jemals in Geldverlegenheit kommen, und ich denke, damit erfülle ich großzügig das Versprechen, das ich meinem Vater gegeben habe.«
»Natürlich. Zudem bin ich, offen gestanden, innerlich überzeugt, daß dein Vater gar nicht die Absicht hatte, ihnen Geld zu geben. Er hat dabei doch wohl nur an solche Unterstützung gedacht, wie man sie vernünftigerweise von dir erwarten kann – zum Beispiel, daß du dich nach einem gemütlichen kleinen Haus für sie umsiehst, ihnen beim Umzug hilfst und ihnen Fische und Wild und dergleichen schickst, wenn gerade die Jahreszeit danach ist. Ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, daß er nicht mehr damit gemeint hat; es wäre ja auch sehr seltsam und unvernünftig von ihm gewesen. Überlege doch nur mal, mein lieber Dashwood, wie außerordentlich angenehm deine Stiefmutter und ihre Töchter von den Zinsen der siebentausend Pfund leben können, ganz abgesehen von den tausend Pfund, die jedes der Mädchen besitzt und die ihnen pro Kopf fünfzig Pfund im Jahr bringen, und natürlich werden sie ihrer Mutter davon Kostgeld geben. Alles in allem werden sie fünfhundert im Jahr für sich haben, und was in aller Welt könnten sich vier Frauen mehr wünschen? – Sie werden ja so billig leben! Ihre Haushaltung wird rein gar nichts kosten. Sie werden keine Kutsche, keine Pferde und kaum Personal haben; sie werden keine Gesellschaften geben und können überhaupt keine Ausgaben haben! Denk doch bloß, wie gut sie es haben werden! Fünfhundert Pfund im Jahr! Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie auch nur die Hälfte davon verbrauchen wollen, und daß du ihnen noch was dazuschenken willst, ist eine völlig absurde Idee! Viel eher werden sie in der Lage sein, dir etwas abzugeben.«
»Auf mein Wort«, sagte Mr. Dashwood, »ich glaube, du hast völlig recht. Mein Vater kann bestimmt nichts weiter mit seiner Bitte gemeint haben, als was du sagst. Jetzt ist mir alles klar, und ich werde mich genau an meine Verpflichtung halten und ihnen die Unterstützung und die Wohltaten angedeihen lassen, die du mir geschildert hast. Wenn meine Mutter in ein anderes Haus zieht, will ich ihr bei ihrer Einrichtung gern behilflich sein, soweit ich dazu in der Lage bin. Ein paar Möbelstücke wären dann vielleicht ein passendes Geschenk.«
»Gewiß«, erwiderte Mrs. John Dashwood. »Eins mußt du dabei allerdings bedenken. Als dein Vater und deine Mutter nach Norland zogen, verkauften sie zwar das Mobiliar von Stanhill, aber das ganze Porzellan, das Tafelgeschirr und die Wäsche behielten sie, und das alles fällt jetzt deiner Mutter zu. Deshalb wird ihr Haus bereits nahezu komplett eingerichtet sein, wenn sie es übernimmt.«
»Das ist zweifellos ein wichtiger Punkt, den wir bedenken sollten. Ein wertvolles Legat, das kann man wohl sagen! Und dabei wäre einiges von dem Tafelgeschirr unserem eigenen Bestand hier gut zustatten gekommen.«
»Ja, und das Frühstücksservice ist noch mal so schön wie das, was zu diesem Haus gehört. Meiner Ansicht nach viel zu schön für jede Wohnung, die sie sich je werden leisten können. Aber so ist es nun mal. Dein Vater hat ja bloß an sie gedacht. Und eins muß ich dir sagen: du hast keine Veranlassung, ihm besonders dankbar zu sein oder dich in übertriebenem Maße um seine Wünsche zu kümmern; denn das wissen wir doch: wenn er gekonnt hätte, dann hätte er so gut wie alles auf der Welt ihnen hinterlassen.«
Dieses Argument war zwingend. Es verlieh seinen Vorsätzen die Entschiedenheit, die noch gefehlt hatte, und so gelangte er denn endlich zu der Ansicht, daß es absolut unnötig, wenn nicht sogar unpassend wäre, für die Witwe und die Kinder seines Vaters mehr zu tun als jene Akte der Nächstenliebe, die ihm seine Frau vorschlug.
Drittes Kapitel
Mrs. Dashwood blieb noch mehrere Monate in Norland, doch nicht etwa, weil sie einem Umzug abgeneigt gewesen wäre, da nun nicht mehr jeder wohlbekannte Platz einen Sturm von Gefühlen in ihr auslöste wie in der ersten Zeit. Vielmehr brannte sie darauf, fortzukommen, sobald sie neuen Lebensmut schöpfte und sich wieder in der Lage fühlte, etwas anderes zu tun, als ihr Leid durch wehmütige Erinnerungen zu vergrößern, und suchte unermüdlich nach einem passenden Haus in der Umgebung von Norland; denn weit von jenem geliebten Ort wegzuziehen war unvorstellbar für sie. Aber es fand sich nichts Geeignetes, was sowohl ihren Vorstellungen von Komfort und Behaglichkeit als auch der Umsicht ihrer ältesten Tochter entsprochen hätte, welche auf Grund ihres sichereren Urteilsvermögens mehrere Häuser als für ihr Einkommen zu groß ablehnte, die ihrer Mutter recht gewesen wären.
Mrs. Dashwood hatte durch ihren Mann von dem feierlichen Versprechen seines Sohnes erfahren, das seine letzten irdischen Gedanken mit Trost erfüllte. An der Aufrichtigkeit dieser Versicherung zweifelte sie ebensowenig, wie er selbst es getan hatte, und im Hinblick auf ihre Töchter fühlte sie sich dadurch beruhigt; was dagegen sie selbst betraf, so glaubte sie auch von einer weit kleineren Hinterlassenschaft als siebentausend Pfund im Überfluß leben zu können. Auch um ihres Stiefsohns willen, um seines guten Herzens willen, freute sie sich, und sie machte sich Vorwürfe, daß sie ihn bisher verkannt und für edler Regungen unfähig gehalten hatte. Sein zuvorkommendes Benehmen ihr und seinen Schwestern gegenüber gab ihr die Gewißheit, daß ihm an ihrer aller Wohlergehen gelegen sei, und lange Zeit vertraute sie fest auf die Großmut seiner Absichten.
Die Verachtung, die sie schon seit Beginn ihrer Bekanntschaft für ihre Schwiegertochter empfunden hatte, steigerte sich noch beträchtlich, als sie deren Charakter im Laufe von sechs Monaten engen Zusammenlebens näher kennenlernte; und vielleicht hätten es die beiden Damen trotz aller höflichen Rücksichtnahme oder mütterlichen Gefühle der ersteren nicht so lange unter einem Dach miteinander ausgehalten, wäre nicht ein besonderer Umstand eingetreten, der Mrs. Dashwood den weiteren Aufenthalt ihrer Töchter auf Norland unbedingt wünschenswert erscheinen ließ.
Dieser Umstand war eine aufkeimende Zuneigung zwischen ihrer ältesten Tochter und Mrs. John Dashwoods Bruder, einem wohlerzogenen, angenehmen jungen Mann, der bei ihnen eingeführt worden war, kurz nachdem sich seine Schwester auf Norland niedergelassen hatte, und seither den größten Teil seiner Zeit dort verbrachte.
Manche Mütter hätten dieses Verhältnis vielleicht aus Gründen des Eigennutzes gefördert, denn Edward Ferrars war der älteste Sohn eines Mannes, der sehr reich gestorben war, und manche hätten es vielleicht aus Gründen der Klugheit unterbunden, denn bis auf eine unbedeutende Summe hing sein ganzes Vermögen vom Testament seiner Mutter ab. Mrs. Dashwood aber war von beiden Erwägungen gleichermaßen unbeeinflußt. Es genügte ihr, daß er liebenswürdig war, daß er ihre Tochter liebte und daß Elinor seine Zuneigung erwiderte. Es stand im Gegensatz zu allen ihren Überzeugungen, daß Vermögensunterschiede Liebende trennen sollten, wenn sie sich auf Grund gleicher Neigungen zueinander hingezogen fühlten; und daß jemand, der Elinor kannte, ihre guten Eigenschaften nicht zu würdigen wissen sollte, überstieg ihr Vorstellungsvermögen.
Edward Ferrars empfahl sich der Wertschätzung der Damen nicht durch besondere Vorzüge in Erscheinung oder Auftreten. Er war kein schöner Mann, und seine Umgangsformen gewannen erst bei näherer Bekanntschaft. Er war zu scheu, um selbstbewußt zu sein, aber sobald er seine angeborene Schüchternheit überwunden hatte, zeugte sein ganzes Verhalten von einem aufrichtigen und gütigen Herzen. Seine geistigen Anlagen waren gut, und eine gediegene Erziehung hatte sie erfreulich gefördert. Doch weder seine Fähigkeiten noch seine Neigungen setzten ihn in den Stand, den Wünschen seiner Mutter und seiner Schwester zu entsprechen, die es gern gesehen hätten, wenn er sich irgendwie ausgezeichnet hätte – in welcher Hinsicht, wußten sie selbst nicht recht. Sie wollten, daß er in der Welt auf die eine oder andere Weise etwas darstellen solle. Seine Mutter wünschte ihn für politische Belange zu interessieren, um ihn ins Parlament zu bekommen oder ihn auf vertrautem Fuß mit einigen bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit zu sehen. Mrs. John Dashwood wünschte das gleiche; doch bis eines dieser höheren Ziele erreichbar wäre, hätte es ihren Ehrgeiz vorerst schon gestillt, wenn ihr Bruder einen Landauer gefahren hätte. Aber Edward lag weder etwas an bedeutenden Persönlichkeiten noch an Landauern. All seine Wünsche drehten sich um häusliche Behaglichkeit und ein geruhsames Leben als Privatmann. Zum Glück hatte er einen jüngeren Bruder, aus dem mehr zu werden versprach.
Edward hatte schon mehrere Wochen im Hause zugebracht, ohne daß ihm Mrs. Dashwood viel Beachtung geschenkt hätte; denn während dieser Zeit war sie in so tiefer Trauer versunken, daß ihr ihre Umgebung gleichgültig war. Sie bemerkte nur, daß Edward ruhig und unaufdringlich war, und das gefiel ihr an ihm. Er störte ihren seelischen Schmerz nicht mit Gesprächen im ungeeigneten Augenblick. Der erste Anlaß, ihn sich genauer anzusehen und weiteren Gefallen an ihm zu finden, ergab sich, als Elinor eines Tages zufällig eine Bemerkung darüber machte, wie sehr er sich doch von seiner Schwester unterscheide. Es war dies ein Gegensatz, der ihn ihrer Mutter wärmstens empfahl.
»Das genügt«, sagte sie. »Wenn du sagst, daß er sich sehr von Fanny unterscheidet, so genügt das. Es bedeutet alles, was an einem Menschen liebenswert ist. Ich liebe ihn bereits.«
»Ich glaube, er wird dir gefallen, wenn du ihn besser kennenlernst«, sagte Elinor.
»Gefallen!« erwiderte ihre Mutter lächelnd. »Ich kenne kein Gefühl der Sympathie, das weniger wäre als Liebe.«
»Du wirst ihn vielleicht schätzen.«
»Für mich sind Wertschätzung und Liebe immer untrennbar gewesen.«
Mrs. Dashwood bemühte sich jetzt, näher mit ihm bekannt zu werden. Sie hatte gewinnende Umgangsformen und besiegte bald seine Zurückhaltung. Schnell gewahrte sie all seine Vorzüge; die Gewißheit, daß er sich für Elinor interessiere, half dabei vielleicht ihrem Scharfblick, aber sie war wirklich von seinem Wert überzeugt, und selbst seine stille Art, die all ihren Vorstellungen vom Auftreten eines jungen Mannes widersprach, kam ihr nun nicht mehr langweilig vor, da sie sein warmes Herz und sein zärtliches Gemüt erkannt hatte.
Kaum hatte sie in seinem Verhalten gegenüber Elinor Anzeichen von Liebe bemerkt, da hielt sie eine ernste Zuneigung zwischen den beiden für erwiesen und machte sich Hoffnungen auf eine nahe bevorstehende Heirat.
»Meine liebe Marianne«, sagte sie, »in ein paar Monaten wird Elinor aller Wahrscheinlichkeit nach den Bund fürs Leben schließen. Wir werden sie vermissen, aber sie wird glücklich sein.«
»Ach, Mama, was fangen wir bloß ohne sie an?«
»Meine Liebe, es wird ja eigentlich gar keine Trennung sein. Wir werden bloß ein paar Meilen voneinander entfernt wohnen und uns jeden Tag sehen. Du wirst einen Bruder gewinnen, einen richtigen, zärtlichen Bruder. Ich habe von Edwards Herz die allerbeste Meinung. Aber du machst so ein ernstes Gesicht, Marianne, bist du mit der Wahl deiner Schwester nicht einverstanden?«
»Vielleicht bin ich davon ein wenig überrascht«, sagte Marianne. »Edward ist ja sehr nett, und ich hab ihn furchtbar gern. Aber trotzdem – er ist nicht so, wie man sich einen jungen Mann vorstellt – irgend etwas fehlt – äußerlich macht er keinen besonderen Eindruck, und er hat nichts von dem Charme an sich, den ich bei einem Mann erwarten würde, der meine Schwester ernstlich zu fesseln vermag. Seinen Augen fehlt all die Lebhaftigkeit, all das Feuer, das zugleich Tugend und Intelligenz verrät. Und außerdem fürchte ich, Mama, daß er keinen wirklich guten Geschmack hat. Aus Musik scheint er sich kaum etwas zu machen, und wenn er Elinors Zeichnungen auch sehr bewundert, so ist es doch nicht die Bewunderung eines Menschen, der ihren Wert zu schätzen weiß. Er sieht ihr zwar häufig zu, wenn sie zeichnet, aber es ist klar, daß er in Wirklichkeit nicht das geringste von der Sache versteht. Er bewundert als Verehrer, nicht als Kenner. Um mich zu befriedigen, müßten diese beiden Eigenschaften miteinander vereint vorhanden sein. Ich könnte nicht mit einem Mann glücklich werden, dessen Geschmack nicht in jedem Punkt mit meinem eigenen übereinstimmt. Er muß sich in all meine Gefühle hineinversetzen können; dieselben Bücher, dieselben Musikstücke müssen uns beide entzücken. Ach, Mama, wie schwunglos, wie langweilig Edward gestern abend war, als er uns vorlas! Meine Schwester tat mir ja so leid! Aber sie ließ es so gefaßt über sich ergehen, sie schien es kaum zu bemerken. Ich hielt es nur mit Mühe auf meinem Platz aus. Diese schönen Verse, die mich schon oft an den Rand hemmungsloser Schwärmerei gebracht haben, mit so unerschütterlicher Ruhe, so schrecklicher Gleichgültigkeit heruntergeleiert zu hören!«
»Sicher wäre er mit einfacher, gefälliger Prosa besser zurechtgekommen. Das dachte ich mir gleich, aber du mußtest ihm ja unbedingt Cowper geben.«
»Na, Mama, wenn ihn nicht einmal Cowper beflügelt! – Aber über Geschmack läßt sich eben streiten. Elinor empfindet nicht so wie ich, und deshalb sieht sie vielleicht darüber hinweg und wird mit ihm glücklich. Aber wenn ich ihn liebte, mir hätte es das Herz gebrochen, ihn mit so wenig Gefühl lesen zu hören. Mama, je mehr ich die Welt kennenlerne, desto fester bin ich davon überzeugt, daß ich nie einen Mann finden werde, den ich wirklich lieben kann. Ich erwarte zuviel! Er muß alle Tugenden Edwards haben, und sein Äußeres und seine Manieren müssen seinem guten Charakter obendrein allen erdenklichen Charme verleihen.«
»Vergiß nicht, meine Liebe, daß du noch keine siebzehn bist. Noch ist es viel zu früh, um an einem solchen Glück zu zweifeln. Warum sollte das Schicksal es mit dir weniger gut meinen als mit deiner Mutter? Nur in einer Hinsicht, meine Marianne, möge es dir besser ergehen als ihr!«
Viertes Kapitel
»Wie schade, Elinor«, sagte Marianne, »daß Edward keinen Geschmack am Zeichnen findet!«
»Keinen Geschmack am Zeichnen?« fragte Elinor. »Wie kommst du darauf? Er zeichnet zwar nicht selbst, aber er sieht sich die Arbeiten anderer sehr gern an, und ich kann dir versichern, daß es ihm keineswegs an natürlichem Geschmack fehlt, wenn er auch keine Gelegenheit hatte, ihn zu bilden. Hätte er sich je damit befaßt, ich glaube, er hätte sehr gut gezeichnet. Er mißtraut seinem eigenen Urteil in derartigen Fragen so sehr, daß er nur ungern seine Meinung über irgendein Bild äußert, aber er hat von Natur aus einen sicheren und schlichten Geschmack, der ihn im allgemeinen völlig richtig leitet.«
Marianne wollte ihr nicht zu nahe treten und sagte nichts mehr zu diesem Thema; aber das Wohlgefallen, das nach Elinors Schilderung die Zeichnungen anderer in ihm erweckten, ließ sich bei weitem nicht mit jenem überschwenglichen Entzücken vergleichen, das man nach ihrer Auffassung allein als guten Geschmack bezeichnen konnte. So lächelte sie zwar innerlich über den Irrtum, doch hielt sie ihrer Schwester die blinde Eingenommenheit für Edward zugute, der er zuzuschreiben war.
»Du denkst doch hoffentlich nicht, Marianne«, fuhr Elinor fort, »daß es ihm an Geschmack schlechthin fehlt. Das kann doch wohl nicht der Fall sein, denn dein Verhalten gegen ihn ist ausgesprochen herzlich, und wenn das deine Meinung wäre, dann würdest du es doch bestimmt nicht fertigbringen, höflich zu ihm zu sein.«
Marianne wußte nicht recht, was sie erwidern sollte. Auf keinen Fall wollte sie die Gefühle ihrer Schwester verletzen, doch etwas zu sagen, was sie nicht glaubte, war ihr unmöglich. Endlich antwortete sie: »Sei nicht gekränkt, Elinor, wenn mein Lob nicht in jeder Hinsicht dem Eindruck entspricht, den du von Edwards Vorzügen hast. Ich hatte nicht so oft Gelegenheit wie du, die feineren Regungen seines Geistes, seine Neigungen und Interessen schätzen zu lernen, aber von seiner Güte und seinem gesunden Menschenverstand habe ich die allerhöchste Meinung. Ich finde ihn in jeder Hinsicht achtbar und liebenswert.«
»Ich bin überzeugt«, erwiderte Elinor lächelnd, »daß auch seine besten Freunde mit einer solchen Lobrede nicht unzufrieden sein könnten. Ich wüßte nicht, wie du dich hättest warmherziger für ihn aussprechen sollen.«
Marianne war froh, daß sich ihre Schwester so leicht hatte beschwichtigen lassen.
»An seiner Intelligenz und an seiner Güte«, fuhr Elinor fort, »kann meines Erachtens niemand zweifeln, der ihn gut genug kennt, um sich ungezwungen mit ihm zu unterhalten. Seine trefflichen Gedanken und Grundsätze kommen nur wegen seiner Schüchternheit, die ihn allzuoft schweigen läßt, nicht immer zum Vorschein. Du kennst ihn gut genug, um dir von seinem soliden Charakter ein rechtes Bild machen zu können. Was aber seine feineren Regungen betrifft, wie du es nennst, so sind sie dir auf Grund besonderer Umstände verborgener geblieben als mir. Wir sind zeitweise häufiger miteinander in Berührung gekommen, während du aus den zärtlichsten Motiven ganz von unserer Mutter in Anspruch genommen wurdest. Ich bin oft mit ihm zusammen gewesen, habe seine Gefühle erforscht und seine Ansichten über literarische und geschmackliche Fragen erfahren; und im großen ganzen möchte ich behaupten, daß er ein reiches Wissen besitzt, außerordentlich gern Bücher liest, eine lebhafte Phantasie hat, scharf und genau beobachtet und über einen feinen, unverdorbenen Geschmack verfügt. Seine Fähigkeiten gewinnen in jeder Hinsicht bei näherer Bekanntschaft ebenso wie sein Benehmen und seine Person. Auf den ersten Blick wirkt er sicher nicht beeindruckend, und sein Äußeres wird man kaum als schön bezeichnen, bis man bemerkt, wie ungewöhnlich gütig sein Blick und wie überaus freundlich seine Miene ist. Mittlerweile habe ich ihn so gut kennengelernt, daß ich ihn wirklich schön finde, oder doch wenigstens beinahe. Was meinst du, Marianne?«
»Ich werde ihn sehr bald schön finden, Elinor, auch wenn ich es jetzt noch nicht tue. Sowie du mir sagst, daß ich ihn als Bruder lieben soll, werde ich in seinem Gesicht nicht mehr Unvollkommenheit erblicken als jetzt in seinem Herzen.«
Elinor zuckte bei dieser Erklärung zusammen und bedauerte den Eifer, zu dem sie sich hatte hinreißen lassen, als sie von ihm sprach. Sie fühlte, daß sie sehr von Edward eingenommen war. Diese Sympathie hielt sie für wechselseitig; doch erst mußte sie sich der Sache sicherer sein, ehe es ihr angenehm sein würde, daß Marianne so fest an diese gegenseitige Zuneigung glaubte. Sie wußte, Marianne und ihre Mutter brauchten bloß einen Augenblick lang etwas zu vermuten, um im nächsten schon daran zu glauben – etwas zu wünschen hieß bei ihnen, es zu erhoffen, und es zu erhoffen hieß, fest damit zu rechnen. Sie versuchte ihrer Schwester zu erklären, wie die Dinge wirklich lagen.
»Ich will keineswegs abstreiten«, sagte sie, »daß ich eine sehr hohe Meinung von ihm habe – daß ich ihn sehr schätze, daß ich ihn mag.«
Marianne sprudelte über vor Entrüstung. »›Ihn schätze! Ihn mag!‹ Kaltherzige Elinor! Ach, schlimmer noch als kaltherzig! Schämt sich, anders zu sein! Gebrauche noch einmal diese Worte, und ich verlasse augenblicklich das Zimmer.«
Elinor mußte lachen. »Entschuldige«, sagte sie, »und laß dir versichern, daß ich dich nicht verletzen wollte, als ich so ruhig über meine eigenen Gefühle sprach. Du darfst sie für stärker halten, als ich sie zum Ausdruck gebracht habe; kurz gesagt, du darfst sie für so stark halten, wie seine Vorzüge und meine Annahme – meine Hoffnung, daß er etwas für mich empfindet, es ohne Unbesonnenheit und Torheit rechtfertigen. Aber mehr darfst du dir unter ihnen nicht vorstellen. Ich bin mir seiner Zuneigung keineswegs sicher. Es gibt Augenblicke, da erscheint mir ihr Ausmaß zweifelhaft; und solange er seine Gefühle nicht offenbart hat, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn ich es vermeide, mich in meinem eigenen Gefühl noch dadurch zu bestärken, daß ich es für mehr halte oder für mehr ausgebe, als es ist. Im Herzen hege ich wenig, ja, eigentlich gar keinen Zweifel an seiner Sympathie. Aber es gibt noch andere Punkte zu berücksichtigen als seine Neigung. Er ist weit davon entfernt, selbständig zu sein. Was für ein Mensch seine Mutter wirklich ist, können wir nicht wissen, doch nach dem, was Fanny gelegentlich über ihr Verhalten und ihre Ansichten äußerte, stellen wir sie uns nicht gerade liebenswürdig vor; und wenn ich mich nicht sehr irre, so ist sich Edward selbst darüber im klaren, daß ihm vieles im Wege stehen würde, falls es sein Wunsch wäre, eine Frau zu heiraten, die weder ein großes Vermögen noch einen hohen Rang mitbringt.«
Marianne wunderte sich, wie weit ihre Mutter und sie selbst in ihrer Phantasie die Wirklichkeit überflügelt hatten.
»Also bist du tatsächlich noch nicht mit ihm verlobt!« sagte sie. »Aber es wird sicher bald soweit sein. Diese Verzögerung hat allerdings auch ihre Vorteile. Erstens werde ich dich nicht so schnell verlieren, und zweitens wird Edward um so mehr Gelegenheit haben, jenen natürlichen Geschmack für deine Lieblingsbeschäftigung zu entwickeln, der für dein künftiges Glück doch absolut notwendig ist. Ach, wenn ihn dein Genius so weit beflügelte, daß er selber zeichnen lernt, wie entzückend das doch wäre!«
Elinor hatte ihrer Schwester gesagt, was sie wirklich dachte. Sie war nicht der Ansicht, daß es um ihre Neigung zu Edward so günstig bestellt sei, wie es Marianne geglaubt hatte. Mitunter verriet er einen Mangel an Temperament, der, selbst wenn er nicht auf Gleichgültigkeit beruhte, doch auch nicht viel mehr verhieß. Zweifel an ihrer Zuneigung, falls er welche hegte, würden ihn zwar beunruhigen, aber schwerlich jene seelische Niedergeschlagenheit hervorrufen, die sich häufig an ihm zeigte. Eine einleuchtendere Erklärung mochte seine Abhängigkeit sein, die es ihm verwehrte, seiner Neigung freien Lauf zu lassen. Sie wußte, seine Mutter verhielt sich so gegen ihn, daß er im Augenblick weder ein angenehmes Zuhause bei ihr hatte noch die Gewißheit besaß, einmal ein eigenes Heim gründen zu können, wenn er sich nicht genau nach ihren Vorstellungen von einer vorteilhaften Partie richtete. Da Elinor dies alles wußte, konnte sie sich in dieser Frage unmöglich beruhigt fühlen. Sie verließ sich keineswegs darauf, daß seine Neigung zu ihr den Ausgang nehmen würde, den ihre Mutter und ihre Schwester für sicher hielten. Ja, je länger sie zusammen waren, um so zweifelhafter erschien ihr die Natur seiner Gefühle, und bisweilen hielt sie diese ein paar schmerzliche Augenblicke lang für nichts weiter als Freundschaft.
Doch wo auch immer die Grenze dieser Empfindungen liegen mochte, sie genügten, um bei seiner Schwester, sobald sie ihr auffielen, Unruhe und zugleich – was noch natürlicher war – Unhöflichkeit auszulösen. Sie benutzte die erste Gelegenheit, ihre Schwiegermutter aus diesem Anlaß zu beleidigen, indem sie ihr so ausdrücklich schilderte, welch große Karriere ihrem Bruder bevorstehe, wie fest Mrs. Ferrars entschlossen sei, ihre beiden Söhne gut zu verheiraten, und welche Gefahr jedes junge Mädchen laufe, das ihn zu »umgarnen« versuche, daß sich Mrs. Dashwood weder ahnungslos stellen noch ruhig bleiben konnte. Sie gab ihr eine Antwort, die sie ihre Verachtung fühlen ließ, und ging augenblicklich aus dem Zimmer, entschlossen, ihre liebe Elinor ohne Rücksicht auf die Unbequemlichkeiten und die Kosten eines so plötzlichen Umzugs keine Woche länger derartigen Verdächtigungen auszusetzen.
In dieser Gemütsverfassung wurde ihr mit der Post ein Brief zugestellt, der einen Vorschlag enthielt, welcher ihr ganz besonders gelegen kam. Ein Verwandter von ihr, ein vermögender und einflußreicher Gentleman in Devonshire, bot ihr zu sehr günstigen Bedingungen ein kleines Haus an. Der Brief stammte von dem Gentleman selbst und war ganz im Geiste echter Hilfsbereitschaft gehalten. Er habe erfahren, sie suche eine Wohnung; die Unterkunft, die er ihr anbieten könne, sei zwar bloß ein kleines Landhaus, doch würde alles, was sie für erforderlich hielte, getan werden, um es für sie instand zu setzen, falls ihr die Lage zusage. Er lud sie, nachdem er ihr das Haus und den Garten im einzelnen geschildert hatte, wärmstens ein, mit ihren Töchtern nach Barton Park, seinem eigenen Wohnsitz, zu kommen, von wo aus sie selbst beurteilen könne, ob sich Barton Cottage – denn die Häuser lägen in derselben Gemeinde – durch irgendwelche Umbauten in ein angenehmes Heim für sie verwandeln ließe. Es schien ihm wirklich daran gelegen, sie alle gut unterzubringen, und sein Brief war in einem so freundlichen Ton gehalten, daß er nicht verfehlen konnte, seiner Verwandten zu gefallen, zumal in einem Augenblick, da sie unter dem kaltherzigen und fühllosen Verhalten ihr näherstehender Menschen litt. Sie brauchte keine Zeit, um sich die Sache zu überlegen oder Erkundigungen einzuziehen. Ihr Entschluß stand fest, noch bevor sie zu Ende gelesen hatte. Vor ein paar Stunden noch hätte der Umstand, daß Barton in der von Sussex so weit entfernten Grafschaft Devonshire lag, schwerer gewogen als jeder Vorteil, den dieser Ort nur hätte bieten können; jetzt aber erwies er sich geradezu als Empfehlung. Die Gegend von Norland verlassen zu müssen war kein Unglück mehr; es war ein erstrebenswerter Schritt, ja, es war eine Wohltat im Vergleich zu der Qual, noch länger Gast ihrer Schwiegertochter bleiben zu müssen, und von der liebgewordenen Stätte auf immer wegzuziehen würde nicht so weh tun wie dort zu wohnen oder auf Besuch zu weilen, solange eine solche Frau Herrin auf Norland war. Augenblicklich schrieb sie Sir John Middleton ihren Dank für seine Güte und ihre Zusage auf sein Anerbieten, und dann hatte sie nichts Eiligeres zu tun, als beide Briefe ihren Töchtern zu zeigen, um sich ihres Einverständnisses zu versichern, ehe sie die Antwort absandte.
Elinor war schon immer der Ansicht gewesen, daß es klüger wäre, wenn sie sich in einiger Entfernung von Norland niederlassen würden als unmittelbar unter ihren jetzigen Bekannten. In dieser Beziehung hatte sie also keinen Anlaß, sich der Absicht ihrer Mutter zu widersetzen, nach Devonshire zu ziehen. Auch war das Haus, wie es Sir John beschrieben hatte, von so schlichter Beschaffenheit und die Miete so ungewöhnlich niedrig, daß sich gegen beides beim besten Willen nichts einwenden ließ; und obwohl der Plan nichts Verlockendes für sie hatte und sie weiter von Norland entfernen würde, als es ihren Wünschen entsprach, versuchte sie doch nicht, ihre Mutter davon abzubringen, eine Zusage zu senden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!




![Emma (Centaur Classics) [The 100 greatest novels of all time - #38] - Jane Austen. - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ba91eea69a27a8fd52d9e1952c7c4a74/w200_u90.jpg)