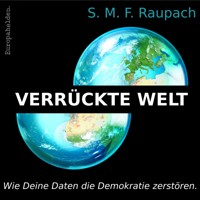
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Was ist eigentlich los? Krieg in Europa, extreme Parteien verbreiten sich wie Fußpilz und Cyberangriffe sind das neue Normal. Mittendrin verrückte Präsidenten, milliardenschwere Tech-Konzerne, Diktatoren und Kriminelle, die auf Beutezug nach unseren privatesten Daten gehen. Mit dabei: Freaks aus Psychologie und Sozialwissenschaft, die sie unterstützen in ihrem gemeinsamen Ziel, dem Aufspüren und Ausnutzen sozialer und psychologischer Schwachstellen. Ein Eindringen in Schwachstellen unserer Gesellschaft und jedes Einzelnen, getrieben von dem Wunsch aller Despoten und Extremisten in der Geschichte der Menschheit: den freien Willen zu 'hacken' - seit Kant und Voltaire Grundlage der europäischen Entwicklung und Garant unserer Freiheit und Demokratie. Was da genau passiert ist, was gerade passiert, und was Du dagegen tun kannst? Das findest Du in diesem Buch: Keine Patentrezepte, aber Hintergründe und erste Schritte aus der Krise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verrückte Welt - wie Deine Daten die Demokratie zerstören
Sebastian M. F. Raupach
2024
Vorbemerkung zum E-Book
Wir befinden uns im dritten Jahr des russischen Überfalls auf die Ukraine. Vor fast drei Jahren sind Putin und Lawrow von verdeckten Attacken und heimlichen Kriegsvorbereitungen zum offenen, militärischen Angriff auf Europa übergegangen. Ihrem Privatkrieg gegen Putins Hirngespinste fallen weiter jeden Tag unzählige Menschen zum Opfer, völlig sinnlos werden Menschen verletzt, verstümmelt und getötet. Weiter sind russische Kriegsverbrechen, russische Angriffe auf Krankenhäuser und zivile Infrastruktur an der Tagesordnung. Ende 2024 ist der neue US-Präsident im wahrsten Sinne des Wortes ein alter Bekannter. Wieder unterstützt sein engster Berater eine rechtsextreme Partei in Deutschland. Weiter fällt diese Partei Deutschland, der Ukraine und ganz Europa in den Rücken. Weiter unterstützt und verbreitet sie die Lügenmärchen und Desinformation des Moskauer Kriegsverbrechers und dient seinen Interessen. Weiter sind Datenkraken und ihr Raubbau an der bürgerlichen Privatsphäre ein weitgehend legales Geschäftsmodell, nur eingeschränkt durch die vorbildliche Arbeit des Europaparlaments. Weiter steckt das Bundesgesundheitsministerium den Kopf in den Sand und verfolgt unbeirrt das Ziel einer zentralen Vorratsdatenspeicherung und Fremdverwertung intimer medizinischer Daten eines Großteils der Bevölkerung. Weiter laufen schwere quasi-militärische Cyberangriffe und Daten-Beutezüge gegen unsere Gesellschaft: Manchmal fühlt es sich an, als wären wir in eine Zeitschleife geraten. Auch wenn sich einige Namen geändert haben, aus Steven Bannon ein Elon Musk geworden ist und Facebook sich jetzt ’Meta’ nennt, auch wenn Putin inzwischen in Nordkorea um Unterstützung seines Wahnsinns betteln muss - das bereits 2021 erschienene Buch Verrückte Welt bleibt von verblüffender Aktualität. Daher wurde es in der E-Book-Version bis auf einige Korrekturen und den technisch bedingten Wegfall der Fußnoten weitgehend unverändert gelassen. Denn das Buch beschreibt nicht nur als Zeitdokument, wie wir in diese ’Zeitschleife’ geraten sind, sondern enthält auch einen Schlüssel dazu, wie wir ihr wieder entkommen. Ein kleiner Schlüssel, den jeder von uns nutzen kann, indem er seine wichtigste Ressource verteidigt… Alles Gute wünscht Ihnen Sebastian Raupach Braunschweig, im Dezember 2024
Vorwort zur 3. Auflage
Während ich diese Zeilen schreibe, sitzen einige hundert Kilometer entfernt, im Osten Europas, Frauen und Kinder zitternd in Kellern und U-Bahn-Schächten. Über ihren Köpfen explodieren russische Granaten, russische Bomben und russische Raketen. Stromversorgung und Kernkraftwerke werden ebenso attackiert wie zivile Wohn- und Verwaltungsgebäude. Der von Wladimir Putin mit seinem Außenminister Sergej Lawrow veranlasste Überfall der russischen Armee auf die Ukraine hat die Perspektive der Menschen überall in Europa geändert und geschärft, auch meine. Als ich das vorliegende Buch verfasste, herrschte Frieden in Europa, und der Ausgangspunkt meiner Recherchen war damals ein bloßes Unbehagen über den sorglosen Umgang mit den Gesundheitsinformationen der Bürgerinnen und Bürger und über schwer fassbare Entwicklungen in der Gesellschaft. Bei meinen Recherchen deckte ich nichtsahnend eine Ungeheuerlichkeit nach der anderen auf, die aus damaliger Sicht fast absurd erschienen. Erst in den vergangenen Wochen habe ich verstanden, dass ich, ohne es zu wissen, Ausschnitte aus dem Kriegsdrehbuch des Kreml rekonstruiert hatte. Bereits im Jahr 2012 hatte Margarita Simonjan, Putin-Vertraute und Chefredakteurin des staatlich finanzierten Propagandasenders Russia Today/RT in einem Interview verkündet, dass ihr Sender eine „Informationswaffe“ im „Informationskrieg gegen die westliche Welt“ sei Wie wir heute sehen, ging es nicht um eine abstrakte Propagandaschlacht: Sie war Teil eines jahrelangen Hinarbeitens des Kreml auf einen realen Krieg, sichtbar auch an der jahrelangen militärischen Aufrüstung, der immer vollständigeren Unterdrückung freier russischer Medien, zivilgesellschaftlicher Initiativen und der unabhängigen Opposition, bis hin zum Attentat auf den Oppositionellen Nawalny mit chemischen Waffen. Während Anfang 2022 die Konzentration russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine für wachsendes Unverständnis sorgt, der russische Präsident Putin die Welt belügt und der Kreml immer wieder abwiegelt, zappt einer meiner Bekannten in einem Hotelzimmer durch die per Satellit empfangbaren Sender. Da er Russisch spricht, bleibt er bei einem russischen Sender hängen - und ist fassungslos. In einer Polit-Talkrunde tauschen sich die russischen Teilnehmer ganz selbstverständlich darüber aus, dass es jetzt soweit sei. Jetzt sei es soweit, Europa wieder einzuverleiben in die ,russischen Einflusssphäre’, man müsse allenfalls noch mit den Amerikanern über die Aufteilung verhandeln. Wobei selbst Deutschland ja eigentlich kein Land sondern ein Kunstprodukt der Vereinigten Staaten sei, das nicht einmal eine richtige Verfassung habe. Unfassbar. Unfassbar, wie das bizarre Loblied des Ex-Präsidenten Trump auf Putin und dessen Invasionsarmee („Die stärkste Friedenstruppe, die ich je gesehen habe, da waren mehr Armeepanzer als ich je gesehen habe. Die werden ordentlich den Frieden sichern.“) Bizarr - und gefährlich, denn unweigerlich stellt sich die Frage: Wie sähe die heutige Lage aus, wenn sein Angriff auf Amerikas Demokratie erfolgreich gewesen und Trump heute noch an der Macht wäre? Eines muss uns allen klar sein: Der Überfall der russischen Armee auf die Ukraine ist weder spontanes Ereignis noch Reaktion auf irgendeine ,Kränkung’, sondern Teil eines im Kreml ersonnenen, wie ein Schachspiel seit Jahren laufenden Planes. Der Angriff darf nicht isoliert gesehen werden. Wir können nicht einmal ausschließen, dass es auch ein Ziel war, ein Eingreifen der NATO zu provozieren, um die Fantasien von einem ,Krieg gegen den Westen’ Wirklichkeit werden zu lassen. Der Überfall auf die Ukraine ist nach diesem Plan ein Anfangspunkt, kein Endpunkt - es sei denn, wir machen ihn dazu. Ich habe mich bewusst entschieden, den Text in der dritten Auflage als Zeitdokument weitgehend unverändert zu lassen; in der vermessenen Hoffnung, dass er in der Zeit nach Putin und Lawrow vielleicht einen winzigen Beitrag zur Aufarbeitung und Strafverfolgung leisten kann. Widmen will ich diese Seiten jedoch dem wohl mutigsten Politiker und Demokraten dieser Tage: Wolodymyr Selenskyi, dem Präsidenten der freien Ukraine. Braunschweig, im März 2022
Einleitung
Belarus, 2020. Ein junger Litauer verlässt mit einem leichten Kater ein Haus. Auf der Straße warten schon Polizisten auf ihn. Kurze Zeit später findet er sich in einem Auto wieder, Schulter an Schulter mit zwei auffällig unauffällig in Zivil gekleideten Männern. Er beginnt zu ahnen, dass der vergangene Abend und die Nacht danach keine gute Idee waren… Dabei war der Informatiker doch nur zur feucht-fröhlichen Geburtstagsfeier eines Freundes in das benachbarte Belarus gereist. Ein Mädchen auf der Party widmete ihm ihre besondere Aufmerksamkeit. Nachdem reichlich Alkohol geflossen ist, nimmt sie ihn mit in ihre Wohnung und die Nacht einen Verlauf, den sie für den Familienvater besser nicht genommen hätte. Die Ahnung wird für den Administrator einer großen Datenbank zur Gewissheit, als die beiden Männer ihm Fotos der vergangenen Nacht zeigen. Sie lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die Beiden drohen mit einem Strafverfahren und damit, die vernichtenden Bilder seiner Frau in Litauen zu schicken. Es sei denn…ja, es sei denn, er arbeitet mit ihnen zusammen. Zum Beispiel, indem er die Datenbank, die er verwaltet, für sie kopiert. Und auf die „Peitsche“ folgt sofort das „Zuckerbrot“: Er schade damit ja niemandem und könne sich so sogar noch ordentlich etwas dazuverdienen… Was ist das Besondere an dieser Schilderung der litauischen Sicherheitsdienste in ihrem Lagebild 2021? Es ist nicht der Umstand, dass der mit dem russischen eng verbundene belarusische Geheimdienst KGB eine „Honigfalle“ inszeniert, um jemanden mit peinlichem Material zu erpressen und zur Kooperation zu zwingen. Das Bemerkenswerte ist: Die Zielperson ist nicht wie im Kalten Krieg Diplomat, Kernwaffenexperte oder „Atom-Physiker“. Er ist Verwalter eines der begehrtesten Rohstoffe: Administrator einer Datenbank. Im 21. Jahrhundert sind Daten das Spaltmaterial, das Macht verspricht und zerstörerische Kettenreaktionen auslöst. Und dass das so ist, liegt am Zustand des Digitalen Raums unserer Zeit, dem Internet. Denn dort sind Daten das digitale Gold.
Der Goldrausch
1989, im Jahr der politischen Umwälzungen und friedlichen Revolutionen, nimmt auch eine technische Revolution ihren Anfang, die unsere Gesellschaft prägen wird wie kaum eine andere. In diesem Jahr entwickelt der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee an der europäischen Forschungseinrichtung CERN ein besonderes Computerprogramm. Es ermöglicht, sich mit Menschen auf der ganzen Welt über den Computer zu verbinden und mit ihnen Informationen auszutauschen: ein weltumspannendes Netzwerk ist geboren – das World Wide Web, kurz: Internet.
In den 1990er Jahren ist das Internet zunächst ein Projekt von Wissenschaftlern, bald schon aufregender Tummelplatz verspielter Computernerds, die alle im Großen und Ganzen gleich „ticken“. Die das Gefühl haben, an der Küste eines bisher unbekannten Landes zu stehen, das grenzenlose Freiheit verspricht. Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das sie gemeinsam entdecken, aufbauen und gestalten können.
Eine fast paradiesische Parallelwelt zur Wirklichkeit, in der es keine Staaten, keine Mauern, keine versteckten Interessen gibt. In der sich jeder mit jedem austauschen kann. Ohne Unterdrückung oder Kontrolle, in der es für jeden eine Nische gibt. Ein unberührtes Land, in dem eine neue, eine gute Welt aufgebaut werden kann, in der sich jeder frei entfalten kann in einer Gemeinschaft von Gleichen. Eine frische Welt ohne Regeln: ungeahnte Möglichkeiten, ungenutztes Neuland.
Bis andere darauf aufmerksam werden, und der erste auf den Gedanken kommt: Damit müsste man doch mehr anfangen können, als sich irgendwelche Nischen der Anarchie zu suchen, Inseln der Freiheit oder Orte für Träumer? Und so kommt das große Geld.
Wenn man sich das Internet in seiner Anfangszeit der 1990er Jahre als eine Art wilder und fröhlicher Hippie-Kommune vorstellen mag, so gleicht das Internet der 2000er und 2010er Jahre eher der apokalyptischen Welt eines finsteren Blockbusters in Endzeitstimmung. Einer Welt, in der die fröhliche Anarchie der Hippie-Kommune ersetzt ist durch eine Welt eiskalter Berechnung. Eine Welt, in der allein das Recht des Stärkeren gilt: die beherrscht wird von unermesslich reichen, skrupellosen und praktisch allmächtigen Cyber-Oligarchen. Aufgeteilt unter Cyber-Konzernen, deren Bosse die Hippies von gestern sind. Die jetzt Geld scheffeln und dafür den Traum von Freiheit in den Alptraum einer Welt ohne Privatsphäre verwandelt haben.
Wer nichtsahnend diese Welt betritt, wird als Datenwild betrachtet, auf das jeder Jagd machen kann. Er wird in jedem Augenblick beobachtet, bewertet und analysiert, um sein Verhalten immer besser vorhersagen, manipulieren und kontrollieren zu können. Ein Kreislauf von Analyse und Manipulation als großes Menschenexperiment, um den perfekt steuer- und vorhersagbaren Empfänger von Werbebotschaften heranzuziehen. Die im Internet umherirrende Gesellschaft wird zum Schlaraffenland der Werbepsychologie, in dem sich jeder nehmen kann, was und wen er will – first come, first serve. Willkommen im Internet des 21. Jahrhunderts. Übrigens...wenn Sie bei Google eine Suche starten – bezahlen Sie etwas dafür? Nein? Ich auch nicht. Und alle meine Freunde und Bekannten auch nicht. Das ist doch merkwürdig. Die riesigen Rechenzentren, die ganzen Mitarbeiter – das ist doch bestimmt nicht billig. Und trotzdem steht Google/Alphabet nicht vor dem Ruin, sondern macht sogar noch Gewinn: Allein in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 ca. 12,5 Milliarden Euro. Die Bargeldreserven des Konzerns von etwa 112 Milliarden Euro übertreffen immerhin den jährlichen Gesamthaushalt etlicher europäischer Staaten. Woher kommt das ganze Geld? Jetzt werden Sie vielleicht sagen: Naja, das verdienen sie mit Werbung, weiß doch jeder. Das ist aber nicht ganz korrekt. Zunächst einmal: Sie zahlen deswegen nichts, weil Sie kein Kunde sind, sondern Nutzer. Die Kuh im Stall bezahlt ja auch keine Miete und auch nicht das Heu, das sie frisst. Das Geschäftsmodell der geldlosen Nutzung z.B. bestimmter Suchmaschinen oder virtueller „sozialer“ Netzwerke bis hin zum Parallel-Internet von Facebook beruht im Kern auf einem Tauschhandel. Das funktioniert ähnlich wie früher bei den europäischen Seefahrern in der Südsee. Die angebotenen Dienste werden bei uns digital natives wie Glasperlen eingetauscht gegen das Gold des Internets: den von den nichtsahnenden Nutzern als wertlos erachteten „Rohstoff“ ihrer eigenen Daten, die scheinbar unerschöpfliche Ressource „Privatsphäre“. Was sie nicht wissen: Aus diesem einzigartigen Rohstoff erzeugen die Eroberer des Internets durch Profilbildung eine lukrative Handelsware und bieten sie zum Verkauf an: Manipulierbarkeit.
Dahinter steht ein Geschäftsmodell, das manchmal als „werbegetrieben“ oder „werbebasiert“ bezeichnet wird. Doch das ist nicht ganz richtig: Es werden keine Werbeanzeigen verkauft, sondern Zielgruppen. Der Käufer, der eine Botschaft verbreiten möchte, kann sich als Adressaten, die die Botschaften sehen werden, bequem bestimmte Zielgruppen aufgrund individueller Personenprofile zusammenklicken. Wenn Google oder Facebook also beteuern, sie würden nicht die Daten ihrer Nutzer verkaufen oder weitergeben, ist das in gewisser Weise richtig. Sie wären ja auch schön dumm, da ihr Geschäftsmodell darauf beruht, die Daten selbst auszuwerten und daraus ein Profil von Ihnen zu erstellen.
Das Geschäftsmodell von Firmen wie Facebook/Instagram/Twitter oder Google beruht darauf, ihren zahlenden Kunden (nein, nicht Sie, liebe Leserin und lieber Leser) die Erstellung und Ansprache möglichst passgenauer Zielgruppen unter ihren Nutzern zu ermöglichen (das sind Sie).
Sie bieten ihren Kunden mit Werkzeugen wie Facebook‘s audience manager tool die Möglichkeit an, sich z.B. anhand geographischer, demographischer, interessens- oder verhaltensbasierter Parameter maßgeschneiderte Wunschprofile ihrer Adressaten zusammenzustellen. Dabei greift Facebook auch auf externe Datensätze von Datendealern zurück, die wir noch kennenlernen werden. Die Personen, die den entsprechenden Profilen entsprechen, werden dann zu den Zielen personalisierter „Botschaften“. Und eins ist klar: Je mehr und je Intimeres man über die Nutzer weiß, je vorhersagbarer also ihr Verhalten wird, desto besser funktioniert das Ganze. Um ein besseres Gefühl und einen Eindruck aus erster Hand zu bekommen, werfen wir einen Blick in die Datenschutzerklärung von Google:„[…] Wir erheben auch die Inhalte, die Sie bei der Nutzung unserer Dienste erstellen, hochladen oder von anderen erhalten. Dazu gehören beispielsweise E-Mails, die Sie verfassen und empfangen, Fotos und Videos, die Sie speichern, Dokumente und Tabellen, die Sie erstellen, und Kommentare, die Sie zu YouTube-Videos schreiben.“ Moment mal. Die durchwühlen auf ihren Servern also einfach die E-Mails und Fotos der Leute? Was kommt denn noch?"[…] Wir erheben Daten über die Apps, Browser und Geräte, die Sie beim Zugriff auf Google-Dienste verwenden. […] Zu den von uns erhobenen Daten zählen eindeutige Kennungen, der Typ und die Einstellungen des Browsers, der Typ und die Einstellungen des Geräts […]. Wenn Sie ein Android-Gerät mit Google Apps verwenden, kontaktiert Ihr Gerät regelmäßig die Google-Server, um Daten über Ihr Gerät und die Verbindung zu unseren Diensten bereitzustellen. […] Wir erheben in unseren Diensten Daten zu Ihren Aktivitäten. […] Unter anderem könnten folgende Aktivitätsdaten erhoben werden: - Begriffe, nach denen Sie suchen - Videos, die Sie sich ansehen - Inhalte und Werbeanzeigen, die Sie sich ansehen und mit denen Sie interagieren - Sprach- und Audiodaten bei Ihrer Nutzung von Audiofunktionen - Kaufaktivitäten - Personen, mit denen Sie kommunizieren oder Inhalte austauschen - Aktivitäten auf Websites und Apps von Drittanbietern, die unsere Dienste nutzen - Der Chrome-Browserverlauf, den Sie mit Ihrem Google-Konto synchronisiert haben“ Augenblick. Heißt das, die verfolgen und notieren auch noch die ganze Zeit mit, was die Leute machen? Kommt denn noch mehr?„Wenn Sie unsere Dienste nutzen, um Anrufe zu tätigen und zu erhalten oder um Nachrichten zu senden und zu empfangen, erheben wir möglicherweise Telefonie-Informationen wie Ihre Telefonnummer, die Anrufernummer, die Nummer des Angerufenen, Weiterleitungsnummern, das Datum und die Uhrzeit von Anrufen und Nachrichten, die Dauer von Anrufen, Routing-Informationen und die Art der Anrufe. […] Wenn Sie unsere Dienste nutzen, erheben wir Daten zu Ihrem Standort. […] Ihr Standort kann mit unterschiedlicher Genauigkeit bestimmt werden. Dazu verwenden wir: - GPS - IP-Adresse - Sensordaten von Ihrem Gerät - Informationen über Objekte in der Nähe Ihres Geräts, wie etwa WLAN-Zugriffspunkte, Funkmasten und Bluetooth-fähige Geräte“ Verletzung des Postgeheimnisses? Durchsehen und Verwenden privater Fotos? Aufzeichnung von Gesprächen? Unbegrenzte Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten? Überwachung des Aufenthaltsortes? Und Vieles mehr? Mal ehrlich: Jeder Postbote oder Staatsbedienstete würde für all diese Übergriffe sehr lange hinter Gitter kommen. Für die großen Tech-Unternehmen scheinen andere Maßstäbe zu gelten: Es werden alle Metadaten, Informationen und Inhalte erfasst und der Sammlung hinzugefügt, derer man habhaft werden kann. Oder für die Star Trek Fans: Google & Co. sehen sich offenbar als die „Daten-Borg“ des Internets – „Widerstand ist zwecklos“.
Na schön oder unschön - da gibt es also Unternehmen, die alle Informationen über Sie sammeln, an die sie kommen. Aber mal im Ernst, nur weil die mitlesen, wie Sie in einer E-Mail über die Schulprobleme Ihrer Kinder klagen oder registrieren, dass Sie das Foto von der Nachbarskatze mit einem Like versehen – was soll‘s? Wer will damit schon irgendetwas anfangen?
Genau dazu wurde von der amerikanischen Akademie der Wissenschaften schon im Jahr 2013 eine verblüffende Studie veröffentlicht: Die von einem Facebook-Nutzer vergebenen „Likes“ erlauben es, mit erstaunlich hoher Zuverlässigkeit auf dessen politische und sexuelle Orientierung zurückzuschließen. In einer weiteren Veröffentlichung aus dem Jahr 2014 zeigten die Autoren, dass automatisierte Verfahren die wesentlichen Persönlichkeitszüge von Menschen anhand von Likes im Durchschnitt gleich gut oder besser erfassen als andere Menschen: bei Auswertung von 10 Likes besser als Arbeitskollegen, bei Auswertung von 70 Likes besser als Freunde oder Mitbewohner, bei Auswertung von 150 Likes besser als Familienmitglieder, bei Auswertung von 300 Likes besser als der Ehepartner/die Ehepartnerin. Die typische Zahl von Likes pro Nutzer liegt dem Artikel zufolge übrigens bei 227 Likes. Na, gut dass die Betreiber Sozialer Netzwerke das nicht wissen. Oder doch? Das Unternehmen Facebook hat von 2012 bis 2016 eine Reihe von bemerkenswerten Patenten beantragt, die Daten und Maschinelles Lernen für Ihre automatisierte Klassifizierung kombinieren. Sie tragen den Titel: „Die Bestimmung von Persönlichkeitsmerkmalen von Nutzern anhand der Kommunikation und Charakteristiken in Sozialen Netzwerken“: „Ein soziales Netzwerk gewinnt linguistische Daten aus der schriftlichen Kommunikation eines Nutzers. […] Die linguistischen und nicht-linguistischen auf den Nutzer bezogenen Daten werden in einem antrainierten Modell verwendet, um ein oder mehrere Persönlichkeitsmerkmale des Nutzers zu bestimmen [to predict]. Die abgeleiteten Persönlichkeitsmerkmale werden in Verbindung mit dem Profil des Nutzers gespeichert und können für zielgerichtete Ansprache [targeting], Reihung, die Auswahl von Produktversionen oder verschiedene andere Zwecke benutzt werden.“
Das Unternehmen arbeitet intensiv daran, anhand der Äußerungen und Aktivitäten auf seiner Plattform seine Nutzer in ihrer Persönlichkeit und ihren persönlichen Kontakten psychologisch möglichst tief und umfassend zu erfassen und zu katalogisieren. Eng mit Facebook verbunden ist der Messenger-Dienst WhatsApp, der von ca. 58 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern genutzt wird, knapp 70% der Gesamtbevölkerung:„Wir gehören seit 2014 zur Facebook-Unternehmensgruppe. Als Teil der Facebook-Unternehmensgruppe erhält WhatsApp Informationen von den Unternehmen dieser Unternehmensgruppe und teilt Informationen mit ihnen.[…].“ Im Jahr 2021 löst die Ankündigung und Einführung neuer „Datenschutz“-Regeln durch den Konzern einen Aufschrei der Empörung aus. Zum einen besteht die Sorge, dass die durch europäisches Recht geschützten Nutzerdaten verstärkt an den Mutterkonzern Facebook fließen, wie es außerhalb der Europäischen Union gang und gäbe ist. Zum anderen droht der Konzern unwilligen Nutzern mit immer stärkeren Zugriffsbeschränkungen auf ihre Daten und die Funktionen von WhatsApp. Erst im Nachhinein macht er einen - einstweiligen - Rückzieher aus Sorge, Nutzer zu verlieren. Der Fall zeigt: Einerseits können Nutzer also einen gewissen Einfluss ausüben, wenn sie koordiniert handeln. Andererseits zeigt der Fall aber auch nochmal deutlich, dass das eigentliche Geschäft der Unternehmen das Sammeln und Verwerten personenbezogener Daten ist. Sie gehen immer so weit, wie es nur irgend möglich ist - solange es nur die Kasse füllt.
Cyberfirmen wie Facebook und Google weiten die eigene Datensammlung über den Kreis ihrer unmittelbaren Nutzer weit aus: Durch Ankauf von Daten und indem sie Betreibern von Webseiten kostenlose „Analyse-Werkzeuge“ anbieten, die den Betreibern Aufschlüsse über das Nutzerverhalten der Besucher ihrer Seite liefern (Facebook analytics, Google analytics, …). Für die Analyse werden die gesammelten Daten dann an Facebook oder Google gesandt und vergrößern damit deren Datensammlung. Damit wird jeder Website-Betreiber, der entsprechende Analysetools auf seiner Seite verwendet, zu einer Art „informellem Mitarbeiter“ der Firmen. So findet man beispielsweise auf den Hilfeseiten von Google analytics noch im Frühjahr 2021 genaue Anweisungen, wie man Nutzer über verschiedene Webseiten (domains) hinweg verfolgt.
Natürlich gibt es neben Facebook und Google auch andere, zum Teil regional entstandene Cyberfirmen, die persönliche Daten verwerten. Mit dem Netzwerk VKontakte , kurz VK, gibt es inzwischen auch ein einflussreiches russisches Soziales Netzwerk. Es ist davon auszugehen, dass der russische Staat Zugriff auf die bei VK gespeicherten und verarbeiteten Daten hat und regelmäßig Profile der Nutzerinnen und Nutzer erstellt. Vielleicht fällt Ihnen an der Stelle der Whistleblower Edward Snowden ein. Tatsächlich sind die Anbieter in der Russischen Föderation zur mehrmonatigen Vorratsdatenspeicherung verpflichtet, sowie dazu, für verschlüsselte Daten „Hintertüren“ für den Staat einzurichten oder den staatlichen Behörden die Schlüssel zugänglich zu machen. Unter anderem durch das „Gesetz über ein Autonomes Internet“ von 2019 wurde die Zugriffsmöglichkeiten des russischen Staates weiter ausgebaut. Und ähnlich wie das durch Snowden bekannte System PRISM in den USA, hat die Russische Föderation ein eigenes Überwachungssystem unter dem Namen SORM. Dessen Anfänge gehen in die Zeit der Sowjetunion zurück, in den vergangenen Jahren wurde es intensiv ausgebaut. Es ist u.a. in der Lage, individuelle Nutzerprofile zu erstellen und Soziale Netzwerke auszulesen. Es umfasst zudem die Installation staatlicher Black Boxes unbekannter Funktionalität bei Internet-Anbietern in der Russischen Föderation. Für das stark regulierte „chinesische Internet“ in der vom Wunsch nach totaler Kontrolle der Bevölkerung getriebenen Volksrepublik China kann man mindestens von ähnlichen Überwachungssystemen ausgehen. Nur müssen Sie wissen: Die genaue und lückenlose Erfassung der Nutzerinnen und Nutzer bei Diensten wie Facebook, VK oder Google ist nicht Folge eines staatlichen Missbrauchs. Es ist deren eigene Idee und ihr Geschäftszweck. Wieso funktioniert dieses Geschäftsmodell? Was genau macht diese „Schattenwirtschaft“ des Digitalen Raums da außerhalb der Sichtweite seiner Nutzerinnen und Nutzer? Schleichen wir uns einmal hinter die Kulissen des Digitalen Raums. In eine Welt, die gnadenlos ausnutzt, dass die Evolution uns keinen „Digitalsinn“ mitgegeben hat und wir im Internet blind wie die Maulwürfe sind. Nehmen Sie Geschenke von Fremden? Laden Sie Fremde ein, Ihnen auf auf der Toilette, in der Badewanne oder im Schlafzimmer zuzuhören und zuzuschauen, indem Sie Kamera und Mikrofon mitnehmen? Glauben Sie jedem unbesehen, dass er nur das Beste für Sie will? Wenn es Ihnen schlecht geht - gehen Sie dann auf die Straße und hängen sich ein Schild um, auf dem steht: „Gerade geht‘s mir echt nicht gut - jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mich auszunutzen."? Oder wenn Sie gut gelaunt sind ein Schild mit der Aufschrift: „Alle herschauen: Bin richtig gut drauf - jetzt sage ich zu allem ja!“?





























