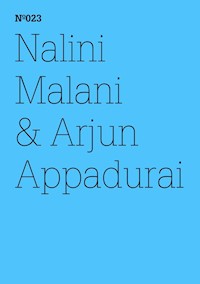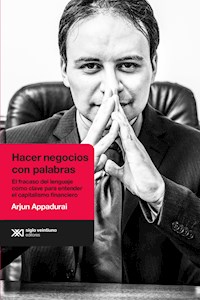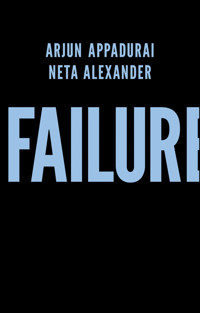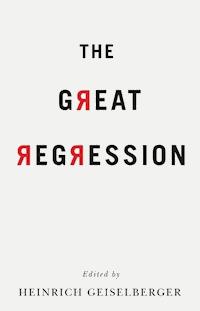Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Technologie ist immer effektiv, der Zugang zu Informationen unbegrenzt, und Banken sind »too big to fail« – dieser Mythos des Kapitalismus ist so wirkmächtig wie falsch. Das Finanzsystem hat sich von seiner globalen, mit Steuern notdürftig gekitteten Krise nie erholt. Geld ist nichts mehr wert, unsere Abhängigkeit von Wall Street und Silicon Valley verstärkt sich, je schlechter das System funktioniert. Und in der Gig Economy von Uber bis Airbnb verschärft sich der Druck: Jeder Erfolg wird überwacht, jedes Scheitern geahndet. Bei technischen Geräten hingegen ist das Versagen vorprogrammiert – dass sie möglichst schnell kaputtgehen, gehört zum Geschäftsmodell. Der renommierte Ethnologe Arjun Appadurai und die Medienwissenschaftlerin Neta Alexander fordern in ihrem Buch eine umfassende Neubewertung dessen, was Erfolg und was Versagen ist. Sie plädieren für Entschleunigung, Entmonetarisierung und eine neue Kultur des Scheiterns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wer scheitert und das neoliberale Glücksversprechen nicht einlöst, fühlt sich oft selbst dafür verantwortlich. Dabei ist es das System, das versagt: Die Tech- und die Finanzbranche straucheln, Entgrenzung und stete Beschleunigung rufen die Krisen hervor.
Arjun Appadurai Neta Alexander
VERSAGEN
Scheitern im Neoliberalismus
Aus dem Englischen von Hans Freundl
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
Für meine Frau Gabika
A. A.
Für meine Eltern, Gad und Elia Alexander, und für meine Familie auf beiden Seiten des Ozeans
N. A.
Inhalt
Einleitung: Der Unterschied, der keinen Unterschied macht
Kapitel 1Die Maschine der Versprechen: Zwischen »Technikversagen« und Marktversagen
Kapitel 2Schöpferische Zerstörung und neue Formen der Gesellschaftlichkeit
Kapitel 3Das vergessene Versagen: Über Pufferung, Latenz und die Monetarisierung des Wartens
Kapitel 4 Zu groß, um zu scheitern: Banken, Derivate und Marktzusammenbrüche
Schluss:Das Versagen in Erinnerung behalten
Dank
Literaturverweise
EINLEITUNG: DER UNTERSCHIED, DER KEINEN UNTERSCHIED MACHT
Die Kommerzialisierung des Versagens
Als sterbliche Wesen sind wir Menschen allgemein zum Versagen und zum Scheitern verurteilt. Doch in jüngerer Zeit ist das Versagen aus dem Bereich der Alltagssprache herausgetreten und zu einem Gegenstand der Verklärung wie auch der eingehenden Untersuchung geworden. Dieses Buch befasst sich kritisch mit dem gegenwärtigen Diskurs über das Versagen, möchte es jedoch nicht auf ein sprachliches, kulturelles oder historisches Artefakt reduzieren oder auf eine gesellschaftliche Konstruktion im herkömmlichen Sinn. Wir glauben, dass das Gefühl des Versagens etwas Reales ist und Enttäuschung, Bedauern, Reue und viele weitere kostspielige Folgen für Menschen und soziale Gruppen hervorbringt. Gleichzeitig ist Versagen kein selbstverständlicher Teil von Projekten, Institutionen, Technologien oder des menschlichen Lebens. Es ist vielmehr das Ergebnis von Beurteilungen, in denen sich an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Konstellationen von Macht, Kompetenz und wirtschaftlichem Gewicht widerspiegeln. Dadurch erzeugt und stützt das Versagen kulturelle Vorstellungen und Erwartungshaltungen. Indem wir das Versagen als Bewertungsurteil auffassen, enthüllen wir seine Beziehung zur Erinnerung, zum Erzählen und zum Kapital. Dieses Buch spürt daher der Frage nach, welche Arten von Versagen und Scheitern vergessen werden und welche Eingang in das kollektive Gedächtnis finden und unser Weltverständnis beeinflussen.
Wenn wir als Arbeitshypothese von der Annahme ausgehen, dass Versagen kein immanentes Merkmal eines menschlichen Artefakts ist (etwa eines Projekts, einer Technologie, einer Institution oder einer beruflichen Karriere), sondern ein Urteil darüber, ob etwas ein Fehlschlag ist, landen wir unvermeidlich bei den Fragen, durch welche Ereignisse solche Urteile hervorgerufen werden (Geschichte), wer autorisiert ist sie zu fällen (Macht), in welcher Form sie ausgesprochen werden müssen, um als legitim und plausibel zu erscheinen (Kultur), und durch welche Mittel und Infrastruktur Versagen herbeigeführt oder verallgemeinert wird (Technologie). Diese Faktoren zusammen erzeugen ein »Regime des Versagens«, wie wir es nennen, in dem eine bestimmte Erkenntnistheorie, eine politische Ökonomie und eine dominierende Technologie durch ihre Verschränkung potenzielle Urteile über das Versagen anbieten und gleichzeitig einschränken.
Wir möchten in diesem Buch zeigen, wie solche Beurteilungsprozedere Regime des Versagens produzieren. Vor allem interessiert uns dabei, wie der heutige Kapitalismus finanzielle und technologische Systeme zu einem zusammenhängenden Apparat konfiguriert, der Fehlschläge herbeiführt und naturalisiert und das allgegenwärtige Gefühl erzeugt, dass alle Erfolge das Ergebnis dieser Technologie und ihrer Vorzüge sind und sämtliche Fehlschläge durch die Bürger, Investoren, Nutzer oder Konsumenten verschuldet werden. Diese Ideologie lässt sich unter der Behauptung subsummieren, dass Technologie immer effizient wäre, wenn ihre Nutzer nicht so fehlbar wären. Das ist eine Art von »Solutionismus«, dem es stets darum geht, technologische Beschränkungen und Fehlfunktionen zu beheben, indem man mehr Kapital investiert, um neue, verbesserte Technologien zu schaffen (Morozov 2013). Entsprechend dieser Einschätzung vertreten wir die Auffassung, dass das Versagen in unserer digitalisierten Welt einen neuen Zugang eröffnet zu einer immanenten Kritik unserer zunehmenden Abhängigkeit von digitalen Netzwerken und mobilen Technologien – und auch der undurchschaubaren Infrastrukturen, die sie stützen. Das Buch beschreibt, wie sich insbesondere in der nordamerikanischen Finanz- und Technologiebranche Formen des Versagens herausgebildet haben, die emblematisch sind für die Welten, welche die beiden Küsten dominieren: die Wall Street und das Silicon Valley. Wir konzentrieren unsere Untersuchung des Versagens auf diese beiden Kulturen und wollen dabei herausarbeiten, wie sie beide Vergesslichkeit und Unwissen zu Geld machen. In den folgenden Kapiteln werden wir die Ähnlichkeiten zwischen den digitalen Technologien und dem Finanzmarkt darstellen, uns mit der sogenannten »Gig Economy« beschäftigen (Kapitel 2), der Monetarisierung des Wartens und der Latenzzeit (Kapitel 3) und dem Aufstieg der Derivate (Kapitel 4).
Diese Fallstudien fußen auf den von einem von uns schon zuvor so benannten Failure Studies (Alexander 2017). Eine Schwierigkeit bei der Untersuchung des Versagens besteht darin, dass dieser Begriff häufig synonym mit vielen anderen verwendet wird, wie etwa »Panne«, »Desaster«, »Zusammenbruch« oder auch »Trauma«. Die Unterschiede zwischen diesen Kategorien herauszuarbeiten, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Wir möchten stattdessen vier Denkschulen voneinander abgrenzen, die uns dabei helfen, kreativ über das Thema Versagen nachzudenken: Wissenschaft, Wirtschaft, Queer Studies und Infrastrukturforschung.
Das erste Feld ist die moderne Wissenschaft, in der das Versagen (bei Experimenten, Berechnungen und in Bezug auf Wiederholbarkeit) als wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil des Fortschritts und der Weiterentwicklung der Forschung gilt. Die expliziteste und bekannteste Ausformulierung des Versagens stammt hier von Karl Popper, der Vermutungen und Widerlegungen als die beiden wesentlichen Kennzeichen einer fruchtbaren Hypothese in den exakten Wissenschaften betrachtete (Popper 1963). Mit der Betonung der empirischen Falsifizierung war das Popper'sche Denken von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung einer Wissenschaftstheorie, die auf Widerlegbarkeit beruht. Ein Experiment ist erfolgreich, wenn es eine falsche Hypothese widerlegt und die Wissenschaft zwingt, eine neue, oftmals bessere Erklärung für ein bestimmtes Phänomen zu finden. Das Versagen ist demnach ein grundlegendes und in gewisser Weise erwünschtes Ergebnis; ohne Scheitern und Versagen gäbe es keinen Fortschritt. Im Silicon Valley hat sich dieses Modell ausgeweitet bis hin zum blinden Glauben an technologische Innovationen (wie wir in Kapitel 2 zeigen werden).
Der zweite bedeutende Beitrag zur Erforschung des Versagens kommt aus dem Bereich der Betriebswirtschaft (und verbindet dabei Technologie, Unternehmertum und Investment), in der das Scheitern zunehmend als etwas Positives betrachtet wird, das es zu unterstützen und zu kultivieren gilt und das man genauer untersuchen muss, vor allem im Hinblick auf technische und wirtschaftliche Innovationen. In der betriebswirtschaftlichen Literatur finden sich zuhauf Titel voller Klischees darüber, wie Lehren aus dem Scheitern gezogen werden können. Bei Amazon fördert eine Suche unter diesem Stichwort mehr als 20.000 Bücher mit entsprechenden Titeln zutage. Dazu gehören betriebswirtschaftliche Handbücher wie Failing Forward: Turning Mistakes into Stepping Stones for Success (Maxwell 2000), The Ten Commandments for Business Failure (Keough 2011) und WTF?! (Willing to Fail): How Failure Can Be Your Key to Success (Scudamore und Williams 2018). Die Flut an Werken darüber, »wie man besser scheitern« kann, zeugt davon, dass das Silicon Valley das Versagen als Schlüssel zum Erfolg betrachtet. Die Notwendigkeit einer positiven Einstellung zum Scheitern ließe sich auch mit der hohen Misserfolgsrate junger Startup-Unternehmen erklären. In einem 2016 veröffentlichten Bericht der Venture-Capital-Firma Horsley Bridge Partners (HBP), der auf Daten von mehr als 7.000 Investments zwischen 1985 und 2014 beruhte, wurde festgestellt, dass »bei ungefähr der Hälfte der Investitionen (in Startups, die mit Hilfe von Wagniskapital finanziert wurden) weniger als die ursprünglich investierte Summe zurückfloss« (Evans 2016). Laut Benedict Evans, Autor und Partner des Venture-Capital-Unternehmens Andreessen Horowitz, zeige der HBP-Bericht, wie stark die Innovationsökonomie und ihre Abhängigkeit von »Einhörnern« oder besonders erfolgreichen Gründungen durch das Versagen bestimmt wird: »Wir versuchen Unternehmen, Produkte und Ideen hervorzubringen, die manchmal funktionieren und manchmal sogar die Welt verändern. Ungefähr die Hälfte dieser Versuche scheitert komplett, und etwa fünf Prozent gehen ab wie eine Rakete« (Evans 2016). Trotz dieser Hymnen auf das Scheitern bleiben die Zusammenhänge zwischen dem Untergang von Unternehmen und Innovation häufig im Dunkeln, was auch für Wegbereiter der Sozialwissenschaft wie Frank Knight, Joseph Schumpeter und Max Weber galt, die sich auf Risiko, Gewinn und Innovation konzentrierten.
In jüngerer Zeit haben sich eine Reihe von Ökonomen, Soziologen und anderen Sozialwissenschaftlern die neue Innovationsökonomie, wie sie vom Silicon Valley verkörpert wird, als Untersuchungsgegenstand gewählt. Diese Forschungen sind alle in gewisser Weise durch das Werk von Joseph Schumpeter über Innovation und schöpferische Zerstörung in der Geschichte des Kapitalismus inspiriert, worauf wir in Kapitel 2 ausführlich eingehen werden. Aus diesen Forschungsarbeiten ergeben sich folgende Erkenntnisse: Sie zeigen zum einen, dass die Prozesse des Investierens, Spekulierens und der Innovation in der neuen Ökonomie weniger durch rationale Erwartungen gesteuert werden als vielmehr durch »Fiktionen« (Beckert 2016), also nicht auf empirischen Fakten beruhenden Beschreibungen der ökonomischen Zukunft, die Quelle gewinnbringender Entscheidungen sein soll. Die zweite Erkenntnis lautet, dass die Schaffung von Wert in dieser neuen Ökonomie zunehmend nachgelagert und umgeformt wird, sodass er vermehrt durch spekulative finanzielle Interessen, kurzfristiges Profitstreben und den schnellen Verkauf potenziell profitabler Unternehmen durch Börseneinführungen oder IPO erzeugt wird. Immer weniger geht es um vorgelagerte Wertschöpfungen, die auf echten wissenschaftlichen oder technologischen Entdeckungen beruhen (Janeway 2012). Drittens lässt sich feststellen, dass die gängige neoklassische Wirtschaftslehre die Dynamik dieser neuen ökonomischen Modelle aus dem Blick verloren hat, in denen die Finanzmärkte und die damit einhergehende Disruption und Volatilität immer massiver den Wert bestimmen und nicht mehr die Logik von Angebot, Nachfrage und Gleichgewicht (Mazzucato 2016). Alle diese Einsichten stützen die These, dass die Finanzmärkte stärker – statt weniger – staatlich reguliert und überwacht werden müssen, und sie beleuchten auch den Kult des Scheiterns, der den neuen Wirtschaftstypus beherrscht, insbesondere im Silicon Valley.
Um die Betrachtung nicht allzu sehr auf den vereinfachenden Gegensatz von Erfolg und Versagen zu verengen, wollen wir als drittes Feld die Queer Studies heranziehen. In jüngerer Zeit haben sich einige bekannte Theoretiker der Queer Studies wie Sara Ahmed, Lauren Berlant, Jack Halberstam und Ann Cvetkovich überzeugend gegen den Kult der »toxischen Positivität« oder des »grausamen Optimismus« ausgesprochen (Ahmed 2010; Berlant 2011; Halberstam 2011; Cvetkovich 2012). Alle ihre Arbeiten versuchten aufzuzeigen, wie das neoliberale »Glücksversprechen« paradoxerweise zu verstärkter Angst, Zusammenbrüchen und einer »schmerzhaften Verflochtenheit« mit kapitalistischen Machtstrukturen führt (Brown 1995). Zu diesem Zweck betrachteten sie insbesondere Momente der Traumatisierung und der Hilflosigkeit: Depressionen, Panikattacken, Schreibblockaden, Projektabbrü-che oder Arbeitslosigkeit. Die Queer-Forscher widersetzten sich der »Glücksdirektive« und der mit ihr verbundenen Idee vom »guten Subjekt« (einem produktiven, pflichtbewussten, meist heteronormativen Konsumenten) und bemühten sich um ein besseres Verständnis von Erfahrungen außerhalb des Rahmens des neoliberalen »Erfolgs« und dessen binärer Beziehung zum »Scheitern«. Halberstam formulierte im Zuge dessen die Frage: »Welche Art von Belohnung hat uns das Scheitern zu bieten?«, und stellte fest:
Das Scheitern ermöglicht uns, den bestrafenden Normen zu entfliehen, die unser Verhalten disziplinieren, und die menschliche Entwicklung dahingehend steuern, dass wir von ungezogenen Kindern zu ordentlichen und berechenbaren Erwachsenen werden. Das Scheitern bewahrt einen Teil der wunderbaren Anarchie der Kindheit und verrückt die angeblich klaren Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern, Gewinnern und Verlierern. Und auch wenn das Scheitern sicherlich begleitet wird von einer Vielzahl negativer Empfindungen wie Enttäuschung, Desillusionierung und Verzweiflung, so verschafft es uns gleichzeitig die Gelegenheit, diese negativen Affekte zu nutzen, um Löcher in die toxische Positivität des zeitgenössischen Denkens zu bohren. (2011, 3).
Diese Theorien bieten eine neue Temporalität des Versagens, die hinausweist über unser hergebrachtes Verständnis vom Versagen als Wiederholung, nicht als Unterschied. Sie verstehen Versagen als ein sich stetig wiederholendes, alltägliches Ereignis. Es ist kein Trauma – mit einer binären Zeitlichkeit von »vorher« und »nachher« –, sondern Teil einer »affektiven Ökonomie« (Ahmed 2004). Trotz ihres subversiven Potenzials geht diese Ökonomie des Versagens oft mit dauerhaften Ängsten und Leid einher.
Dieses Plädoyer, sich vom binären Gegensatz Scheitern/Erfolg abzuwenden, findet sich auch bei der vierten Methode, die wir heranziehen wollen: den Infrastruktur-Studien oder genauer gesagt der wachsenden Literatur über Erhaltung und Instandsetzung (Star 1999; Graham und Thrift 2007; Russell und Vinsel 2018). Neben ihrer Aufforderung, sich mit den »Erhaltern« zu befassen statt mit den »Erneuerern«, erinnern Andrew L. Russell und Lee Vinsel daran, dass die historischen Forschungen über Erhaltung und Instandsetzung zurückgehen bis zu John G. Burkes Werk Bursting boilers and the Federal power (1966), in dem er die Auffassung vertrat, dass die »Kessel-Katastrophen« im 19. Jahrhundert Ergebnis sowohl von schlechter Konstruktion wie auch von mangelnder Wartung waren (Russell und Vinsel 2018, 4). In der heutigen Zeit der geplanten Obsoleszenz (also eine in der Herstellung oder im Material schon angelegte Produktalterung) ist es schwer, eine Kultur der Instandhaltung zu bewahren, denn der zu bewahrende Gegenstand ist als eine Blackbox konstruiert, die nicht ohne weiteres von den Nutzern repariert werden kann. Und wenn Infrastrukturen von untereinander verwobenen und interagierenden elektrischen und computerisierten Systemen abhängig sind, wird die zentrale Unterscheidung zwischen Zusammenbruch und Versagen problematisch: »Es wird immer schwieriger, zu definieren, was das ›Ding‹ eigentlich ist, das gewartet oder repariert werden soll. Ist es das Objekt selbst oder die festgelegte Ordnung, in die es eingebunden ist, oder eine noch ›größere‹ Einheit?« (Graham und Thrift 2007, 4). In Kapitel 1 gehen wir dieser Frage nach und versuchen, die Beziehung zwischen Zusammenbruch und Versagen neu zu erfassen. Da elektronische und mobile Technologien heute darauf ausgelegt sind, zu versagen, um die Kultur der Upgrades und der Ersatzbeschaffung aufrechtzuerhalten, müssen Nutzer, die ihre Geräte eigenhändig reparieren wollen, entweder einen anstrengenden und aufwendigen Kampf bestreiten oder das unvermeidliche Versagen hinnehmen, weil eine gesetzliche Verankerung des »Rechts auf Reparatur« von den Technologieunternehmen verhindert wird (Koebler 2017). Die Lebensdauer allgemein verbreiteter Technologien wie etwa Smartphones hat sich in der Folge verkürzt: In den westlichen Ländern wird ein Mobiltelefon durchschnittlich nach elf Monaten Gebrauch weggeworfen (Graham und Thrift 2007, 19). Dieses Problem hat sich im vergangenen Jahrzehnt verschärft, da die Preise für elektronische Geräte gesunken sind. In der Folge ist »der Berg von elektronischem Müll im Jahr 2016 auf 44,7 Millionen Tonnen gewachsen« (Leahy 2017).
Das zunehmende Interesse an Instandhaltung und Reparatur steht auch im Zusammenhang mit der jüngeren Literatur über »Abfall«, der häufig als Synonym für Versagen betrachtet wird (Shabi 2002; Maxwell und Miller 2012). Neben seinen verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt zeugt das exponentielle Wachstum von elektronischem Müll (oder auch »E-Müll«) davon, wie die Globalisierung und der innovationsgetriebene Kapitalismus bei der Entwicklung eines freien, offenen Marktes versagt, der potenziell Wohlstand für alle schaffen könnte. In der Praxis wird der Großteil des elektronischen Mülls im Westen produziert und »offshore« im Globalen Süden entsorgt (Leahy 2017). Wir werden hier nicht näher auf die weitreichenden Folgen der globalen Abfallwirtschaft eingehen, aber sie liefert einen wichtigen Hinweis darauf, dass »Infrastruktur ohne Instandhaltung eine Katastrophe bedeutet« (Russell und Vinsel 2018, 17). Wenn frühere Modelle für Instandhaltung und Reparatur missachtet werden oder in Vergessenheit geraten, wächst die Wahrscheinlichkeit für fortgesetztes Versagen.
Kapitelgliederung
Ausgehend von diesen vier Ansätzen vertreten wir die These, dass Versagen ein unbeständiges und variables Konzept ist. Wir begegnen Momenten des Versagens praktisch täglich, sei es in Form von digitalen Verzögerungen wie etwa der Pufferung (dem Zwischenspeichern beim Laden eines Videos) oder von Geldverlusten auf den Finanzmärkten. Die Logik und die Auswirkungen von habituellem Versagen bilden den Kern dieses Buches. In Anlehnung an Gregory Batesons berühmte Definition von »Information« als »Unterschied, der einen Unterschied macht« (1972) bezeichnen wir das habituelle Versagen, das kennzeichnend ist für die Wall Street wie für das Silicon Valley, als einen »Unterschied, der keinen Unterschied macht« (Alexander 2019), also etwas, das nichts verändert: ein Nicht-Ereignis oder die schnell vergessene Hilflosigkeit von Benutzern und Konsumenten.
Das soll nicht heißen, dass die Wall Street und das Silicon Valley die gleiche Einstellung gegenüber dem Versagen hätten. Vielmehr herrscht im Silicon Valley die Auffassung vor, dass Versagen ein Schlüssel für Innovation und Erfolg ist (wie wir in Kapitel 2 sehen werden), während die Wall Street Banker und Börsenhändler erbarmungslos bestraft, die einen Deal nicht erfolgreich über die Bühne bringen. Die praktizierten Methoden orientieren sich am »Up or Out«-Beförderungsprinzip (»Rauf oder Raus«) oder an anderen Managementtechniken. Während in den meisten Startup-Unternehmen das mögliche Scheitern einberechnet wird, wurden viele Banken nach der großen Finanzmarktkrise als »too big zu fail« eingestuft.
Die Unterschiede zwischen Silicon Valley und Wall Street sind allgemein bekannt. Das Silicon Valley setzt auf technologische Innovation und Wagniskapital. Die Wall Street hingegen lebt von der Volatilität der Finanzmärkte, den hohen und wachsenden Schulden der Konsumenten und der Unternehmen, die das weitere Wachstum des Finanzkapitals sicherstellen, sowie dem rechtlichen und regulativen Schutzschirm, der große Finanzinstitutionen gegen Zusammenbrüche absichert. Kurz gesagt, das Silicon Valley monetarisiert die technologische Innovation und die Wall Street die der Finanzwelt (wobei sich diese beiden Logiken gegenseitig stützen).
Ohne diese Unterschiede abstreiten zu wollen, arbeiten wir in der Betonung der Gemeinsamkeiten dieser beiden Welten heraus, dass deren Monetarisierung des Versagens weitreichende Auswirkungen hat. Wir beginnen in Kapitel 1 mit einer Diskussion über das Versagen in erkenntnistheoretischer Dimension und als affektive Ökonomie. Die Gemeinsamkeiten, so lautet unsere These, sind nicht zufällig: Sie beruhen auf der Tatsache, dass Silicon Valley und Wall Street sich gegenseitig bedingende Elemente eines gemeinsam genutzten Systems sind. Das Silicon Valley kann nicht ohne große liquide Kapitalpools existieren, die strategisch investiert und rasch verlagert werden können. Die Wall Street wiederum benötigt Innovationen in digitaler Technologie, um den Handel zu beschleunigen, das Volumen der Finanztransaktionen zu steigern, die diesbezüglichen Informationen als Eigentum zu beschützen und die dafür notwendigen Instrumente, Geräte und Bildschirme zu verbessern. Die symbiotische Beziehung zwischen Wall Street und Silicon Valley kann daher als bedeutsames Merkmal des modernen digitalen Kapitalismus gelten.
Anhand einer eingehenden Untersuchung der enttäuschten Versprechen von Wall Street und Silicon Valley deckt dieses Buch die bislang kaum erforschten Prozesse auf, in denen das Versagen zu einem strategischen Mittel der Verwertung umgedeutet wird. Das Versagen wird zu einer Handelsware, lautet unsere These. Dies erfolgt durch die Entwicklung einer Maschinerie gebrochener Versprechen, mittels der das Vorhandensein von Versagen bestritten oder zurückgewiesen wird, das die große Mehrheit der Bevölkerung (die 99 Prozent) erfährt. Wir entwickeln diesen Gedanken in Kapitel 1, indem wir eine dreiteilige Typologie der Versprechen und ihrer Funktion in der Welt der Finanz- und der Technologiewirtschaft vorstellen. Auf Grundlage dieser Typologie analysieren wir das Versprechen der Bequemlichkeit und Bedienungsfreundlichkeit und deren entscheidende Rolle in der digitalen Ökonomie.
Das 1. Kapitel bietet zudem eine detaillierte Theorie des Versagens. Zunächst definieren wir »Technikversagen« als Moment eines erkenntnistheoretischen Bruches, in dem kein neues Wissen über eine Maschine und damit auch kein neues Verständnis der Welt erzeugt wird. Zum anderen betrachten wir Versagen als »affektive Ökonomie«, wie Ahmed es nennt, und verbinden diese Analyse mit der strategischen Erzeugung von Vergesslichkeit durch die Wall Street und das Silicon Valley. Drittens vertreten wir die Auffassung, dass Versagen der Marktlogik des Kapitalismus und dessen Abhängigkeit von Kredit, Schulden und Derivaten inhärent ist.
Aufbauend auf Kapitel 1 und Schumpeters grundlegendem Werk legen wir in Kapitel 2 dar, dass das Versagen, das sich in den modernen digitalisierten Ökonomien entwickelt hat, eng mit Innovation, Wachstum, Profitabilität verbunden ist. Außerdem ist es verknüpft mit dem stetigen Bemühen, mögliche künftige Welten in die Gegenwart einzubeziehen, indem es antizipiert und in einer Echtzeitschleife zwischen Entwickler und Nutzer vorweggenommen wird. Das hervorstechendste Merkmal der Ideologie und des Diskurses über das Versagen, insbesondere in der Kultur des Silicon Valley, ist unmittelbar aus Schumpeters Werk abgeleitet. Es umfasst die Verwertung des Versagens, manchmal in Form von »Disruption«, am häufigsten aber in Form des Lernens, Verbesserns, Experimentierens und Risikoeingehens. In der Startup-Ökonomie hat das Versagen eine ganz besondere Bedeutung: Es meint nicht das Versagen des menschlichen Körpers, wenn ein Programmierer an seinem Arbeitsplatz zusammenbricht oder eine Call-Center-Angestellte vor dem Bildschirm einschläft. Es meint das Versagen eines sehr spezifischen Milieus, das gekennzeichnet ist durch modernste Technologie, kostengünstige Software und hohe Gewinne aus erfolgreichen Firmenübernahmen und Börsengängen im digitalen Bereich. Von dieser Betonung der Innovation und Volatilität im Kapitalismus führt eine direkte Linie zu der zentralen Möglichkeit des Versagens in den modernen Konstruktionstechnologien im postindustriellen Westen. Im Bereich der Technologie wird nicht das Versagen an sich bewundert, vielmehr gilt es als unvermeidlicher Kostenpunkt des technologischen Wandels. Das Versagen macht die Nutzer digitaler oder finanzbezogener Produkte auf diese Weise zu dauerhaften Testpersonen und Reportern, die über das Versagen berichten. Deren Verhaltensweisen, Entscheidungen, Wünsche und Bedürfnisse fließen in das Design, die Tests und Erfahrungsprotokolle ein.
In Kapitel 2, das sich auf die »Gig Economy« konzentriert, wird dargestellt, dass es in der Welt der Apps (inklusive der Startup-Firmen, die sie konstruieren, wie auch der Wagniskapitalgeber, die sie finanzieren) nicht in erster Linie um die Zerstörung alter Formen der Technologie, der Produktion oder der Arbeit geht, wenngleich sie dies unzweifelhaft befördern. Vielmehr zielen sie auf die unmittelbare Disruption vorheriger Formen von Gesellschaftlichkeit und versuchen diese durch andere zu ersetzen, indem sie eine verbesserte Effizienz und Nutzerfreundlichkeit oder beides versprechen.
Diese Analyse der veränderten sozialen Strukturen soll die Grundlage bilden für eine Diskussion über Versagen, Zusammenbruch und Erinnerung in Kapitel 3. Wir zeigen hier, wie erstaunlich oft verharmlost, ignoriert oder schlicht vergessen wird, auf welch unterschiedliche Weise Technologie versagen, defekt sein oder ihre Nutzer zur Verzweiflung treiben kann. Diese »Vergesslichkeit« ist ein Hinweis auf ein breiter angelegtes diskursives System von gesellschaftlichen Überzeugungen. Sie ist kein Beleg für das Versagen der Erinnerung, sondern eher für den Erfolg kultureller Fantasien und kollektiver Vorstellungen von technologischen Utopien. Wann und zu welchem Zweck erzählen wir uns Geschichten des Scheiterns? Und wann werden Augenblicke des Versagens als Bestandteile einer Geschichte von unbegrenztem Fortschritt maskiert oder umgedeutet?
Kapitel 3