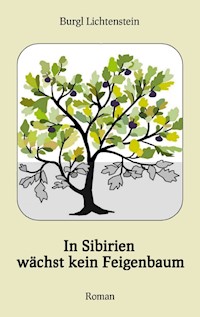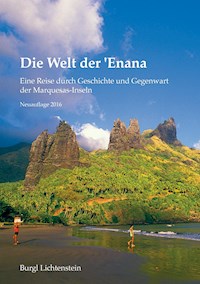Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Singleleben hat seine Tücken: Mut und Verzweiflung, Gewohnheit und Veränderung, Familie und Neustart. Nora und ihre Freundinnen sind bewusste Singles, doch dann geht der Liebeszirkus wieder von vorne los, ob in Zürich, Berlin, in der Türkei, oder irgendwo auf der Welt. Hinzu kommt eine bodenständige Familie in Köndringen am Kaiserstuhl, wo Noras exzentrische Tante für Wirbel sorgt, weil ihre Asche partout auf Madeira verstreut werden soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Autorin
Burgl Lichtenstein lebt am Zürichsee, in der Schweiz. Sie ist eine begeisterte Globetrotterin. Bisher sind von ihr drei Reisebücher erschienen. Mit dem ersten Roman »Versingelt«, verarbeitet sie Reiseerinnerungen zu einer geistreichen und unterhaltsamen Geschichte, rund um das Singledasein.
Mehr zu Burgl Lichtensteins Reisen unter: www.marquesas-brasilien.ch
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel: Raki
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Abschnitt 5
Zweites Kapitel: Kiwi
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Drittes Kapitel: Casa Nora
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Abschnitt 5
Abschnitt 6
Abschnitt 7
Abschnitt 8
Abschnitt 9
Abschnitt 10
Viertes Kapitel: Zebri
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Abschnitt 5
Fünftes Kapitel: Diogo
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Abschnitt 5
Sechstes Kapitel: Tiki
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Siebtes Kapitel: Brasil
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Achtes Kapitel: Sí, quiero
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Abschnitt 5
Abschnitt 6
Erstes Kapitel
Raki
1
Mit über 40 lässt die Spannkraft nach, man legt Pfunde zu, greift zur Faltencreme, rennt zur Kosmetikerin und verbringt viel Zeit im Fitnessstudio. So oder ähnlich kann man es jeder Frauenzeitschrift entnehmen. Dennoch schlürfte ich, als frischgebackene Singlefrau, am Samstagabend mit Genuss meinen eisgekühlten Baileys, lümmelte entspannt im bequemen, schlabbrigen Hausanzug auf dem Sofa und genoss die Freuden, konkurrenzlos durch die Fernsehprogramme zu zappen. Oft fragte ich mich, ob es nicht schon ans Unverschämte grenzt, mich so glücklich und entspannt zu fühlen und das Alleinsein als etwas absolut Befreiendes zu empfinden. In meinem eigenen Reich, das ganz nach meinen Wünschen eingerichtet war. Frische Farben, wie Birkengrün, Tintenblau, Altrosa und viel Glas, hatten braunes Leder, Eichen- und Teakholzmöbel abgelöst. Leicht, luftig und locker sollte es sein und nicht mehr an die Abende und Nächte erinnern, als der Zigarettenrauch wie dichter Nebel über allem schwebte. Weingläser mit eingetrockneten Resten herumstanden und öfters eines an die Wand flog, weil am Ende Wut und Überdruss die endlosen Diskussionen bestimmten.
Am Montagmorgen um 6.00 Uhr begann der Alltag und zwang mich in den Schraubstock des Geldverdienens. Die Alimente ging für Williams Studium drauf, der als Sohn im 4-Zimmer-Hotel Mama logierte. Mit Erfolg hatte ich mich um die Stelle als Chefsekretärin in einem Baustoffhandel beworben. Ich konnte einen grundsoliden Abschluss als Industriekauffrau vorweisen und dank meiner jahrelangen stundenweisen Arbeit in einem Vermessungsbüro, besaß ich auch Kenntnisse in der EDV. Da saß ich nun auf dem Platz einer Chefsekretärin, mit dem Willen, mir zu beweisen, dass ich durchaus fähig war, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen.
In meiner Freizeit unterrichtete ich in einem Tanzstudio Modern-, Jazz- und Bauchtanz. Ich war Mitglied einer Schreibwerkstatt, besaß das Abonnement eines Kulturkarussells und kroch mindestens einmal pro Woche mit Marco ins Bett, der mich liebte, wie er zu beteuern pflegte, aber leider verheiratet war. Wir hatten uns auf einer Baubesprechung kennengelernt, wo er als Architekt den Vorsitz führte. Er war ein attraktiver Mann und dank seiner Leidenschaft für den Triathlon, von Kopf bis Fuß durchtrainiert. Ich liebte sein herzerfrischendes Lachen, seine ungestüme Art, die sich auch in unseren Sexspielen entlud. Dass er acht Jahre jünger war als ich, schmälerte die Freude nicht, brachte aber die Vernunft nie aus dem Spiel. Wenn er aus dem warmen Bett stieg, um zu Frau und Kindern zu eilen, wünschte ich mir regelmäßig einen Unverheirateten, der die Nacht über bleibt und mit in die Ferien kommt.
Wenn ich unter etwas litt, dann waren es die trostlosen, verregneten Sonntage, die Elsie, meine Nachbarin, auch nicht vergnüglicher zu gestalten wusste. Sie war auch Single und sah in uns so etwas wie ›Schwestern im Geiste.‹ Ihre Lieblingslektüre war die Wochenendausgabe des Tagesanzeigers, mit den Rubriken: Sie sucht Ihn und Er sucht Sie. Auch für mich fand Elsie immer das Passende. Zum Beispiel:
Du oder keine. Willst Du (40–50 J.) mit einem noch Jungsechziger, CH-Geschäftsmann, vermögend, kultiviert, das Leben teilen, die Liebe genießen? Du bist naturliebend, sportlich, hast Freude am Joggen, Radfahren, Schwimmen und Wandern. Du kuschelst gerne und liebst die Erotik, die uns in den siebten Himmel der Liebe führt. Dann trau Dich und eile in meine sehnsüchtig ausgebreiteten Arme. Unter Chiffre...
Weil ich weder die Lust am Eilen, noch nach 60-jährigen Armen verspürte, musste der CH-Geschäftsmann auf mich verzichten und Elsie klappte einmal mehr die Zeitung enttäuscht zusammen. Elsie war süchtig nach diesen Inseraten, die ihr den Traummann bringen sollten, nachdem sie schmählich im Stich gelassen worden war. Zuerst vom Ehemann, der einer heimtückischen Krankheit erlag und danach von Freund Gusti, mit dem sie ihn betrogen hatte. Als die legitime Zeit mit Gusti gekommen schien, zog er sich in kleinen Schritten zurück. Zuerst weinte sich Elsie die Augen aus, dann fuhr sie auf Kontaktanzeigen ab.
Einige Tage nach unserem letzten Zusammentreffen rief mich Elsie an. Ihre Stimme war heiser und verschnupft, aber dennoch aufgedreht.
»Nora, du bist die Erste die es erfährt. Ich habe mich verliebt.«
»In deinen Hausarzt?«
»Nein, zuerst in eine Annonce und dann in den Mann, der dahintersteckt. In seine samtige Stimme, die so ruhig, besonnen, kultiviert klang und einen umwerfenden Akzent hatte. Du glaubst es nicht, aber wir verstanden uns schon nach den ersten Worten.«
»Wie alt ist er, was macht er und wo kommt er her?«
»Er ist so alt wie ich, 46, von Beruf Diplomat und kommt aus dem Iran.«
»Versteh ich dich richtig, ein Perser? Und wie sieht er aus, weißt du das auch schon?«
»Eben nicht, deswegen rufe ich ja an. Ich liege mit einer Grippe im Bett und auf meiner Nase thront ein eitriger Pickel. Könntest du nicht für mich zum vereinbarten Rendezvous gehen und mich bei ihm entschuldigen?«
»Wann?«, fragte ich.
»Morgen, um 19.00 Uhr, am Bahnhof Stadelhofen in Zürich, mit der Neuen Zürcher Zeitung unter dem Arm.«
»Elsie, denk an Nicht ohne meine Tochter.«.
»Wieso? Ich bekomme keine Kinder mehr. Gehst du jetzt oder gehst du nicht?«
»Okay, wird erledigt. Hast du überhaupt genügend Mäntel und Kopftücher?«
»Warum?«
»Die brauchst du im Iran.«
»Miesmacherin!«
Es schmerzte, Elsie berichten zu müssen, dass um 19.00 Uhr ein ungepflegter Schnauzbärtiger am vereinbarten Treffpunkt erschienen war. Sein rosaroter reinigungsbedürftiger Blazer, die schwarzen Ränder am Kragen seines weißen Hemdes und die zerknitterte graue Hose, im Schnitt schon längst aus der Mode gekommen, zeugten nicht eben von einem Diplomatenstatus. Als ich den Wartenden fragte, ob er mir den Weg zum Kreuzplatz weisen könnte, kam ein stinkender Hauch Atem aus seinem Mund. Weil ich wusste, wie oft Elsie ihre Zähne putzt und Mundspray verwendet, konnte ich ihr nur den Rat geben, doch weiter Ausschau zu halten und sich mit etwas Bescheidenerem, als einem Diplomaten, zufriedenzugeben.
An diesem Abend tat es besonders gut, mit meiner ungarischen Freundin, durch die Zürcher Altstadt zu bummeln. Viera war eine sinnliche Schönheit. Ihr Gesicht mit hohen Wangenknochen, leicht schräg gestellten bernsteinfarbenen Augen, vollen Lippen und einer Flut kastanienbrauner lockiger Haare, zog die Männer an, wie das Licht die Motten. Ich war das pure Gegenteil: 1.76 m groß, kurz geschnittene Haare, knabenhafte Figur und schmales Gesicht mit olivgrünen Kulleraugen. Koboldmaki nannte mich Zwillingsbruder Tom, für Mutter war ich Audrey Hepburn. Wir verbrachten einen unterhaltsamen Abend, bis zu später Stunde ein älterer Herr erschien, der zu Vieras auserlesener männlicher Kundschaft zählte. Sie stockte ihr mageres Einkommen, aus dem Verkauf von handgefertigten Lampenschirmen, mit lukrativen Liebesdiensten auf.
2
Es schien ein vielversprechender Sommertag zu werden, wie man ihn für den 1. August, den Nationalfeiertag, erhofft. Schon morgens um 7.00 Uhr saß ich am See. Die Wellen kräuselten sich im leichten Wind. Hinter ihrer majestätisch dahin gleitenden Mutter, kehrten Entenküken von ihrem Ausflug zurück. Im nahen Schilf tummelten sich Frösche, Libellen und Vögel. Fischschwärme sprangen erschreckt aus dem Wasser, wenn ein räuberischer Hecht Jagd auf sie machte. Aber selbst an diesem perfekten Sommermorgen brauchte es Überwindung, in das kühle Nass zu tauchen, das den Atem für einen kurzen Moment stocken ließ. Danach zählte nur noch die Begeisterung für diesen jungen und schönen Tag. Um die Ruhe war es geschehen, als die ersten Badegäste ihre Stammplätze belegten und den neusten Klatsch zu erzählen begannen. Nicht daran interessiert, packte ich meine Badesachen zusammen und radelte nachhause. Kurz darauf rief mich Anita, eine Bekannte aus dem Tanzstudio an und lud mich zu einer Waldfete des Singleclubs Aurora ein.
»Sind auch Nichtmitglieder willkommen?«, fragte ich verdutzt.
»Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Du kannst immer noch Mitglied werden. Ich hole dich um 18.00 Uhr ab. Bist du damit einverstanden?«
Spontan sagte ich zu, denn es war immer noch die bessere Lösung, als den Abend allein, oder am Gemeinschaftsgrill mit den Hausbewohnern zu verbringen. Die lüsternen Blicke zu spüren, wenn den Männern der Alkohol in Kopf und Glieder steigt.
Anita erschien pünktlich. Weil sie mir den Abend als Freizeitvergnügen geschildert hatte, trug ich Bermudas und T-Shirt. Sie hingegen steckte in einer weißen schicken Bügelfaltenhose, mit einem dazu passenden, mit Glimmer besticktem Top, welches ihre weiblichen Kurven hervorragend zur Geltung brachte.
Es war ein perfekter Sommerabend geworden, den die Sonne mit einem warmen und goldenen Licht überzog. Nach einer guten Stunde hatten wir die Waldlichtung erreicht. Mit widerstreitenden Gefühlen stapfte ich hinter Anita auf die Aurora-Mitglieder zu, die sich geschlechtergetrennt in zwei Gruppen gegenüber standen, was mir in Bezug auf die Absicht des Treffens als kontraproduktiv erschien. Ein dazwischen herumwuselnder kleiner Dicker mit Glatze, rostroter Hose und giftgrünem Hemd, entpuppte sich als der Chef des Unternehmens, der als Partnerin eine junge Thailänderin dabei hatte.
»Er hat sie vor kurzem aus seinem Urlaub mitgebracht«, klärte mich Anita kichernd auf.
»Schlechtes Geschäftsgebaren. Wie heißt er eigentlich?«
»Casey.«
»Wie bitte?«
»Na ja, sein richtiger Name ist Kasimir Schlegelberger.«
Peinlich wurde es, als ich Frieder, dem Berufsberater aus St. Gallen gegenüberstand. Ich hatte ihn während einer Radrundfahrt durch die Provence kennengelernt. Damals hatte er sich allerdings als überstrapazierter Mann präsentiert, dem drei Frauen ein aufreibendes Liebesleben aufzwangen, wovon er Erholung suchte.
»Drei?«, fragten wir uns zweifelnd, weil wir dem faden Typ so viel Potenz einfach nicht zubilligen wollten.
»Hallo Frieder, so trifft man sich wieder«, begrüßte ich ihn mit freundschaftlichem Händedruck.
»Sorry, keine Ahnung, wer sie sind.«
»Aber ich weiß, wer du bist«, raunte ich ihm ins Ohr und wandte mich dem Nächsten zu.
Nachdem das Händeschütteln vorüber war, griff Casey mit einem Megaphon wieder ins Geschehen ein: »Wir beginnen unseren fidelen Abend mit einem Warm-up und benutzen den dafür aufgebauten Parcours. Immer sechs zusammen, aber gemischt«, dröhnte es über die Waldlichtung.
»Sind wir hier im Turnen für Jedermann, oder bei einem Leistungstest?«, fragte ich Anita pikiert, die ratlos mit den Schultern zuckte.
Während der nächsten Stunde beherrschte dann sportliches Treiben den Singletreff, dem sich die vorwiegend festlich gekleideten Herrschaften nur widerwillig stellten.
Schon immer gut im Seilspringen, verschaffte ich unserer Gruppe einen beachtlichen Punktevorsprung, den aber Bruno, ein plumper, schwergewichtiger Mann um die 30, wieder verspielte. Beim Tretrollerrennen verhaspelten sich seine Beine und er purzelte mitsamt dem Sportgerät kopfüber in den Wald. Von da an hatte Bruno genug von diesem ›Füdli-Seich‹, was unserer Gruppe das ultimative Tabellenende bescherte. Sieger des Abends war die Gruppe von Anita, zu der ein großgewachsener Balkan-Gigolo gehörte, der sportlich voll drauf war und von Anita dreist angemacht wurde. Als Siegerpreis winkte ein 6er-Karton Piccolos, Marke Fürst Metternich.
Eilfertige Frauen tischten danach appetitlich hergerichtete Salatplatten, selbstgebackenes Brot und andere Köstlichkeiten auf. Der Applaus war verdient. Meine Bemerkung, dass zumindest die nach Hausmütterchen Ausschau haltenden Aurora-Singlemänner jetzt wissen, wem sie den Hof zu machen haben, brachte mir reihum strafende Blicke ein.
Bruno, der neben mir saß, betrachtete mich bereits als erobert. »Bei ihr ging es ruck zuck«, raunte er einem Artgenossen zu und verwies mit einem abgenagten Pouletschenkel, an dem eine tropfende Gurkenscheibe baumelte, zu einer Bank am Waldesrand, wo er mit mir, seiner Braut, den restlichen Abend knutschend verbringen wollte. Als Bestätigung klatschte er mir einen Kuss auf die Wange, der Spuren von Karottensalat hinterließ. Mit einem donnernden Rülpser und einem nicht minder lauten Furz, markierte Bruno dann ungeniert das Ende seiner ausgiebigen Verköstigung.
Worauf am Tisch nebenan eine heftige Diskussion über die Frage entbrannte, ob man nicht gewisse Anstandskriterien bei der Aufnahme von Mitgliedern voraussetzen sollte, denn immerhin hege man edle und niveauvolle Absichten.
Inzwischen brannte auch hier ein kleines Höhenfeuer. Statt einer patriotischen Rede, vielleicht über angeknackste Schweizer Frauen- und Männerherzen, bat Casey zum Tanz. Fünf Paare folgten der Aufforderung. Unter ihnen auch Anita mit ihrem Dragan und Bruno mit einer anderen, weil ich ihm einen Korb gegeben hatte. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, sang Roy Black. Laut und falsch sang auch Bruno, der immer wieder einen vorwurfsvollen Blick in meine Richtung sandte. Dann schluchzte Elvis, Love me tender, Love me sweet, Drafi Deutscher beschwor, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht und ich hatte endgültig die Nase voll von diesem Klamauk. Ich suchte mir einen ruhigen Platz mit Blick ins Tal und hoffte, dass dieser Abend bald sein Ende finden möge. Diese Hoffnung löste sich schnell auf, als ich über mir Anita, engumschlungen mit dem neuen Lover, im Wald verschwinden sah. Ich wusste, dass die Nacht noch dauern wird. Mein Stimmungsbarometer sank unter Null.
Es wurde empfindlich kühl. Am Feuer schnarchte Bruno und daneben hatte sich zusammengefunden, was um alles in der Welt verkuppelt werden wollte. Die Idee, mich zu Fuß zur nächsten Ortschaft aufzumachen, um mit einem Taxi nach Hause zu fahren, schien immer verlockender. Aber welchen Weg musste ich einschlagen? Ich begab mich auf die Suche nach Casey. Unter den tiefhängenden Ästen einer Tanne stöberte ich ihn auf. Schmatzend saugte er an den Brüsten seiner Thai-Frau. Sein feuchter aufgestellter Schwanz ragte markant aus dem geöffneten Hosenschlitz und seine fahrigen Hände zerrten gierig am Tanga seiner Gespielin, die es gelassen hinnahm. Desinteressiert glotzte sie in die Baumkronen und kreiste träge mit dem Unterleib.
»Bitte, könnten sie mir sagen, wie ich auf dem schnellsten Weg in die nächste Ortschaft komme?«, unterbrach ich sein Tun.
Zweimal musste ich die Frage wiederholen, dann meinte der geile Casey endlich: »Hää?«, und gaffte mich blöde an.
«Fick weiter Dicker und vergiss es.«
Resigniert kehrte ich an meinen Platz zurück, wo kurz darauf Anita erschien. Ihr Anzug war von Gras- und sie von Knutschflecken gezeichnet. In ihren Armen hing ein schlapper Dragan.
»Das wäre es dann wohl gewesen, Anita.«
Es blieben die einzigen Worte, die auf der Heimfahrt zwischen uns gewechselt wurden.
Lange Zeit saß ich zuhause auf meinem heimeligen Balkon, blickte auf den See, über den der Mond eine silberne Schleppe gezogen hatte.
»Nora«, mahnte die innere Stimme. »Das ist der falsche Weg. Lass kommen was will, aber bleib dir um Himmelswillen treu.«
3
Der Kakaofleck auf meinem zitronengelben Leinenkleid war immer noch da, aber jetzt störte er nicht mehr. Ich befand mich irgendwo in einem Zürcher Außenquartier und wartete auf ein öffentliches Verkehrsmittel, das mich zum Hauptbahnhof bringen sollte. Ich hatte meine dritte und letzte Fahrprüfung soeben in den Sand gesetzt.
»Zu einem unabhängigen Leben gehört ein eigenes Auto«, befanden unsere Eltern und schenkten mir einen fabrikneuen Opel Corsa.
Das zähe Ringen um den Führerschein begann. Drei Fahrlehrer mühten sich mit mir ab. Trotzdem vergeigte ich die beiden ersten Prüfungen.
»Ist Autofahren eine Frage der Intelligenz?«, fragte ich verunsichert Zwilling Tom.
»Nein, es ist nur eine Sache der Konzentration und des Wollens.«
Genau da lag der Hund begraben. Ich hatte nie den Wunsch verspürt, einen Führerschein zu besitzen. Trotzdem übte ich auf die dritte Prüfung tapfer weiter, welche an einem brütendheißen Montagnachmittag stattfand. Hypernervös saß ich am Morgen im Büro, unfähig mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Um 13.00 Uhr brachte mich der Zug nach Zürich. Mein Magen war wie zugeschnürt, nur ein Becher heiße Schokolade schien verträglich, die sich prompt über mein zitronengelbes Kleid ergoss. Ich war drauf und dran aufzugeben.
Gleichwohl traf ich mit meinem Fahrlehrer, zur vereinbarten Zeit, beim Straßenverkehrsamt ein. Er überließ mir das Auto und wünschte viel Erfolg, ohne dass wir daran glaubten.
»Grüezi, mein Name ist Streuli«, stellte sich der dritte Experte vor.
Ich blickte in ein gerötetes, stumpfes Gesicht. Auf der Stirn standen Schweißtropfen und aus dem offenen karierten Hemd kräuselten sich rote verklebte Haare. Das Auto ächzte, als sich der schwerfällige Herr Streuli hineinfallen ließ.
»Haben wir das in der Fahrschule gelernt?«, fuhr mich der Experte schon nach wenigen Metern an, als ich mit überkreuzenden Armen das Lenkrad bediente.
»Natürlich nicht. Entschuldigung.«
»Und geht es nicht ein bisschen schneller, allez hopp und nicht schlafen.«
Mein Adrenalin sandte bereits verhaltene Zeichen, welche sich mit dem penetranten Schweißgeruch aus den Achselhöhlen des Herrn Streuli nur schlecht vertrugen.
»Jetzt die Fahrspur wechseln. Ja ›Gopfridschtutz‹, können sie nicht aufpassen? Biegen sie rechts ab und fahren sie bis zur Querstraße. Anhalten!«
Wir standen, aber schräg, was schon wieder als Minuspunkt gewertet wurde.
»Und jetzt fahren sie rückwärts, bis zur nächsten Straßenkreuzung.«
Das war entschieden zu viel. Mein Hirn klinkte sich verkehrstechnisch aus. Es erinnerte sich an Kochrezepte, Keller ausmisten, Glückwunschkarte für die Tante zum 80. Geburtstag besorgen und summte dabei: Ich han en Schutz am schöne Zürisee, so gits keine meh, ho du li ho. Wie es schien, näherte ich mich zielstrebig dem Irrsinn.
Bis sich ein Gedanke formierte, der immer konkreter wurde. Augenblicklich entspannten sich meine verkrampften Hände und gaben das Lenkrad frei. Dann wandte ich mich dem Experten zu. Mein Blick verfing sich in seinen verkniffenen und plötzlich auch ratlosen Augen.
»Herr Streuli«, sagte ich höflich. »Ich danke ihnen, dass sie mich bis hierher begleitet haben. Ihre charmante Art hat mich überzeugt, auch ohne Führerschein leben zu können und deshalb bitte ich sie, diese Fahrprüfung alleine zu Ende zu bringen. Adieu und einen schönen Abend noch.«
Sein dümmlicher, fassungsloser Gesichtsausdruck versüßte den Abgang ungemein.
Nach mehrmaligem Umsteigen erreichte ich mit Bus und Straßenbahn den Hauptbahnhof, wo die S-Bahn, wie zur Bestätigung meiner Entscheidung, pünktlich vorfuhr.
Zu Hause erwartete mich ein Rosenstrauß von Marco und auf dem Anrufbeantworter die Glückwünsche vom Zwilling. Gleichzeitig stürmte William in die Wohnung: »Gratuliere, war doch überhaupt nicht schwer, komm, lass uns irgendwohin fahren und dick essen gehen. Oder hast du die Prüfung schon wieder geschmissen?«
Ich nickte bestätigend.
Wie immer in solchen Situationen war Verlass auf unsere Eltern. Sie ersparten mir Vorwürfe und amüsierten sich über meinen Abgang. Weil William einen Führerschein besaß, aber kein Auto, vollzog sich, mit ihrem Einverständnis, der Besitzerwechsel noch am gleichen Abend. Auf Williams Ehrenwort, dass er mir stets als Chauffeur zur Verfügung stehen wird, griff ich auf Goethe zurück: Die Botschaft hör ich wohl, jedoch mir fehlt der Glaube.
Zwei Wochen später kaufte ich mir ein superleichtes, mit allen technischen Raffinessen ausgestattetes Rennrad. Nirgendwo konnte ich mich besser entspannen, als wenn ich durch begeisternde Landschaften radelte, oder Pässe hinaufstrampelte, um mich selbst zu besiegen. Ein ebenso großes, wenn auch zugegeben fragwürdiges Vergnügen, bereitete es mir, Katz und Maus mit den ehrgeizigen Macho-Typen zu spielen, die mit ihren Gattinnen im Schlepptau, keine Überholmanöver von Radfahrerinnen duldeten, da man doch die Angetraute fest im ›Windschatten-Griff‹ hatte. Bewusst legte ich es darauf an, die mit Testosteron gedopten Schrittmacher an mein Hinterrad zu locken, sie abzuhängen und wieder heran keuchen zu lassen. Verwünschungen blieben nicht aus. Traf man sich später im Bergrestaurant wieder, ging der ›Geschlagene‹ meistens dazu über, Avancen zu machen.
4
Es war ein trüber Sonntagmorgen im November, als ich zu meiner letzten Radtour aufbrach. Der See, von Nebelschwaden überzogen, zeigte sich in einem tristen Grau und passte zu meiner Seelenlage. Am Abend zuvor hatte mich William informiert, dass er sich endgültig für den Auslandsdienst in einem international tätigen Schweizer-Unternehmen entschieden hat. Schon in zwei Wochen wird er seinen Chef nach China begleiten, um dann eine Stelle als Volontär in Singapur anzutreten.
Gedankenversunken fuhr ich dem oberen Zürichsee entlang. Mein Ziel war die Linthebene, wo ich dem gleichnamigen Kanal folgen wollte. Es waren nur noch wenige Radfahrer unterwegs, die sich tapfer dem Gegenwind stellten. Ein schmaler Kiesweg schien mir verlockender, da er mit seinen dichten Bäumen besseren Schutz vor dem Wind versprach.
»Unterschätze die spitzen Steine nicht. Hast du jemals einen Reifenwechsel geübt, denn weit und breit ist niemand zu sehen, der dir helfen könnte?«, mahnte die innere Stimme.
Sie sollte recht behalten. Nach nur wenigen Metern kam das gefürchtete ›Ziiisch.‹ Ich stieg vom Rad und sah die Bescherung. Das Hinterrad war platt.
Schon von weitem hörte ich ihn pfeifen, melodisch schön mit Mozarts Türkischem Marsch. Provozierend locker saß er auf seinem Rennrad und winkte freundlich über den schmalen Nebenkanal zu mir hinüber. Meine neidischen Blicke bohrten sich in seinen Rücken. Dann trollte ich mich davon.
Und wieder drang der Türkische Marsch an mein Ohr. Dieses Mal vermischt mit dem Knirschen von Kies. Kurz darauf bog der Strahlemann von vorhin um die Ecke und hielt bei mir an.
»Probleme?«, fragte er.
»Und wie«, hauchte ich bekümmert, bevor ich ihm das Rad überließ.
Geübt machte er sich daran zu schaffen und mir blieb Zeit, ihn genauer zu mustern. Vor mir kniete ein erstaunlich gut aussehender Mann. An die zwei Meter groß, schlank, durchtrainiert und mit dichten graumelierten kurzgeschnittenen Haaren. Ich schätzte ihn um die 50. Das Netz kleiner Fältchen um seine schiefergrauen Augen ließ darauf schließen.
»Himmel, was für ein Mann«, durchfuhr es mich wie ein Blitz. Worauf sich die innere Stimme ruck zuck meldete. »Lass es bloß dabei bewenden, du ersparst dir Kummer.« Was zwecklos war.
Als wir uns anlächelten, verfingen sich unsere Blicke und bescherten wohlige Gänsehaut.
Es hatte gerademal 10 Minuten gedauert, bis mein Rad wieder fahrtüchtig war. Im Überschwang meiner Gefühle lud ich den Ritter der Landstraße wahlweise zu Bier, Wein, Mineralwasser, Kaffee, Suppe oder was auch immer, ein. Er nahm mein Angebot lachend an und stellte sich als Luk Koller vor.
»Und ich bin Nora Beck.«
Mit dem Rückenwind war das Radeln dann wieder das pure Vergnügen. Zum Türkischen Marsch gesellte sich falsch und laut Auf in den Kampf, Torero.
Unser Mittagessen zog sich in die Länge. Wir redeten über alle möglichen Dinge. Stellten die gleichen Vorlieben für Autoren und Bücher fest, liebten den Sport und die Musik, von Klassik über Jazz bis zur Rockmusik. Allen voran Bruce Springsteen, dessen Song Born to Run wir gemeinsam zu summen begannen. Luks Leidenschaft, auf einer Harley Davidson Kontinente zu durchqueren, war mir zwar fremd, aber seine Erzählweise, gespickt mit hintergründigem Humor, gefiel mir so gut, dass es keine Minute langweilig wurde. Kurzum, ich wünschte mir, dass dieser Nachmittag nie ein Ende finden möge. Das lag ganz in unseren Händen, denn nebenbei erfuhr ich, dass niemand zuhause auf ihn wartete, genauso wenig wie bei mir.
Als dicke Regentropfen an die Scheiben klatschten, drängte sich die Heimfahrt in den Vordergrund. Eine Vorstellung, die mich schaudern ließ. Mein betretenes Mienenspiel zauberte ein beruhigendes Lächeln auf Luks Gesicht. Er hätte ganz in der Nähe seinen Kombi geparkt, worin auch ein zweites Rad Platz finden würde und da wir ja nur vier Ortschaften auseinander wohnen, wäre es keinen Umweg für ihn, mich nachhause zu fahren.
»Du hast dich vorher mit Koller vorgestellt?« Plötzlich dämmerte es mir. »Bist du nicht der neue Eigentümer der bekannten Buchbinderei Koller und ein nicht minder bekannter Fernsehjournalist, über den vor kurzem in einer Tageszeitung eine lange Reportage erschienen ist? Deshalb warst du mir von Anfang an so vertraut.«
»Vertraut, nur deswegen?«
»Quatsch. Weil du ein Genie im Hinterradflicken bist.«
Dann übermannten mich die Gefühle. Mit aller Hingabe und geschlossenen Augen küsste ich ihn über den Tisch hinweg auf den Mund, ließ meine Zunge spielen und stieß auf Erwiderung. Erschrocken sahen wir uns an.
In der Intimität seines Autos war die Vertrautheit dann auf einmal wie weggeblasen. Schweigend brachten wir die Heimfahrt hinter uns. Der Abschied bestand aus einem hastigen Händedruck und einem knappen »Auf Wiedersehen.« Ich spurtete in den Radkeller und Luk entschwand hinter einem Regenschleier.
Auf Wiedersehen? Eine Floskel, die mir den Rest des Abends keine Ruhe ließ. Ob im wohltuend heißen Schaumbad, oder beim gemütlichen Entspannen auf der Couch. Selbst die stimulierende Wirkung eines Baileys holte das »Auf Wiedersehen« nicht aus seiner nebulösen Bedeutung. Zwei alte Bücher, aus der Hinterlassenschaft meiner Großmutter, zündeten den Geistesfunken, wie ein Wiedersehen herbeigeführt werden könnte. Dabei handelte es sich um die Zweitausgabe der Grimms Märchen aus dem Jahr 1912 und Das Palmengärtlein von 1826. Beide hatten eine Erneuerung der Buchdeckel dringend nötig. Glücklich über diesen Einfall leerte ich die Likörflasche bis zum letzten Tropfen.
»Mam, du bist echt besoffen«, fand der heimkehrende Sohn.
»Kann sein«, lallte ich mit schwerer Zunge. »Schuld daran bin nicht ich, sondern mein Rennrad, die Linthebene, ein spitzer Stein, ein Loch im Hinterrad und ein sehr sympathischer, umwerfend gut aussehender Mann, in den ich mich sehr wahrscheinlich verliebt habe.«
»Oh je, das kann ja heiter werden«, bemerkte darauf der Sohn spitz und knallte sich einen Teller Spaghetti in die Mikrowelle.
Sechs Wochen später. Luk hatte sich nicht mehr gemeldet und war als ›Sieben-Tage-Wunder‹ abgelegt worden. Das Palmengärtlein und Grimms Märchen standen wieder an ihrem alten Platz. Der Winter, mit seinen grauen Tagen, die am See mit dickem, undurchdringlichem Nebel besonders deprimierend sind, zog mir eine Mütze der Resignation über. William befand sich seit zwei Wochen in China. Ein Lebenszeichen von ihm war längst überfallig. Ich wurde zum Workaholic, ließ mich mit Arbeit überhäufen und stand unter Dauerstress. Die gesundheitlichen Probleme nahmen beängstigende Formen an. Tinitus, Herzrasen und Angstzustände zwangen mich auf eine Tournee durch verschiedene Arztpraxen. Die Medikamentensammlung wuchs von Tag zu Tag. Meditation rieten die einen, eine Kneippkur die anderen, Burnout stellte der Zwilling fest.
Der einzige Lichtblick war Viera. Bei ihr fühlte ich mich wohl und vergaß meinen Seelenschmetter.
»Was dir fehlt ist ein Tapetenwechsel und den werden wir an Weihnachten vornehmen«, beschied sie eines Abends rigoros.
»Und wo, wenn ich fragen darf?«
Bei Viera lagen Berge von Reisekatalogen herum. Sie griff wahllos nach einem.
»Was hältst du von Wandern und Kultur in der Südtürkei? Aufgrund der Reisebeschreibung herrschen dort auch im Winter angenehme Temperaturen.«
Ich zeigte mich mit allem einverstanden.
5
W ie vereinbart, zog ich am Heiligen Abend zu Viera. Wir verbrachten einen gemütlichen Abend und als dann auch noch William anrief, war meine Welt in Ordnung. Um 7.00 Uhr, am nächsten Morgen, verließen wir das Haus. Der Taxifahrer war ein Türke.
Unsere Reisegruppe bestand aus zwölf Personen. Darunter zwei Ehepaare, der Rest waren Singles. Das Alter lag schätzungsweise zwischen 30 und 70 Jahren. Sie alle trugen solide Wanderkleidung, im Gegensatz zur Reiseleiterin Laura Bitterli, die mit ihrem verknitterten Anzug den Eindruck erweckte, als wäre sie geradewegs von einer Party gekommen. Opium Eau de Parfum überdeckte nur mangelhaft den schalen Geruch einer Alkoholfahne.
»Das kann ja heiter werden«, flüsterte ich Viera zu.
»Wir schaffen das«, beruhigte sie und legte ihren Arm um mich. Was ein männliches Mitglied unseres Wandervogel-Vereins mit verkniffener Miene beobachtete.
»Lesben«, strahlte ich ihn an, was ihn abrupt zur Seite blicken ließ.
In Antalya schien die Sonne und die Temperatur war frühlingshaft. Als alle im Besitz ihres Gepäcks waren, marschierten wir zielstrebig zu einem Bus, vor dem zwei Männer auf uns warteten. Der eine groß, spindeldürr, mit kantigen Gesichtszügen, lockigen, langen Haaren, hieß Kemal und war als Kunsthistoriker zuständig für die Führungen auf den antiken Stätten. Metin, gedrungen, mit krausen schwarzen Haaren und einem prächtigen Schnauz, fuhr den Bus. Es reichte nur für eine knappe Begrüßung, denn Laura drängte zum Einsteigen, um vor dem chaotischen Abendverkehr das Hotel zu erreichen. Es lag am Rande der Altstadt.
Nachdem wir unser Zimmer bezogen hatten, stürzten wir uns heißhungrig auf das Abendbuffet, um später in der Bar mit dem Nationalgetränk Raki Bekanntschaft zu schließen. Kemal und Metin leisteten Gesellschaft. Dabei erlag ich zusehends Metins Charme, dessen türkischdeutscher Mutterwitz mir Lachtränen bescherte.
Als ich am frühen Morgen erwachte, nahm ich mir vor, diesen Urlaub in vollen Zügen zu genießen und keinerlei Gedanken an das zu verschwenden, was sich Zuhause an ungelösten Problemen tummelt. Damit dies keine leeren Worte blieben, setzte ich ein lautes »Basta!« dahinter, was Viera erschreckt aus dem Schlaf riss.
Antalya hatten wir hinter uns gelassen und fuhren dem National Park Düzlercam entgegen, der nach Laura, nicht nur wegen seinen uralten Fichten- und Pinienwälder, sondern auch wegen der berühmten Güver-Schlucht, ein Muss für jeden Wanderer sei.
»Wer die Aussichtsplattform, direkt über dem Abgrund des Canyons betreten möchte, sollte allerdings schwindelfrei sein. Der Blick auf die bizarren Felslandschaften lässt einem den Atem stocken«, schloss sie ihre Erklärungen.
»Allzu schwierig dürfte diese Wanderung dennoch nicht sein«, bemerkte Ruth neben mir, deren Blick sich auf die Kleidung unserer Wanderführerin konzentrierte. Sie trug hellblaue Röhrchenjeans und weiße Stiefeletten.
Zusammen mit Claudia und Ruth marschierten wir von Anfang an munter drauf los. Mit beiden hatten wir uns während des Fluges bekanntgemacht. Claudia war Physiotherapeutin und Ruth eine pensionierte Geschichtslehrerin, mit Fachgebiet Osmanisches Reich. Sie nahm diese Reise zum Anlass, einen emeritierten Geschichtsprofessor in Antalya zu treffen, den sie bei einem Symposium kennengelernt hatte.
»Wenn ihr wollt, könnt ihr mich heute Abend zu unserem Treffen begleiten. Tarik ist ein charmanter, geistvoller Mann und kann wunderbar erzählen«, schlug sie vor.
»Klar, wenn wir nicht stören«, stimmten wir zu.
Dem Wanderweg zu folgen war kein Problem. Wir orientierten uns an den roten Punkten, die das Reiseunternehmen an die Bäume gepinselt hatte. Der harzige Duft der Fichten und Pinien erfreute die Lungen und die Schlucht beeindruckte durch bizarre Felsen.
Als wir lange vor den anderen beim Bus eintrafen, wurden wir von Metin stirnrunzelnd empfangen: »Merkt euch, immer bei der Chefin bleiben. Sonst, sie wird ganz unzivilisiert.«
Was sie dann auch tatsächlich wurde. Ihren Anpfiff vor versammelter Mannschaft steckten wir ohne Widerrede weg, auch wenn es schwerfiel.
Nach einem einfachen Mittagessen, kehrten wir im Laufe des Nachmittags wieder nach Antalya zurück. Dort übernahm Kemal die Führung durch die Altstadt. Aus dem kahlen, kalten Winter kommend, war das Grün der Gärten, mit Koniferen, blühenden Hibiskushecken und früchtetragenden Orangenbäumen einfach überwältigend. In den engen Gassen fanden sich kleine Restaurants, Werkstätten, Schmuck-, Souvenir- und Teppichläden. Als wir während unseres Rundgangs zum dritten Mal an einem Teppichgeschäft mit besonders edlen Teppichen vorbeispazierten, schubste mich Viera kurzerhand hinein. Mir war ihre Vorliebe für Teppiche bekannt. Hier schien sie am Ziel ihrer Träume zu sein. Sie gab sich begeistert der Teppichwunderwelt hin. Je länger, je mehr auch dem Charme des gutaussehenden Teppichhändlers, der nahezu perfekt Deutsch sprach. Weder an Orientteppichen, noch an Teppichhändlern interessiert, blieb mir nichts anderes übrig, als meine Zeit mit Teetrinken und Knabbern von Pistazienkernen zu vertreiben. Als wir den Laden verließen, verabschiedete sich der schöne Teppichhändler bei Viera mit einem auffallend langen Handkuss und sehnte mit belegter Stimme ein Wiedersehen herbei. Was die sonst ›männersouveräne‹ Freundin so durcheinanderbrachte, dass ihr nicht einmal mehr der Name unseres Hotels einfiel.
Wie vereinbart, begleiteten wir am Abend Ruth zum Treffen mit ihrem Freund Tarik, der ein kleines verstecktes Restaurant in der Altstadt ausgesucht hatte. Wir trafen auf einen charmanten, eleganten, vom Alter leicht gebeugten Mann, der uns mit vollendeter Noblesse begrüßte. Als wir uns gesetzt hatten, hieß er den Kellner, eine Flasche Raki bringen.
»Keine Sorge meine Damen«, beruhigte Tarik lachend, als er unsere erstaunten Gesichter sah. »Raki ist die Milch des Löwen. Sie werden sich wunderbar entspannt fühlen.«
Er sollte Recht behalten. Es wurde ein sehr vergnügter Abend, denn Tarik war ein begnadeter Erzähler und entlockte uns Lachsalven, die nicht enden wollten. Mit der ›Milch des Löwen‹ im Blut, fanden wir erst nach dem dritten Anlauf den Weg ins Hotel, wo Laura Bitterli hastig mit einer Flasche Wein im Lift verschwand.
»Hab ich mir doch gedacht«, murmelte Ruth.
»Ich auch«, raunte Viera.
Der Tag war kalt und trüb, als wir zur antiken Stadt Perge aufbrachen, die mich mit ihren antiken Monumenten total begeisterte. Kemal erzählte lebendig und anschaulich, wurde aber durch dümmliche Zwischenfragen ständig unterbrochen, auf die Laura geschwätzig einging. Unbemerkt stahl ich mich davon und suchte mir einen Platz auf einem der oberen Ränge des Stadions, wo ich mich in meinen Du Mont Reiseführer vertiefte.
Aus meiner Beschaulichkeit riss mich Doris, die auf der Suche nach versprengten Wandervögeln war. Sie erinnerte daran, dass wir in 10 Minuten aufbrechen würden. Schweren Herzens verließ ich meinen antiken Hochsitz.
Auf dem Weg zum Sammelplatz fragte mich Doris, wie mir die Reise gefällt. Ich antwortete mit einem diplomatischen »gut«.
»Es ist halt für Außenstehende immer schwierig, sich in eine kompakte Gruppe zu integrieren«, ging Doris darauf ein.
»Was meinst du mit kompakt?«
»Füglis, Laubschers, Elsbeth, Felix und ich sind zu einem ›Laura Fan-Club‹ zusammengewachsen und begleiten sie auf all ihren Reisen.«
»Wird das nicht auf die Dauer langweilig?«
»Wir fühlen uns wohl bei ihr.«
»Dass sie in ihrer unpassenden Aufmachung und auch konditionell nur begrenzt wanderfähig ist, das stört niemand?«
»Darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht. Obwohl, ich muss zugeben, in letzter Zeit hat sie etwas abgebaut...«
Weitere Informationen blieben aus, denn wir waren bei der Gruppe angekommen.
Die Wanderung über die Ebene von Perge führte durch eine öde, steinige Landschaft. Hin und wieder begegneten wir kleinen Gehöften, dabei musste es sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen haben, dass Touristen im Anmarsch sind. Egal wo wir aufkreuzten, hatten flinke Hände Stände aufgebaut, an denen Selbstgestricktes, Gehäkeltes, Gemaltes, Eingemachtes und Gebranntes feilgeboten, oder wir mit Ayran, einem Joghurtgetränk, begrüßt wurden. Die Geldbörsen waren in ständigem Einsatz.
Auf dem schmalen Fußweg zum Kursunlu-Wasserfall drangen verführerische Düfte in die Nase. Kemal und Metin waren dabei, Saç Kavurma zuzubereiten. Ein Gericht aus Lammfleischstücken, Zwiebeln, Tomaten, Peperoni und Chili. Als Beilage gab es dünnes Fladenbrot. Hungrig schöpften wir, bis die Pfanne leer war. Eine friedliche Stimmung breitete sich aus, bis Felix aus seinen Kleidern schlüpfte und mit Gejohle in den Teich sprang, was dem friedlichen Wasserleben ein gewaltsames Ende bereitete.
»Ja spinnt der?«, entfuhr es mir aufgebracht, worauf die mild lächelnde Bernadette belehrte: »Mer muess dä übermüetig Bueb gwähre laa. Mer händ scho äs Aug uf ihn«, dabei warf sie uns einen unmissverständlichen ›Haltet-euch-gefälligst-aus-dieser-Sache-heraus-Blick‹ zu und grabschte aus Fredis Rucksack eine trockene Unterhose. »Damit sich de Bueb nöd verchältet«, fügte sie erklärend hinzu.
Nur, der Bub war 29 Jahre alt und hatte, wie es Claudia salopp formulierte, nicht alle Tassen im Schrank.
Nach einem Kaffeehalt kehrten wir nach Antalya zurück. Viera war den ganzen Nachmittag auffallend still gewesen. Als wir alleine waren, gestand sie mir, dass sie es zutiefst bereue, mich zu dieser verrückten Reise überredet zu haben.
»Mach dir da mal keinen Kopf. Ich fühle mich rundum wohl, denn ich liebe es, wenn Gegensätze aufeinanderprallen.«
»Dann macht es dir nichts aus, wenn ich heute Abend mit Mahmut ausgehe?«
»Keinesfalls. Genieße den Abend.«
Während sich Viera in Schale warf, zog ich mit Claudia los, um die beleuchtete Altstadt bei Nacht zu erleben. Störend waren die aufdringlichen Händler und bettelnde Kinder.
Wir hatten verschlafen. In aller Eile stopften wir Kaffee, Brot und Gurkenscheiben in uns hinein und rannten kauend zum Bus, der mit laufendem Motor auf uns wartete. Von missmutigen Blicken verfolgt, hasteten wir zu unseren Plätzen.
»Wir besuchen heute die Ruinen des antiken Olympos und danach das Ewige Feuer der Chimaera. Beides verlangt rutschfestes Schuhwerk«, meldete sich Laura zu Wort, nachdem Metin Fahrt aufgenommen hatte.
Erstaunt blickten wir auf ihre weißen Stiefeletten, die alles andere als rutschfest schienen.
Von der einst bedeutenden Stadt Olympos gab es nur noch wenig zu sehen. Die Ruinen waren stark verfallen und zum Teil überwuchert. Deshalb schlugen wir schon nach kurzer Zeit den Weg zum Ewigen Feuer der Chimaera ein.
Der Sage nach, so Kemal, soll an diesem Bergrücken ein Ungeheuer gehaust haben, das von einem griechischen Helden auf einem geflügelten Pferd getötet wurde. Seither schlagen Flammen aus den Felsen, die in der Antike den Seefahrern den Weg gewiesen hätten. In Wirklichkeit sind es Gase, die aus Rissen und Spalten austreten und sich an der Luft entzünden. Die ca. 30 cm hohen Flämmchen hatten zweifellos etwas Magisches, was Elsbeth, Lauras Freundin, zum Anlass nahm, zu einer Gruppen-Meditation aufzurufen, um als Erkennende sich selbst zu erkennen, oder so ähnlich.
Da Viera, Claudia, Jürg, Doris und ich nichts davon hielten, folgten wir weiter den roten Punkten, die über ein zweites Feuerfeld, bis zu einer Felsnase führten, von der sich eine weite Fernsicht bis zur Küste eröffnete. Von der Gruppe war weit und breit niemand mehr zu sehen. Auch der Parkplatz, an dem wir den Bus verlassen hatten, war bei unserer Rückkehr verwaist.
»Das kann uns Laura doch nicht antun. Sie hat noch nie jemand im Stich gelassen«, lamentierte Doris.
»Es gibt für alles ein erstes Mal«, stellte Viera lakonisch fest.
Unsere Diskussionen unterbrach eine Frau, die uns aufforderte, ihr zu folgen. Sie führte uns zu einer Bucht, wo wir auf die anderen trafen, die bereits am picknicken waren. Als man uns erkannte, war ihnen die Erleichterung anzusehen. Außer bei Laura, die uns mit zornigen Blicken bedachte, bevor sie sich weiter ins Gespräch mit Elsbeth vertiefte.
Nachdem der Verein wieder vollständig war, bestiegen wir mit Verspätung den Bus, in dem Laura ihrem Zorn über unsere Extratouren freien Lauf ließ. Darauf folgte ein heftiger Wortwechsel, bei dem sie den Kürzeren zog und erbost mit Freundin Elsbeth den Bus verließ.
Der jähe Abgang unserer Reiseleiterin steckte noch allen in den Knochen, als wir zur Besichtigung der antiken Stätte Phaselis aufbrachen. Es fiel schwer, Kemals Erklärungen zu folgen. Erst durch den Vielgesang Happy Birthday, anlässlich Fredis 70. Geburtstag, kam auf der Heimfahrt wieder etwas Stimmung auf.
Nach dem Abendessen spendierte der Jubilar in der Bar eine Runde ›Schwarze Sau‹, wozu Bernadette eine aufblasbare Geburtstagstorte beisteuerte. Nach einem nochmaligen »Happy Birthday« machten wir uns mit geschwollenen Backen daran, die imaginären Kerzen auszublasen, die genau in dem Moment, samt Torte, zischend zusammensackten. Felix hatte den Gumminippel entdeckt.
»Fredi, kein Problem. Kuchen zwar am Arsch, dafür schenkt Allah langes Leben«, beruhigte Metin. Worauf sich Jürg am Rest seiner ›Schwarzen Sau‹ verschluckte.
Anderntags, auf der Fahrt nach Aspendos, war Laura wieder zur Stelle. Die Begrüßung war knapp, das Schweigen belastend.
Die Führung begann beim Amphitheater, das als der großartigste Theaterbau der griechisch-römischen Welt gilt.
Um unseren schlechten Ruf als Querulanten loszuwerden, meldeten wir uns bei der Wanderung zur Kreisstadt Serik freiwillig als Schlusslichter, was die Geduld enorm strapazierte. Lauras ›Salbei-Express‹ war nicht nur beim Analysieren von Grashalmen, Gewürzen, Blumen, Blümchen, Büschen und Bäumen unermüdlich, auch beim Fotografieren von Schafen, bockigen Eseln, verrotteten Landmaschinen, oder was es sonst zu sehen gab.
Claudia kommentierte missmutig: »Jetzt wissen wir wenigstens, warum sie immer auf halber Strecke umkehren. Leute, ich bin dafür, dass wir trotz allem wieder unsere eigenen Wege gehen.«
Was schon nach dem Mittagessen geschah. Anstelle der Besichtigung einer Teppichfabrik, folgten wir einem Olivenhain, der sich über einen nahen Hügel hinzog und von einem tiefblauen Himmel überdacht war. Der laue Wind und die mannigfaltigen Düfte, die Mutter Natur großzügig verströmte, versetzten uns in einen Zustand grenzenlosen Wohlbefindens, welches von einem furchteinflößenden Mann rabiat zerstört wurde. Seine Kleidung starrte vor Schmutz. Das Gesicht war durch einen schwarzen Bart fast gänzlich verdeckt. Die unordentlichen Haare standen wirr vom Kopf. Unter der Nase klebte senfgelber Rotz und das Schlimmste, in den Händen hielt er ein Gewehr, mit dem er vor uns herumfuchtelte. Starr vor Angst waren wir aufgesprungen. Viera begann zu beten, Claudia fluchte und ich dachte an Lukas Koller, den ich nie mehr sehen werde. Ruth, pädagogisch geschult, ging hingegen furchtlos auf den Mann zu und versuchte ihn mit sanften Worten zu beruhigen, was dieser mit gurgelndem Lachen und einem Sprung auf Ruth quittierte. Statt ihr etwas anzutun, riss er sie an sich, wühlte in ihren Haaren und murmelte unaufhörlich: »anne, anne, anne«, wobei dicke Tränen über sein schmutziges Gesicht strömten.
»Er ist nicht richtig im Kopf. Holt endlich Hilfe und steht nicht wie die Ölgötzen herum«, keuchte Ruth unter dem Ansturm.
Just in diesem Moment erschien Metin am Tatort. Er sprach beruhigend auf den Mann ein, entwand ihm die Flinte, die eine Attrappe war und forderte ihn zum Gehen auf. Aus purer Freude, noch einmal mit dem Leben davongekommen zu sein, versüßten wir ihm den Abgang mit Schokoriegeln und Zigaretten.
»Euch zu hüten, ist schlimmer als Flöhe im Sack«, schimpfte Metin auf dem Rückweg.
»Was meinte er denn mit ›anne, anne‹?«, fragte Ruth kleinlaut dazwischen.
»Mama, Mama«, antwortete Metin, der sein Lachen nicht mehr zurückhalten konnte.
Wir saßen längst im Bus, als die Teppichinteressierten und -behängten wieder an die frische Luft traten. Laura bestätigte uns großzügig, dass wir rein gar nichts verpasst hätten. Unser eben ausgestandenes Abenteuer behielten wir für uns.
Silvester ist ein Tag, dem ich von jeher mit innerer Unruhe begegnet bin. An diesem Morgen plagten mich derartige Gefühle nicht. Die Sonne schien und wir hatten frei. Das hieß, der Tag konnte nach Belieben gestaltet werden. Die einen gingen einkaufen. Viera verbrachte die Zeit mit Mahmut und ich schloss mich den anderen fünf an, die mit Kemal die antiken Städte Alanya und Side besuchten. Mit dabei war auch Tarik, bei dem Kemal einige Semester studiert hatte und sich über seine Anwesenheit riesig freute.
Wir erlebten eine vergnügliche Fahrt, die beim Roten Turm, dem Wahrzeichen Alanyas, endete. Erbaut im 13. Jh., gilt er als Meisterstück der seldschukischen Baukunst. Von der Spitze des 33 Meter hohen Turms, die wir über Wendeltreppen schweratmend erreichten, bot sich ein großartiger Ausblick auf das Hafenviertel und das tiefblaue Meer, das zum Baden einlud.
Wir waren zu viert, die später den Sprung in die Wellen wagten. Doch das erhoffte Vergnügen erwies sich als Trugschluss, oder mit den Worten von Felix: »S'isch kalt wie ne Sau.«
In Side bestaunten wir die Überreste eines Theaters aus dem 7. Jh. und den Apollon-Tempel, mit seinen weißen Marmorsäulen. Im Gegensatz zur Hauptsaison, in der sich Besucherströme durch die engen Gassen wälzen, waren an diesem Tag nur wenige Touristen unterwegs. Dementsprechend groß war der Rattenschwanz aufdringlicher Händler, den wir hinter uns herzogen und erst bei einer versteckten Bar am Meer loswurden. Wir setzten uns auf die Veranda, lauschten dem Rauschen der Meeresbrandung, rochen die salzige Luft und schwärmten vom spektakulären Farbenspiel der untergehenden Sonne. Tarik sah darin ein gutes Omen für das Neue Jahr. Mit dem Beginn der Nacht traten wir die Heimfahrt an.
Als ich in unser Zimmer stürmte, empfing mich eine Wolke Dolce & Gabbana und auf meinem Bett lag ein grünes rückenfreies Pailletten-Top, nach dem ich schon lange gesucht hatte.
»Heute Nachmittag fiel es mir in die Hände und ich dachte sofort an dich«, meldete sich Viera, nach meinem Begeisterungsschrei, aus dem Badezimmer.
Ich rannte zu ihr und umarmte sie, was völlig überraschend eine Flut Tränen auslöste.
»Was ist mit dir los. Hat es mit Mahmut zu tun?«, fragte ich Viera bestürzt, die an meiner Schulter hing und immer weiter schluchzte.
»Ja und nein. Der Tag mit ihm war wunderschön. Er hat mir angeboten, ihm beim Aufbau einer Filiale in der Schweiz zu helfen«, schniefte sie, zwischen Schluckauf und Schnäuzen.
»Das klingt doch alles sehr positiv. Ist er verheiratet, liegt da das Problem?«
»Nein, er ist geschieden. Mensch Nora, es ist mein ›Nebenerwerb‹, für den ich mich plötzlich zutiefst schäme. Wenn Mahmut dahinter kommt ist es aus und vorbei, bevor es zwischen uns richtig begonnen hat. Er lebt mit einem traditionellen Frauenbild und sieht in mir die Verwirklichung seiner Traumfrau.«
»Ausgerechnet du und traditionell?«
»Glaube mir, meine Gefühle für Mahmut sind echt. Ich bin jetzt schon süchtig nach seinen Zärtlichkeiten. Die Frage ist, wie komme ich verdammt nochmal aus diesem Dilemma heraus?«
»Mach bei deinen ›Kunden‹ reinen Tisch. Auf ihre Diskretion kannst du dich verlassen. Die Liebe macht oft seltsame Umwege. Gib ihr doch eine Chance.«
»Wie klug sich das anhört. Aber trifft das nicht auf uns beide zu?«
»Ja klar, nur bei mir muss erst einmal etwas Handfestes zum Lieben da sein. Aber nun widmen wir uns dem Silvesterball. Ich bin schrecklich aufgeregt.«
Geschminkt und fertig angezogen stellten wir uns vor den Spiegel und waren hoch zufrieden, mit dem, was wir zu sehen bekamen. Viera sah in ihrem raffiniert geschnittenen, fliederfarbenen Einteiler einfach hinreißend aus und auch ich gefiel mir in meiner schwarzen, weiten Seidenhose und dem enganliegenden Pailletten-Top.
Als wir in der Lounge eintrafen, war die Parade der eleganten Ballgäste schon in vollem Gang. Im Speisesaal empfing uns der Glanz unzähliger Kerzen, die sich im Gold und Silber der Gedecke spiegelten. Kunstvolle Tischdekorationen und Blumengebinde leuchteten in allen Farben. Ebenso opulent und köstlich war das Silvestermenu. Als Enfant terrible entpuppte sich Felix am Nebentisch. Er hatte schon beim Apero kräftig getrunken und fand es während des Dinners dufte, die Verschraubungen der Plastik-Mineralwasserflaschen loszudrücken, die wie kleine Raketen in den Tellern, oder noch schlimmer, auf den Köpfen der Gäste landeten. Jeden Volltreffer quittierte er mit grölendem Gelächter. Bevor man ihn gewaltsam aus dem Verkehr zog, brachten ihn seine Beschützer in Sicherheit.
Kurz vor Mitternacht hielt der Hoteldirektor eine Rede. Danach folgte eine Musikeinlage und Schwuppdiwupp war das Neue Jahr angebrochen. Sektkorken knallten und die wonnetrunkene Lebensfreude erreichte ihren Höhepunkt. Man lag sich in den Armen, wünschte sich »Mutlu yillar« und überließ es dem frisch geborenen Jahr, was es an guten und schlechten, fröhlichen und traurigen, langweiligen und emotionalen Überraschungen bereithalten wird.
Während die einen weiter das Tanzbein schwangen, traf sich der harte Kern an der Bar, wo Tayfun alle Hände voll zu tun hatte und uns kurzerhand zwei Flaschen Raki über die Theke zuschob. Sie reichten, um sich fröhlich in das Neue Jahr hineinzusaufen.
Stunden später schien die Apokalypse des Jüngsten Tages anzubrechen. Pauken und Trompeten dröhnten in meinen Ohren. Mein Körper lag eingeklemmt zwischen Extremitäten, aus denen es kein Entrinnen gab. Ich badete in kaltem Schweiß, versuchte verzweifelt, meine Arme aus der Umklammerung zu lösen, was die automatische Nachttischlampe in Betrieb setzte. Verkeilt mit Metin, der zum Gotterbarmen und mit offenem Mund schnarchte, lagen wir in zerknitterter Festtagstracht in Vieras Bett. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Dergestalt mussten wir da gelandet sein. Den Schnarcher wach zu bekommen, war eine Heidenarbeit. Dass er danach gleich ans Fummeln ging, um nachzuholen, was die Milch des Löwen zuvor vermasselt hatte, hielt ich für keine gute Idee.
»Metin, ab ins eigene Bett. Du musst fit sein für die Tour nach Aspendos«, schob ich ihn von mir weg.
»Termessos«, korrigierte er.
»Auch egal, die Hauptsache ist, du bist ausgeschlafen.«
»Du nix Frau, du Mutter«, maulte er beleidigt und schlurfte verdrossen davon.
»Die Mutter musst du büßen«, waren die letzten Gedanken, bevor ich in meinem unberührten Bett zu einem behaglicheren Schlaf zurückfand.
Aus dem mich Viera gnadenlos riss. Sonnenschein und frische Luft durchfluteten das Zimmer. Es duftete nach Kaffee und auf meiner Stirn lag ein kaltes Frotteetuch.
»Als ich das erste Mal hier war stank es wie in einer Schnapsbrennerei«, bemerkte sie.
»Wieso bist du eigentlich schon so aktiv?«
»Weil wir in genau 30 Minuten beim Bus sein müssen.«
»Gefrühstückt hast du auch schon?«
»Ja, mit Mahmut. Ich habe bei ihm geschlafen.«
Der türkische Kaffee tat zwar gut, aber schon beim ersten Bissen meldete sich mein übersäuerter Magen.
»Ich will nicht nach Aspendos, ich will meine Ruhe haben«, jammerte ich.
»Nicht nach Aspendos, nach Termessos.«
»Darüber wurde ich schon einmal belehrt.«
»Wahrscheinlich von keinem Geringerem als unserem Buschauffeur. Sag mal habt ihr miteinander geschlafen?«
»Ja, wie am Jüngsten Tag.«
»Was soll das wieder heißen?«
»Das soll heißen, dass ich Jungfrau geblieben bin.«
»Oh Nora, du wirst prüde.«
»Verdammt noch mal, bin und werde ich nicht. Aber ich hasse Liebeskummer, Sehnsüchte und das ganze Drum und Dran. Metin ist verheiratet und hat Kinder. Zweitfrau zu sein ist nicht mein Ding, das habe ich schon ausprobiert. Und die Türkei ist zudem viel zu weit weg. So und jetzt fahren wir nach Aspendos, Termessos, oder von mir aus sonst wohin und ich trinke nie mehr Raki«, schloss ich die für meinen desolaten Zustand enorm lange Rede.
»Löbliche Vorsätze. Kann ich nur unterstützen«, schubste mich Viera ins Badezimmer.
Hinter dem Steuer saß ein putzmunterer Metin. »Mutter«, klang es in mir nach. Ich sah bewusst durch ihn hindurch. Er aber grinste so spitzbübisch, dass die Mutter wie Butter in der Sonne schmolz. Als alle auf ihren Plätzen saßen, informierte Kemal, dass sich Laura wegen Unpässlichkeit leider entschuldigen muss und er an ihrer Stelle die Gruppe leiten wird. Es war weder Anteilnahme zu spüren, noch schien jemand etwas dagegen zu haben.
»Termessos, das auch als Machu Picchu der Türkei bekannt ist, liegt auf ca. 1100 m.ü.M. Wie Funde zeigen, war die Region um Termessos schon in prähistorischer Zeit besiedelt. Auch Alexander der Große soll sich an diesem Adlernest die Zähne ausgebissen haben...« Kemals Stimme wurde immer leiser, bis mich der Schlaf übermannte.
Der Weg zum türkischen Machu Picchu führte von Anfang an steil bergan. Trotz Brummschädel hatte sich der Aufstieg gelohnt. Antike Sarkophage mit kunstvollen Reliefs lagen über das ganze Plateau verstreut. Daneben gab es Reste einer imposanten Stadtmauer, sowie die Ruinen eines römischen Theaters. Statt von einem Stein zum anderen zu hüpfen, setzte ich mich auf einen Stein und erfeute mich an der Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel des Taurusgebirges. Später setzte sich Viera zu mir. Ich erzählte ihr, wie mich in jungen Jahren die Kriegszüge Alexander des Großen so fasziniert hatten, dass ich unbedingt seinen Spuren folgen wollte.
»Immerhin habe ich es bis hierher geschafft.«
»Und ich träumte als junges Mädchen davon, Villen und Paläste einzurichten, oder Kostümbildnerin zu werden. Weil wir bitterarm waren, wurde nichts aus meinen Träumen. Ich lernte Schneiderin und endete bei Lampenschirmen...«
Unsere nostalgischen Erinnerungen unterbrach Rösli, die uns informierte, dass wir früher als geplant den Rückweg antreten müssten. Felix sei beim Herumklettern von einem Sarkophag gefallen und hätte sich am Kopf und an der linken Schulter verletzt.
Als wir am Ort des Geschehens eintrafen, war der Verletzte bereits bandagiert und glich, von der Brust aufwärts, einer ägyptischen Mumie, die darauf wartete, zum Bus transportiert zu werden, was die Männer übernahmen. Wir Frauen bildeten die Nachhut. Das ging soweit gut, bis mit wichtigtuerischer Geschwindigkeit ein Gewitter über die Berge gezogen kam und uns gerade noch rechtzeitig erreichte. Gottlob gab es genug Antikes, unter dem man sich verkriechen konnte. Als der Regen vorbei war, formierte sich der ›Trauerzug‹ von neuem.
Metin, bereits informiert, bettete den platschnassen Felix auf den Hintersitz, gab Gas und steuerte das nächstgelegene Krankenhaus an. Während der Fahrt schlug Rösli vor: »Mer söttet jetz für de Felix es Gebät spräche.«
Bis man sich allerdings, konfessions- und atheismusbedingt, einig war welches, oder ob überhaupt, hatte Metin das Krankenhaus erreicht. Der alarmierte Notfallarzt wartete bereits und nahm unseren Wanderbruder in Empfang. Nach einer kurzen ambulanten Behandlung wurde er wieder entlassen. An Metin und Kemal gewandt, meinte der Arzt schmunzelnd, dass unser Patient wegen der ›üppigen Verpackung‹ dem Tod durch Ersticken weitaus näher gewesen sei, als durch die zugezogenen Verletzungen.
Nach diesem Intermezzo setzte Kemal das Programm mit dem Besuch des Arkeoloji Müzesi (Archäologisches Museum) in Antalya fort. Schon nach kurzer Zeit ließ allerdings die Konzentration nach und wir kehrten früher als geplant ins Hotel zurück, um den zu kurz gekommenen Schlaf nachzuholen.
Wie üblich, wurde nach dem Abendessen der Reiseleitung gedankt. Der Applaus für Laura war spärlich, derjenige für Kemal und Metin umso herzlicher. Das bewog Laura, ihren endgültigen Rücktritt als Reiseleiterin bekanntzugeben, was nur bei den ganz Treuen auf Bedauern stieß. Die Mehrheit schwieg vernehmbar.
Damit war der offizielle Teil der Reise beendet. Man ging wieder seine eigenen Wege. Meiner führte mit Metin zum letzten Mal an die Bar, wo ich bei Tayfun einen Salbeitee bestellte, der meine gurgelnde Bauchregion beruhigen sollte, was Tayfun absolut nicht verstehen wollte. Seiner Meinung nach besaß nur der Raki die Gabe, die Gebrechen des menschlichen Daseins zu lindern. Besonders Kummer und Sorgen, dabei sah er mich vielsagend an. Er hatte Recht. Der Abschied machte mir zu schaffen. Ich hatte mich in den letzten Monaten selten so unbeschwert gefühlt. Und so kamen Metin und ich auf unser Leben zu sprechen. Er erzählte mir von seiner Familie und den beiden Kindern. Ein Mädchen und ein Junge. Vier und sechs Jahre alt. Von seiner Frau, die in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen war, an einer Schule Deutsch unterrichtet und dass dies die letzte Tour gewesen sei, weil er das Transportunternehmen seines Schwiegervaters übernehmen wird.
»Dann hast du bei deiner Frau Deutsch gelernt?«, fragte ich.
»Ja, aber nicht nur das, auch kein ›Ladykiller‹ mehr zu sein, der mit jeder Frau ins Bett hüpft. Deshalb bin ich dir dankbar, dass du mich vergangene Nacht rausgeworfen hast. Ich hätte mir die Untreue nie verziehen. Aber jetzt zu dir. Was war der Grund, dass du bei dieser Gruppenreise dabei warst?«
»Ich habe Distanz zu meinem chaotischen Innenleben gesucht, das immer mehr von Selbstzweifeln, Misstrauen und Unzufriedenheit aufgefressen wurde.«
Metin schaute mich mitfühlend an. »Wenn dir die Decke wieder einmal auf den Kopf fällt, dann komm einfach zu uns. Du bist jederzeit ein gern gesehener Gast«, versicherte er und zog mich liebevoll an sich.
Daraufhin bestellte ich mir doch einen Raki, denn die Tränen, die zu fließen begannen, lösten sich darin besser auf als im Salbeitee.
Kurz darauf erschien Viera. Es blieb nicht verborgen, wie schwer ihr der Abschied von Mahmut fiel. Wortlos fuhren wir mit dem Lift zu unserem Zimmer und packten genau so wortlos unsere Koffer. Erst beim Einschlafen fragte sie mich mit dünner Stimme: »Glaubst du, hinter dem Spruch: Wenn du meinst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her, steckt ein Quäntchen Wahrheit?«
»Das glaube ich schon. Nur die Frage wird sein, wann das Lichtlein kommt.«
»Mhm, dann schlafen wir jetzt besser.«
Es regnete, als wir am Morgen zum Flughafen aufbrachen. Je nachdem wie man die Reise erlebt hatte, schwankten die Stimmungen von der Freude endlich wieder nachhause zu kommen, über das Bedauern, dass es schon zu Ende war, bis zum dumpfen Abschiedsschmerz von Viera, der augenblicklich verflog, als ihr Teppichhändler, mit zwei Paketen unter dem Arm, in die Abflughalle stürzte. Er riss Viera in seine Arme, begann sie wie ein Verdurstender zu küssen und weinte echte Tränen.
In den Paketen befanden sich ein kostbarer Seidenteppich für Viera und ein kleiner Wandteppich für mich. Obwohl ich Perserteppiche immer noch nicht mag, blieb er eine Ausnahme. Er hält nicht nur die Erinnerungen an diese verrückte Reise wach, sondern auch an Metin, der zu einem echten Freund geworden war.
Für Viera und Mahmut kam es doch noch zu einem Happy End. Zwei Monate später stand Mahmut unangemeldet vor Vieras Tür, drückte ihr 30 rote Rosen in die Hand und erklärte, dass er ohne sie nicht mehr leben kann. Viera packte ihre Koffer, zog nach Istanbul, heiratete Mahmut, lernte Türkisch, fand Gefallen am Teppichhandel und wurde eine rundum glückliche Ehefrau.
Zweites Kapitel
Kiwi
1
William kehrte begeistert aus China zurück und begann seinen Umzug nach Singapur zu planen. Je mehr er sich darauf freute, umso mulmiger wurde es mir. Das Gefühl ließ sich nicht mehr ignorieren, dass ich nach seinem Wegzug endgültig allein sein werde. Was anfangs so befreiend gewesen war, wurde zur Belastung.
Die Idee, meine Zelte ebenfalls abzubrechen und in den Schoss meiner Familie, im beschaulichen Köndringen am Kaiserstuhl zurückzukehren, nahm von Tag zu Tag konkretere Formen an. Im Haus meiner Eltern gab es genug Platz für mich. Sie bewohnten das trutzige vierstöckige Stammhaus der Beck-Sippe, die auf Mitte des 16. Jh. zurückgeht. Das Haus hatte alle Kriege, Renovierungen, Familienfehden und Tragödien, ohne Schaden zu nehmen, überstanden. Auch unsere spektakuläre Geburt, bei der von einer fachkundigen Hebamme, mein wohlgenährter Zwillingsbruder Thomas, behutsam in die Welt gezerrt wurde, während ich unerwartet, als ›lebende Nachgeburt‹, hinterher flutschte. Mein Erdendasein begann im Brutkasten.
Unsere Kindheit verlief unbeschwert. Doch als Zwillinge konnten wir nicht unterschiedlicher sein. Tom blieb der Wonnebrocken. Er liebte das Schmusen und Kuscheln, während ich allen Liebkosungen aus dem Weg ging. Meine Kratzbürstigkeit war von klein auf gefürchtet. Tom war in der Schule strebsam und fleißig, bei Lehrern wie Schülern gleichermaßen beliebt. Im Gegensatz zu mir, die keinem Streit aus dem Weg ging und in den Leistungen entweder ganz vorne, oder am Schwanz lag. Tom liebte Tiere über alles und unterhielt einen kleinen Privatzoo. Dafür war mein Zimmer mit Büchern und Ehrenurkunden vollgestopft, die von meinen sportlichen Leistungen erzählten.
Beide hatten wir unsere Ausweichstation, wo wir Gehör und Verständnis fanden, egal was wir ausgefressen hatten. Bei Tom war es die Oma und bei mir meine geliebte Tante Clara, eine grazile dunkelhäutige Schönheit, die mit Großonkel Otto verheiratet gewesen war und von dem sie, nach seinem überraschenden Tod, nicht nur die Villa am Dorfrand, sondern auch sein stattliches Vermögen geerbt hatte. Ihre Verdrossenheit, am ›Arsch der Welt‹ zu leben, konnte sie trotzdem nur schlecht verbergen. Bis eines Tages Mister Mortimer aufkreuzte, der Tante Clara wieder zum Frohsinn verhalf. Zu Dritt bildeten wir eine eingeschworene Gemeinschaft.
Es gab für mich nichts Schöneres, als bei den beiden meine Zeit zu verbringen. Besonders spannend fand ich Tante Claras Fotoalben, die aus dicken ledergebundenen Folianten bestanden, in denen sie akkurat die Fotos ihrer vielen Reisen eingeklebt hatte. Wenn ich auf Fotos stieß, die sie mit ihren Eltern in Afrika, oder als Schulmädchen in Madeira zeigten, blieb sie zugeknöpft. Worauf ich ärgerlich drohte: »Wenn ich groß bin, dann schreibe ich deine Geschichte auf, und dann kannst du nicht mehr kneifen.«
Das pflegte sie jeweils mit einem rätselhaften Lächeln zu quittieren. Seit dieser Zeit war ich überzeugt, dass es ein Geheimnis in ihrem Leben gab. Tante Clara war und blieb auch über die Kindheit hinaus meine engste Vertraute.
Als die Frage aktuell wurde, zu welchem Beruf wir uns hingezogen fühlen, stand bei Tom von vornherein fest, dass er Tierarzt werden wollte. Bei mir schwankte der Berufswunsch, je nachdem für was ich mich gerade begeisterte, zwischen Tänzerin, Archäologin, Schriftstellerin, Entwicklungshelferin, Journalistin oder Model. Diesen Vogel hatte mir meine Ballettmeisterin ins Ohr gesetzt, die der Meinung war, dass ich für diesen Job die idealen Masse und das Aussehen mitbringen würde. Das ließ unsere Eltern spätestens jetzt in Notwehr handeln. Sie schickten mich in eine Schraubenfabrik, die einem Freund unseres Vaters gehörte, um dort das Kaufmännische zu lernen. Da half kein Zeter und Mordio schreien, nicht einmal die Drohung mit Selbstmord.
»Erst kommt ein Fundament und dann die Flausen«, argumentierte sowohl Mutter wie Vater, der sonst immer auf meiner Seite stand.
Widerwillig wurde aus mir eine sogenannte Industriekauffrau, während Tom nach dem Abitur zielstrebig auf die Veterinärmedizin zusteuerte.
»Jetzt kannst du entscheiden, was du weiter tun willst«, ermunterten mich die Eltern, nachdem ich ihnen meinen Gehilfenbrief der Industrie- und Handelskammer Freiburg präsentiert hatte.
Was ich sofort in die Tat umsetzte. Ich zog zu einer Freundin nach Freiburg, nahm an wilden Partys teil, verlor meine Unschuld, rauchte Marihuana, liebte schwarze Klamotten, war bei jeder Demo dabei und trug einen voluminösen Afrolook, nach meinem Vorbild Angela Davis, der amerikanischen Menschenrechtlerin. Das abrupte Ende als ›Anarchistin‹ kam, als mich Vater, nach einer Schlägerei mit Burschenschaftlern, bei der Polizei abholen musste. Die angedrohte Strafanzeige konnte, dank elterlich verordneter Reue und mit Hilfe eines befreundeten Rechtsanwalts, verhindert werden. Außerdem wurde beschlossen, mich aus dem Verkehr zu ziehen und in eine französische Sprachschule nach Genf zu schicken. Bis man mit Onkel Franz, einem Cousin meiner Mutter einig war, stand ich unter Hausarrest und musste in Vaters Büro Steuererklärungen ausfüllen.
»Solange du die Füße unter unseren Tisch streckst, sagen wir wo es lang geht«, tönte es unerbittlich, als ich gegen diese weitere willkürliche Maßnahme protestierte.
Widerwillig packte ich meine Koffer und zog zu Onkel Franz, der Geologie-Dozent an der Uni in Genf war und zu Tante Marie, einem sanften liebenswürdigen Hausmütterchen. Unter ihrer Obhut fühlte ich mich so wohl, dass alle Aggressionen verschwanden. Ich ging gerne zur Schule, half meiner Tante im Haushalt und traf mich mit Schulkolleginnen, oder Studenten, die bei Onkel Franz ein- und ausgingen.
Dabei hatte es mir ein Neuseeländer besonders angetan. Er war groß, mit schmalen Hüften, langen Beinen, strahlend weißen Zähnen und Augen, die mit ihrem Blau an die Farbe eines Bergsees erinnerten. Seine dunkelblonden, gewellten Haare reichten bis zur Schulter. Er war das pure Gegenteil von den blassen, zugedröhnten Typen, mit denen ich zuvor meine Zeit verbracht hatte. Kurzum, ich verliebte mich in ihn.