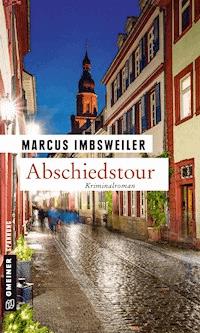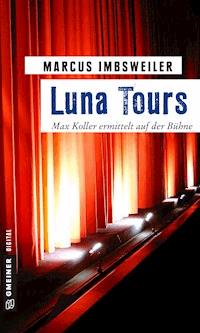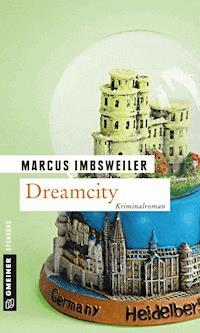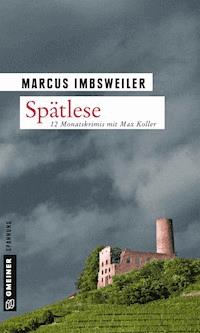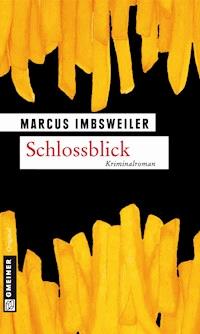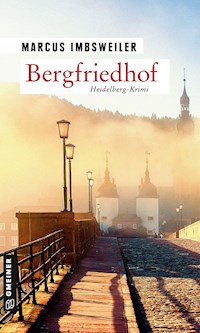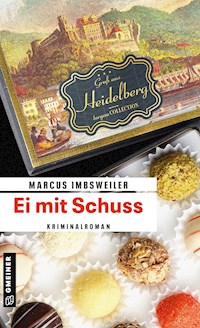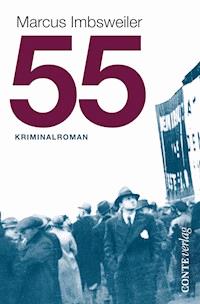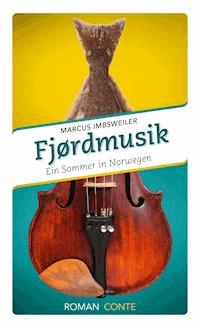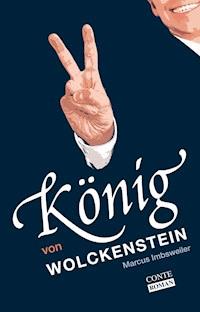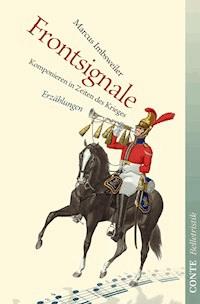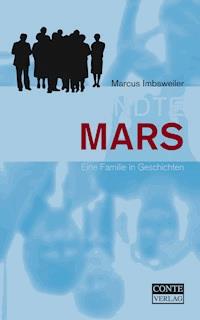
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist ein Kreuz mit den lieben Verwandten. Vor allem wenn sie sich aus lauter Querköpfen und Sonderlingen zusammensetzen wie jene Sippschaft aus dem Nordhessischen. Großonkel und Großtante zum Beispiel geht man lieber aus dem Weg. Der eine ist ein Langweiler, der auf sein in beamteter Beschaulichkeit verbrachtes Leben so stolz ist, dass er allen davon erzählen möchte. Warum nicht gleich eine Autobiographie verfassen ("In Zügen")? Die Großtante denkt da praktischer; sie zieht sich ans Meer zurück, bevor die Verwandtschaft über ihr sauer Erspartes herfällt. Leider reicht es nicht zum erträumten Altersruhesitz in der Sonne, sondern nur zur Untermiete an der Ostsee ("Sansibar"). Marcus Imbsweiler zeichnet die "Verwandten auf dem Mars" mit leichter Ironie und feinem Humor. Aber auch nachdenkliche und tragische Töne klingen innerhalb dieses familiären Geflechts an. Wie in einem Roman setzen sich die 14 Portraits von Eltern und Geschwistern, Omas und Onkeln zu dem Panorama einer ganzen Familie zusammen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Zügen
Mein Großonkel war das, was die Leute einen Einzelgänger nennen. Nicht nur, dass er alleine lebte, dass er scheu und schreckhaft war. Nein, seine gesamte Erscheinung signalisierte Flucht: Gefühle verbarg er hinter einem unsicheren Lächeln, sein Blick flackerte, sogar sein Haar gab Jahr für Jahr ein neues Stück Kopfhaut preis. Der ganze Körper, so schien es, wich immer mehr vor der Welt zurück. Als mein Großonkel starb, wog er zweiundfünfzig Kilogramm.
Auch die Trauergemeinde, die sich an seinem Grab versammelte, war mit der Zeit geschrumpft. Freunde hatte er nie besessen, Weggefährten waren gestorben, Bekannte verzogen. Die Verwandtschaft ließ sich verleugnen, schützte Termine vor, und ohne uns hätte mein Großonkel einen einsamen letzten Gang antreten müssen. Ich sah meine Mutter ein paar Tränen vergießen, über das Gesicht meines Vaters jedoch huschte Erleichterung, als der Sarg seinen Blicken entschwand. »Das war’s«, sagte er und sah sich händereibend um, wie man es tut, wenn ein düsteres Kapitel überwunden ist, wenn große Aufgaben auf einen warten oder die Verheißungen der Zukunft. Vielleicht dachte er an die letzte Begegnung mit dem Großonkel, an dessen flüsternd hervorgebrachtes Geständnis, er sei stolz darauf, uns mit seinem Leben ein Vorbild sein zu können. Mein Vater hatte das Ohr nahe an die Lippen des Sterbenden gebracht, und seine Reaktion – die fallende Kinnlade, die entgleiste Mimik – war ebenso sehenswert wie nachvollziehbar. In diesem Moment kann mein Großonkel nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen sein. Denn wozu sein Leben auch immer getaugt hatte, zu einem Vorbild sicher nicht. Ein Mann von zweiundfünfzig Kilogramm wollte uns als Beispiel dienen? Der als der langweiligste Mensch weit und breit galt? Ein Mann von der Konstitution eines Schwindsüchtigen, der seine berufliche Karriere hinter dem Schreibtisch einer städtischen Behörde begonnen und an demselben Platz beschlossen hatte, der nichts gespart, keine Familie gegründet, keinen Baum gepflanzt hatte? Es war der letzte von vielen lächerlichen Sätzen meines Großonkels gewesen, und man musste dem Tod dankbar sein, dass er ihm bald darauf die Lippen für immer geschlossen hatte.
Ich weiß, wovon ich rede. In den vergangenen Jahren waren wir die Einzigen gewesen, die den zarten Mann besucht hatten, und wenn wir das taten, quoll er über. Er quoll über vor Geschichten, Erfahrungen, Begebenheiten seines Lebens, eine belangloser als die andere. Aber sie mussten erzählt werden! Jedes Detail musste erinnert, jedes Anekdötchen in Umlauf gebracht werden. Dabei konnte mein Großonkel eine Energie entwickeln, die man ihm nicht zutraute. Er redete und redete. Manchmal blieb ihm der Atem weg, er wurde von Hustattacken geschüttelt, doch er ließ nicht locker, klammerte sich an den roten Faden seiner Geschichten wie Ertrinkende an einen Strohhalm.
Man muss sich das so vorstellen: Mein Großonkel ruft bei uns an. Vorsichtige Nachfrage: wann man sich wieder einmal sehe. Meine Eltern wimmeln ab. Ein neuer Anruf, Wochen später. Der letzte Besuch sei schon so lange her. Weitere Ausflüchte, die Arbeit auf dem Hof, angebliche Krankheiten der Kinder. Bei der nächsten Anfrage fällt die Bastion, wir kommen, es muss ja irgendwann einmal sein. Die Tür öffnet sich, kaum dass wir geläutet haben, mein Großonkel strahlt uns an, randlose Brille auf schmalem Nasenrücken, den Hals hinter einem fein gewebten Seidentuch verborgen. Händeschütteln, die Andeutung einer Umarmung. Wir Kinder werden vorgeschickt, dienen als Puffer zwischen den Erwachsenen. Überall riecht es nach altmodisch süßem Herrenparfüm. Unser Platz ist die verschlissene Chaiselongue des Gastgebers, Kakao und Kekse stehen schon bereit. Derweil verzieht sich meine Mutter in die Küche, hantiert mit Besen, Schrubber, Eimer und Lappen, wischt die Böden und putzt die Fenster, während mein Vater hier ein Regalbrett auswechselt, dort einen Nagel in die Wand schlägt, auch wenn diese Wand gar keinen Nagel braucht. Ist kein Nagel mehr zur Hand, kein Regalbrett mehr auszuwechseln, widmet er sich dem Cognac meines Großonkels, der niemals Alkohol trinkt.
Und während all dieser Zeit sitzen wir drei Kinder auf der Chaiselongue, trinken Kakao, knabbern Kekse und lauschen seinen Geschichten. Geschichten, in denen das Wort »ich« Anfang, Zentrum und Ende bildet, die Beichte seines Lebens. Was hat der Mann für dünne weiße Arme! Und wie furchtsam zucken seine Lider, obwohl doch wir es sind, die allen Grund zur Furcht haben müssten: Furcht, dass sein Monolog endlos währen könnte, dass der Cognac im Glas meines Vaters nie zur Neige gehen und meine Mutter immer wieder neue staubige Ecken im Haus finden würde.
»Die guten alten Zeiten«, lautete sein Lieblingsbeginn. Die guten alten Zeiten. Zeiten, in denen noch die alten Bahnen gefahren waren und er mit ihnen, jeden Morgen, zur Arbeit in die Stadt. Das konnte sich heute keiner mehr vorstellen. Wie er sich schläfrig in ein Abteil gezwängt hatte, die Aktentasche unterm Arm, und die Abteile waren voll, jeden Tag, zum Teil kannte man sich, es gab aber auch immer neue Gesichter, müde Gesichter, dem Schlaf kaum entronnen. Fünfunddreißig Minuten brauchte der Zug in die Stadt, ein Bummelzug natürlich, vom ICE sprach damals kein Mensch, es waren andere Zeiten, man hatte mehr Zeit. Und man hatte andere Abteile früher, Abteile mit geriffelten Holzböden und ausgebeulten Gepäcknetzen, in denen die Koffer und Taschen sanft nachwippten, wenn der Waggon über die Gleise schaukelte. Züge, die es so nicht mehr gab.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie mein Bruder seinen Zeigefinger in einen Riss des Chaiselongueüberzugs steckte und darin herumpopelte.
Die morgendliche Müdigkeit allerdings machte meinem Großonkel schwer zu schaffen. Und nun sollten wir uns vorstellen, sagte er, was ihm eines Tages passiert sei. An jenem Tag hatte ihn die Müdigkeit geradezu übermannt. Während draußen winterliche Dunkelheit herrschte, zuckelte der Zug langsam durch verschneite Dörfer, den brummenden Heizkörpern entströmte stickige Luft. Ein Gähnen lief von Mund zu Mund. Von kantigen Schultern beidseitig eingeklemmt, konnte sich mein Großonkel kaum bewegen; nur sein Kopf wackelte bedenklich auf dünnem Hals. Das Abteil überheizt, die frühe Stunde: was tun gegen die Gefahr des Einnickens? Plötzlich, wie von selbst, hielt mein Großonkel einen Bleistift in der Hand. Die Aktentasche lag auf seinen Knien, sie enthielt auch einen Notizblock. Schreiben, um sich wach zu halten, Notizen gegen den Schlaf, das war die ungewöhnliche Maßnahme, zu der er sich an diesem Morgen entschloss. Er setzte seinen Namen oben auf die leere Seite, darunter die seiner Eltern, die früh gestorben waren, und sein Geburtsdatum. Dann Stichworte, Erinnerungsstützen aus seiner Kindheit. Allmählich füllte sich die Seite, und als er unten angelangt war, hatte der Zug zu seiner Überraschung die Stadt erreicht. Am nächsten Morgen verfuhr er ebenso. Die Müdigkeit verflog, sobald er mit dem gespitzten Bleistift das Blatt anzielte und sein Leben in ein Gespinst von Buchstaben verwandelte. Aus Stichworten wurden Sätze, aus Sätzen ganze Kapitel. Je mehr er über sich und sein Leben nachsann, desto mehr Geschichten kamen ihm in den Sinn, desto klarer wurde ihm, welch einen Schatz an Erlebnissen es zu bergen galt.
»Du hast geschrieben«, sagte meine Schwester, »und alle konnten zugucken?«
»Es waren doch Fremde«, entgegnete mein Großonkel. Fremde, Mitreisende, flüchtige Zeitgenossen. Was erfuhren sie schon? Für keinen von ihnen hob sich der Vorhang zum Leben meines Großonkels länger als wenige Augenblicke, sie bekamen stets nur einen Ausschnitt zu sehen. Mochten sie also mitlesen. Es beflügelte ihn sogar, wenn er merkte, dass man aufmerksam wurde, dass man herüberlinste. Er war der Schreibende. Er hatte Macht über die Worte, über das, was sie verrieten und was sie verschwiegen. Noch nie hatte mein Großonkel eine solche Überlegenheit verspürt.
Seit diesem Tag verfasste er seine Biografie. Er ging streng chronologisch vor, kommentierte nicht, dozierte nicht, sondern notierte buchhaltergleich, was geschehen war. Kein einfaches Unterfangen. Manchmal wollten die Sätze nicht gelingen, manchmal klopfte mein Großonkel nur ungeduldig auf dem Notizblock herum, sah aus dem Fenster, den vorbeihuschenden Stationen nach, um vor der letzten noch hastig einen Satz zu Papier zu bringen. Irre machen ließ er sich nicht. Denn das Nachdenken über sein Leben hatte dieses Leben verändert. War die halbstündige Zugfahrt in die Stadt vor dem denkwürdigen Wintertag ein langes, zähes Nichts gewesen, eine Reise ohne Wert, hatte sie sich nun in einen kostbaren Wimpernschlag von Zeit verwandelt, innerhalb dessen eine menschliche Existenz zu Worten gerann. Das morgendliche Schreiben wurde zum Ritual. Sämtliche andere Tagesereignisse drängte es in den Hintergrund, wurde zum eigentlichen Fixpunkt im Leben meines Großonkels.
So verstrichen die Jahre. Der Notizblock füllte sich, bald benötigte er einen neuen, dickeren. Der eine oder andere Fahrgast kannte ihn schon, den schreibenden Beamten, und erkundigte sich nach seinen literarischen Ambitionen. Um Gottes Willen, lächelte mein Großonkel und schüttelte den Kopf. Eine neugierige Frau mit scharfem Blick fragte, über wen er da so ausdauernd schreibe. Sie konnte nicht wissen, dass mein Großonkel seine Memoiren in der dritten Person verfasste. Warum er das tat, blieb ihm selbst ein Rätsel, ebenso die Tatsache, dass er nachmittags, bei der Rückreise, nicht eine Zeile schrieb. Die Schläfrigkeit nach der Arbeit war dieselbe wie am Morgen. Doch sie war durchwirkt von Erschöpfung und Überdruss, einer Spur Weltekel.
Meine Schwester rückte ein wenig näher an mich heran. Sie hatte Kakao verschüttet und versuchte, den Klecks unter ihrem Oberschenkel zu verbergen. Aber mein Großonkel hatte das Malheur natürlich bemerkt. Er sprang auf, lächelte entschuldigend und holte einen Lappen aus der Küche. Dabei sprach er unablässig weiter, um seine einzigen Zuhörer nicht zu verlieren; sogar aus der Küche drang seine heisere Stimme zu uns.
Kein Zug, so wurden wir belehrt, fährt immer in eine und dieselbe Richtung. Des Menschen Glück hat keine Dauer, und wo Licht ist, ist auch Schatten. Es begann die Zeit des Unbehagens. Dieses Unbehagen beschlich meinen Großonkel unmerklich, und es wuchs, je weiter er sich seine Existenz erschrieb. Zunächst hatte er keinen Namen für dieses Gefühl. Er sah aus dem Abteilfenster auf verwilderte Wiesen und abgeerntete Felder, auf verlassene Bahnhofsgebäude und schnell wachsende Fabrikgelände. Am Stadtrand züngelten frisch asphaltierte Straßen in die Ferne, die Schaffner trugen neue, glänzende Uniformen, und mit einem Mal wurde ihm bewusst, dass auch der ereignisreichste Lebenslauf irgendwann dem verheerenden Appetit gefräßiger Zeilen und Zeiten zum Opfer fallen würde. Und kein Schreibtempo, nicht einmal sein eigenes, war so langsam, dass es seinem Gegenstand erlaubt hätte zu entkommen. Eines Tages würde sein Leben komplett auf Papier gebannt sein – und was kam danach?
Es geschah im zwölften Jahr seiner Bekenntnisse in Zügen: Unweigerlich näherte sich sein Bericht jenem Wintermorgen, an dem er aus Müdigkeit zum Stift gegriffen hatte. Entschloss er sich nun fortzufahren, wurde die Autobiografie zum Gegenstand ihrer selbst, heftete sich der Schreibende immer dichter an die Fersen des Erschriebenen. Plötzlich spürte mein Großonkel den Atem eines Verfolgers in seinem Nacken; eines rastlosen Fährtenlesers, der Witterung aufgenommen hatte. Er zwang sich, seine Erlebnisse ausführlicher zu schildern, umständlicher, weitschweifiger. Aber was war das für ein mühsames Hakenschlagen der Sprache, bestand doch sein Alltag in einer Aneinanderreihung immer gleicher Handlungen, gekrönt von jenem morgendlichen halbstündigen Ritual. Wie sollte er schreibend seine Angst vor dem Ausgeschriebensein bekämpfen?
Mein Großonkel setzte seine Tätigkeit in verlangsamter Form fort und schob damit das Ende, den toten Punkt seiner Aufzeichnungen, noch einige Monate vor sich her. Der Zufall wollte es, dass sich just zu diesem Zeitpunkt die Verbindung in die Stadt aufgrund von Modernisierungen verkürzte. Während sich die Räder der Eisenbahn und überhaupt des ganzen Lebens um ihn herum zu beschleunigen schienen, bemühte er sich, ausholender und detailgetreuer zu formulieren, mit Liebe zum Ornament und zur retardierenden Betrachtung – all dies berechnend und nur aus dem einen verzweifelten Grund: um dem Zeitpunkt auszuweichen, an dem er sich leer geschrieben hatte. Natürlich halfen seine Winkelzüge nichts. Eines Morgens, als der erste Schnee das Land bedeckte, war es so weit: Die beschriebene Zeit holte die Schreibzeit ein.
Auf dem Papier stand der Satz Eines Morgens war es so weit: Die beschriebene Zeit holte die Schreibzeit ein; sein Bleistift schwebte über den Zeilen, und groß war die Furcht vor der Leere. Auf den Blättern vor ihm tanzten die Wörter, schiefe Satzzeichen und zittrige Buchstaben – zittrig, weil das Abteil trotz aller Modernisierungen wackelte und ruckte wie eh und je und an ein sauberes Schriftbild nicht zu denken war –, zehn dicke Notizblöcke hatte er mit Episoden aus seinem beschaulichen Behördenalltag gefüllt, und nun konnte er nicht fortfahren, bevor er nicht wieder etwas erlebt hatte. Er konnte überhaupt nichts tun, denn ihn keilten zwei warme Schultern auf seinem Sitz ein und hielten ihn fest.
Als die Furcht am größten war, wachte mein Großonkel auf. Er schreckte von seinen Blättern hoch und schaute einer jungen Frau ins Gesicht. Einer Frau von märchenhafter Schönheit, die ein kornblumenblaues Kostüm trug. Das Abteil war voll, die Müdigkeit allgemein. Auf seinen Knien lag die geschlossene Tasche, seine Hände über den Verschlüssen, die Heizung brummte gemütlich. Wie damals, in der guten alten Zeit. Und die Zeit war dieselbe, nichts hatte sich verändert, nur er, für die Dauer einer Zugfahrt. Er hatte geträumt, hatte sich träumend sein Leben zurechtgeschrieben.
»Kann ich noch einen Keks haben?«, fragte mein Bruder.
Der Großonkel nickte. Natürlich, ein Keks für die lieben Kinder, immer. Er reichte die Dose herum, schenkte Kakao nach. Im Nebenzimmer war das Entkorken einer Cognacflasche zu hören.
»Ich verstehe das nicht«, sagte meine Schwester. »Hast du nun dein Leben aufgeschrieben oder nicht?«
»Nein«, lächelte der Großonkel. »Es war bloß ein Traum.«
»Aber du hast doch von den neuen Zügen erzählt, von der Modernisierung und all dem.«
»Modernisierungen, ja. Alles geträumt. So schnell geht es eben nicht bei uns im Kaufunger Wald.«
»Du hast alles geträumt?«, fragte ich nach.
»So möchtet ihr auch einmal träumen, nicht wahr? Es war bloß ein Nickerchen, aber was für eines. Der lange, Zeiten verschlingende Traum eines einzigen Wintermorgens.«
»Und deine Notizblöcke?«
»Es gibt keine Notizblöcke«, antwortete mein Großonkel mit ersten Anzeichen von Ungeduld. »Jedenfalls keine beschriebenen. Natürlich, als ich die Tasche öffnete, lag ein Block darin. Bleistifte ebenfalls. Was man so dabei hat. Ansonsten: ein Traum.«
Wir schwiegen und leckten über unsere kakaoverschmierten Lippen. Im oberen Stockwerk fuhrwerkte meine Mutter, nebenan sah ich meinen Vater in einer Illustrierten blättern. Mein Großonkel schien zu merken, dass er seine Erzählung so nicht enden lassen konnte, und beschrieb, wie der Zug kurz nach seinem Erwachen in den Bahnhof einfuhr, wie die Bremsen quietschten und die Reisenden das Abteil verließen. Auf dem Holzfußboden blieben kleine Lachen geschmolzenen Schnees zurück. Und da lag doch ein Handschuh, ein kornblumenblauer Handschuh unter den Sitzen! Mein Großonkel, der als Letzter ausstieg, hob ihn auf und reichte ihn der jungen Frau. Das dankbare Lächeln dieser schönen Frau, dieses märchenhaften, verwunschenen Wesens, hat er nie vergessen.
»War’s das?«, fragte mein Bruder. »Story zu Ende?«
Mein Großonkel nickte nachdenklich. Ja, das war’s. Ein kurzer Wintermorgen und ein langer Traum. Wie es doch manchmal geht im Leben.
Wir standen auf, erleichtert. Nur meine Schwester wollte noch eines wissen: ob er seine Erinnerungen nicht wenigstens nachträglich aufgeschrieben habe. Wenn schon, denn schon, oder?
Nein, sagte mein Großonkel, das habe er nicht getan. Er wolle nicht bestreiten, dass dieser Wunsch in ihm aufgekommen sei, aber die Angst, sich leer zu schreiben, habe sich als stärker erwiesen. Dieselbe Angst wie im Traum: dass da irgendwann nichts mehr zu berichten sei, dass sich sein Leben zwischen den Buchstaben verlieren, von der Tinte aufgesogen werden könne. Das verstünden wir vielleicht nicht – und wir verstanden es auch nicht –, aber es sei nicht zu ändern. So schloss mein Großonkel und entließ uns für dieses Mal.
Als wir unseren Eltern auf der Heimfahrt von den Träumen und Ängsten des Großonkels erzählten, lachten sie. Mein Vater tippte sich an die Stirn und sagte, das sehe dem Langweiler ähnlich, der Nachwelt auch noch seine Memoiren aufzuhalsen, und meine Mutter meinte, vermutlich habe uns der alte Mann auf seine verschrobene Weise mitteilen wollen, dass seine Autobiografie längst geschrieben sei und nur darauf warte, von uns, den Nachgeborenen, entdeckt zu werden.
An diese Worte erinnerte ich mich, als mein Großonkel einige Jahre später starb. Ich erklärte mich bereit, beim Aufräumen, Ordnen und Verteilen seines Hausrats mitzuhelfen. Vielleicht fand sich irgendwo ein schriftliches Vermächtnis. Dass ihm das letzte Kapitel fehlen würde, bedeutete keinen Verlust, denn der Tod meines Großonkels war so unspektakulär wie sein ganzes Leben: seine letzte von vielen Gesten der Flucht. Eines Tages fühlt er sich unwohl, wird eingewiesen, Achselzucken der Ärzte, er kommt wieder nach Hause und bleibt still in seinem Bett liegen, bis der Leichenwagen anrollt. Es gab einen kleinen Nachruf in der Zeitung, aber kaum etwas zu vererben. Ein paar Tage nach der Beerdigung sprach niemand mehr über meinen Großonkel – so, als habe er keine sichtbaren Spuren auf unserer Erde hinterlassen. Die Möbel wurden verkauft, die Kleider an Wohlfahrtsverbände verschenkt, den Schwarzweißfernseher warfen wir verächtlich in den Müll, und um das Gerümpel auf dem Dachboden kümmerte sich außer mir kein Mensch. Da gab es kistenweise Bücher, sentimentale Romane, juristische Schinken, etwas Historie, einige Bildbände. Ein Roman oder eine Biografie aus seiner Hand fand sich nicht. Wenigstens eine Inhaltsskizze, fragmentarische Texte oder einen durchgestrichenen Beginn hatte ich erwartet.
Aber mein Großonkel war nicht nur ein langweiliger, sondern auch ein seltsamer Kerl gewesen. Als ich in einer zugestaubten Kommode ein verschlossenes Kästchen entdeckte, glaubte ich schon, das Versteck seiner Schriften aufgespürt zu haben. Gewaltsam brach ich es auf. Aber in dem Kästchen lag bloß ein alter, oft durchgeblätterter Zugfahrplan mit einem kuriosen Lesezeichen: einer Fotografie, die einen lächelnden jungen Mann zeigte, einen sehr jungen, sehr attraktiven Mann in einem kornblumenblauen Anzug und kornblumenblauen Handschuhen.
Sansibar
Liebe Leutchen zu Hause, schrieb meine Großtante, dass Ihr ja nicht auf den Gedanken kommt, mich zu besuchen. Ich bin hier sehr glücklich ohne Euch. Das Meer ist herrlich warm. Der Himmel ist herrlich blau. Wunderschön. Jetzt lerne ich auf meine alten Tage sogar noch schwimmen. Tut mir leid für Euch, dass es in Deutschland immer, immer regnet. Das habe ich lange genug mitgemacht. Eine alte Frau, die nie jemandem zur Last gefallen ist, darf sich auch mal was gönnen, und jetzt bin ich dran. Ich habe ein reines Gewissen. Gott, was sind die Menschen freundlich hier. Das Leben ist billig. Trotzdem, ich habe nicht die Absicht, Euch etwas zu vererben. Seid mir nicht böse, Ihr habt Euch lange genug aushalten lassen. Eure alte Tante.
Mein Vater tobte, als er den Brief las. Draußen spielte die Sonne auf buntem Laub, es war ein milder Herbsttag so recht aus dem Lehrbuch. Von Regen keine Spur.
»Schreib dieser Verrückten«, brüllte er meine Mutter an, »und zwar sofort! Schreib ihr, was für ein Wetter wir haben! Auch die Temperatur und all das. Mach ein Foto vom Thermometer!«
»Lass sie doch«, sagte meine Mutter.
»Schneide die Wetterberichte der letzten vier Wochen aus und schick sie ihr! Damit die Alte Ruhe gibt. Blauen Himmel haben wir auch. Und keine Skorpione und Krokodile wie die da unten.«
Türen knallend verließ mein Vater die Küche. Seine Erregung war nachvollziehbar. Mit dem Wetter hatte sie allerdings nichts zu tun, auch nichts mit Skorpionen und Krokodilen. Ihr habt Euch aushalten lassen – diese Behauptung nagte an ihm. Sie nagte so sehr, dass er draußen, malerisch beleuchtet von der tief am Horizont stehenden Herbstsonne, seinem alten Polo einen Tritt versetzte.
Mein Bruder und ich wechselten verstohlene Blicke.
Der Polo gehörte der Großtante. Theoretisch zumindest. Er war auf sie zugelassen, und sie zahlte die Versicherungen. In ihm gesessen hatte sie seit Jahren nicht mehr. Der Wagen stand auf unserem Hof, und mein Vater war der Einzige, der ihn fuhr. Er fuhr ihn, betankte ihn, sorgte dafür, dass er in Schuss blieb. Man konnte das als nette Geste bezeichnen. Auch das Wasser der Scheibenwischanlage füllte sich nicht von selbst nach. Und für das Ausbeulen nach dem letzten Hagel hatte er seiner Tante bloß einen Freundschaftspreis berechnet. Lauter nette Gesten. Schade, dass die alte Frau sie nicht zu schätzen wusste.
»Ich habe nicht die Absicht, euch etwas zu vererben«, murmelte meine Mutter, den Brief der Großtante in der Hand. »Die hat doch gar nichts zu vererben, die Alte.«
So ganz falsch war das nicht, schließlich hatte mein Vater seiner Tante einen Großteil ihrer Ersparnisse abgeschwatzt, um den Hof vergrößern zu können. Wie man das so macht bei älteren Leuten: Man schaut auf einen Kaffee vorbei, klagt ein wenig, scharwenzelt ein wenig, irgendwann bekommt man etwas geliehen, auf Treu und Glauben natürlich, unter Verwandten braucht man nichts Schriftliches, und schon ist der Stall gebaut und das Geld weg. Ach, es war gar nicht als Geschenk gedacht? Bloß geborgt? Dann muss das ein Missverständnis ... Jeder wusste, dass es so laufen würde. Nur meine Großtante nicht. Dabei war sie alles andere als vertrauensselig, sie glich einer Schnecke, die sich in ihr Haus zurückzog, sobald jemand etwas von ihr wollte. Und war dieser Jemand ein Verwandter, hängte sie Schloss und Riegel vor. Bei meinem Vater, ihrem Neffen, machte sie eine Ausnahme. Vielleicht, weil er ihr physisch der Nächste war; sie wohnte schräg gegenüber von uns. Vielleicht aber auch, weil er auf familiäre Bindungen ebenso pfiff wie sie. Oder sollte es am Ende damit zu tun haben, dass er schon seit Jahren polnische Erntehelfer unter Vertrag nahm und ihnen – nach polnischen Maßstäben – sogar ordentliche Löhne zahlte? Niemand wird darauf eine eindeutige Antwort geben können.
Mit den Polen jedenfalls hatte es seine eigene Bewandtnis. In der Küche des kleinen Hauses, das meine Großtante bewohnte, hingen ein paar verblasste Fotografien. Es roch immer ein wenig schäbig in dem Haus, besonders in der Küche: nach alten Möbeln, Eingemachtem, Billigware. Und die Fotos passten zu dem Geruch. Unser Dorfplatz war zu sehen, noch ohne Asphaltdecke, von einem Rinnsal in zwei Hälften geteilt. Ein Festtagsumzug, die Feiernden mit versteinerten Gesichtern. Schließlich eine Handvoll Menschen bei der Ernte, unter ihnen meine Großtante als junge Frau. Rechts am Bildrand verzog ein knochiger Kerl mit nacktem Oberkörper die Lippen zu einem Grinsen. Das war der Pole. Offiziell gab es keinen Namen für ihn, keine Geschichte, nur die Herkunftsbezeichnung. Als wir klein waren, dachten wir, alle Polen sähen aus wie er, oder er sei so eine Art Standardpole, nach dem sich die restlichen Bewohner seines Landes zu richten hätten. Vor allem was das Grinsen betraf.
Natürlich hatte der Pole doch seine Geschichte. Aber die erfuhren wir nicht von der Großtante, sondern von anderen. Genaugenommen von niemand Bestimmtem; mein Vater ließ eine Bemerkung fallen, meine Mutter machte eine Andeutung, auch die Nachbarn wussten etwas, ohne dem Mann mit dem nackten Oberkörper mehr als ein, zwei Sätze zu widmen. Über die Jahre fügten wir das Gehörte zu einer Geschichte zusammen, die erklärte, warum meine Großtante das Bild in der Küche hängen hatte.
»Es ist bloß ein Pole«, pflegte sie auf Nachfrage zu sagen. Ende des Themas.
Der Pole gehörte zu einer Gruppe Kriegsgefangener, die den Kaufunger Wald auf der Ladefläche eines LKWs erreichten. Zwölf von ihnen blieben bei uns im Ort. Verlegen standen sie auf dem Dorfplatz herum, betrachteten ihre Fußspitzen, kratzten sich in den Haaren. Läuse, sagten die Dörfler kennerisch und hielten Abstand. Polnische Läuse waren das, ukrainische, russische, weißrussische. Jeder Hof bekam einen Lausträger zugeteilt. Es war Sommer, auf den Feldern stand das Getreide dicht an dicht, und die Kaufunger Bauern kämpften an der Front. Also mussten die Gefangenen ran, die Ernte derjenigen einzubringen, die im Osten ihre Heimat verwüsteten. Bald wurde auf den Feldern russisch gesungen, polnisch geflucht, Blicke und Gesten wurden gewechselt. Das Alphabet der Hände erhielt täglich Zuwachs. »Essen« war eine der ersten Vokabeln, die die Gefangenen lernten. »Bier« vielleicht die allererste. Rasch füllten sich die Seiten ihres Wörterbuchs: Aufstehn. Arbeit. Kirche. Dreckskerl. Heilhitler. Prost. Und: scheene Frau.
Das sagte der Pole eines Tages bei der Arbeit zu meiner Großtante. Sie war keine schöne Frau. Sie war jung, eine Frau erst zur Hälfte und schön auf keinen Fall. Trotzdem widersprach sie nicht. Sie brachte dem Polen bei, wie man das Ö korrekt aussprach, und ließ ihn üben: scheene Frau. Schöne Frau. Söhr schöne Frau. Die Sonne brannte so stark, dass die meisten Gefangenen mit freiem Oberkörper arbeiteten. Sie waren nur zu zwölft, aber das Dorf brauchte Männer, in jeder Hinsicht. Im Herbst kam der LKW zurück und lud sie ein. Wiedersehn, sagten sie. Wiedersehn, scheene Frau. Einer rief sogar Heilhitler und lachte. Meine Großtante sah dem Laster lange hinterher. Sie ahnte: Die Zeiten würden schwerer werden. Noch zwei, drei Monate, dann ließ sich das Wachsen ihres Bauches nicht mehr verheimlichen.
In diesem Winter hatten Beleidigungen Konjunktur. Wer auch immer meiner Großtante begegnete, beschimpfte sie oder spuckte vor ihr aus. Überall hatte es heimliche Treffen mit den Gefangenen gegeben, es war geknutscht und gelacht worden, aber nur eine hatte sich schwängern lassen. Im Frühjahr kam das Kind zur Welt, und es war nicht gesund. Meine Großtante musste weit fahren, bis sie einen Arzt fand, der es behandelte, aber der Arzt war ein Ungeheuer, ein Trinker, den ein Sondergericht aus dem Verkehr zog. Da lag das Kind meiner Großtante schon in feuchter Kaufunger Erde, jenseits der Friedhofsmauern.
Nach dem Krieg nahm sich meine Großtante keinen Mann mehr. Sie hätte schon mögen, aber sie war nicht schön, ihr Ruf hatte gelitten, und Männer waren rar. Vielleicht hätte sie das Dorf verlassen sollen, wo jeder die Stelle kannte, an der das Polenbalg begraben lag. Sie tat es nicht, im Gegenteil. Je mehr sie ausgegrenzt wurde, desto stärker bemühte sie sich um Anerkennung. Sie wurde zu einer leidenschaftlichen, ja fanatischen Kirchgängerin. Im Gotteshaus zelebrierte ein hagerer Pfarrer, verschanzt hinter dickwandigen Brillengläsern, seine Predigten; derselbe Mann, der ihrem Kind die ewige Ruhe auf dem Friedhofsgrund verweigert hatte. Wie dieser Mann wettern, prophezeien konnte! Im Nachhall seiner Stimme nickten faltige Gesichter aus den Kirchenbänken. Meine Großtante aber hing an seinen Lippen, ihre Blicke flehten um Erbarmen, um Aufnahme in den Kreis der Sündelosen. Nach dem Gottesdienst nahm sie einen Umweg in Kauf, um vor einem Gedenkstein zu verweilen, der an die Toten des Krieges erinnerte. Sie las die Namen vieler Bekannter und Verwandter: Menschen, die für sie gefallen waren. Am nächsten Sonntag war sie wieder die Erste in der Kirche. Der Pfarrer ließ sich irgendwann versetzen.