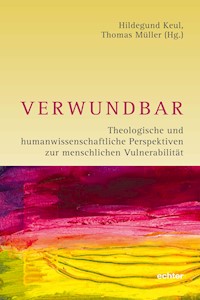
Verwundbar E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die menschliche Verwundbarkeit ist von großem humanem Interesse. Aus diesem Grund entwickelt sie sich in den letzten Jahren interdisziplinär zu einem innovativen Forschungsthema. Welche Machtwirkungen entfaltet die Vulnerabilität in aktuellen Debatten um Migration und Terror, sexuellen Missbrauch und interkulturellem Diskurs? Inwiefern sind Wunden ein Ort der Kommunikation, insbesondere in Liebe und Zuneigung, Fürsorge und Zärtlichkeit? In einer fruchtbaren Kooperation führten die Würzburger Forschungsgruppe "Vulnerabilität, Sicherheit und Resilienz" und das DFG-Projekt "Verwundbarkeiten" mit weiteren Partnerinnen zwei Ringvorlesungen an der Universität Würzburg durch. Die vorliegenden Beiträge beleuchten aktuelle Themen der Verwundbarkeit jeweils im Duett aus einer theologischen und humanwissenschaftlichen Perspektive. So kommen Wissenschaften in einen gesellschaftlich relevanten Dialog.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hildegund Keul,Thomas Müller (Hg.)
VERWUNDBAR
Hildegund Keul, Thomas Müller (Hg.)
VERWUNDBAR
Theologische und humanwissenschaftliche Perspektiven zur menschlichen Vulnerabilität
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
© 2020 Echter Verlag, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: Crossmediabureau
Coverbild: © Sybille Hermanns, „Verborgene Seelenlandschaften“, 11 × 22 cm, Öl auf Bütten, 2003, www.sybille-hermanns.de
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
E-Book ISBN 978-3-429-06519-5
Verschmerzen
Schön
wenn der verwundete Mensch
seine Narben
verschmerzt
sich gesellt
zum stillen Stein
zum beredeten Wasserfall
und sich erkennt
im Blick der
Nachbarpupille
Rose Ausländer
Rose Ausländer, Verschmerzen. Aus: dies., Wieder ein Tag aus Glut und Wind. Gedichte 1980-1982. © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1986. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I Vulneranz, eine humane Herausforderung
Topographie des Traumas – wie entsteht Resilienz?
Maike Schult
Verwundbarkeit und Verletzungsmacht: Dynamiken des Traumas
Eva Barnewitz
Wunden der Seele – wie die Folgen von Folter, Kriegserfahrungen und sequenzieller Traumatisierung überwunden werden können
Migration und Flucht – im Spannungsfeld von Trauma, Kreativität und Resilienz
Bernhard Kohl
Migration und Flucht – philosophisch-theologische Perspektiven
Melissa Silva
Flucht als Folge menschlicher Vulnerabilität – was Hannah Arendts „Flüchtlings“-Begriff in aktuellen Migrationsdebatten zu sagen hat
Vulnerabilität in Terrorangst und Radikalisierungsprävention
Katharina Obens
Vulnerabel für Radikalisierung? Sonderpädagogische Zugänge zur Radikalisierungsprävention
Hildegund Keul
Vulnerabilität und Vulneranz in Unsicherheit und Terrorangst – eine theologische Perspektive
Sexueller Missbrauch – Gewalt überwinden, Leben eröffnen
Mary Hallay-Witte
Institutionelle Vulneranz und Vulnerabilität. Sich anvertrauen – ein ethischer Moment
Elisabeth Kirchner
Sexualisierte Gewalt in Institutionen und der Beratungsansatz von „Wildwasser Würzburg“
II Liebe und Verletzlichkeit – die Wunde als Ort der Kommunikation
Familienbande – Wunden verbinden
Thomas Müller
Familien zwischen Bindung, Verstrickung und Verrat
Hildegund Keul
Vulnerante Rosenkriege und Heilige Familien – die Wunde als Ort der Kommunikation
Zärtlichkeit – die Schwester der Verletzlichkeit
Isabella Guanzini
Zärtlichkeit – die Schwester der Verletzlichkeit. Eine theologische Perspektive
Jutta Czapski
Zärtlichkeit – die Schwester der Verletzlichkeit. Eine philosophische Perspektive mit Emmanuel Levinas
Homosexuelle Liebe – Verletzlichkeit hoch zwei
Petra Dankova
Homosexuelle Liebe. Verletzlichkeit hoch zwei – aus sozialwissenschaftlicher Sicht
Andreas Heek
Homosexuelle Liebe. Verletzlichkeit hoch zwei – theologische Perspektiven
Verwundbarkeiten – interkulturell und interreligiös
Michaela Quast-Neulinger
Perfekte Harmonie oder radikale Exklusion? Theologische Perspektiven auf Verwundbarkeit im christlich-muslimischen Dialog
Dominik Egger
Interkulturalität – Fremdheit – Vulnerabilität. Über Bildung durch Responsivität
III Widerstand aus Vulnerabilität – Blickwechsel
Gott im Knast – Machtvollen Spiralen der Verwundbarkeit befreiend begegnen
Michelle Becka
Gott im Knast – theologische Perspektiven
Pierre-Carl- Link
Gott im Knast – humanwissenschaftliche Perspektiven
Leistung, Narzissmus und Verwundbarkeit. Anfragen an eine aktuelle Tendenz
Robert Langnickel
Narzissmus als Verleugnung der Verwundbarkeit – eine psychoanalytische Perspektive
Florian Klug
Verweigerte Relationalität. Narzissmus als selbstgeschaffene Hölle – eine theologische Perspektive
Verletzt im Vertrauen?
Katharina Ganz
Die Würzburger Ordensgründerin Antonia Werr (1813-1868) und Vertrauens(an)fragen in pädagogischen Beziehungen
Thomas Müller
Vertrauen – zur Ambivalenz eines pädagogischen Selbstverständnisses
Literatur
Autorinnen und Autoren
Einleitung
Die menschliche Verwundbarkeit ist von großem humanem Interesse, denn sie hat vielfache Auswirkungen: in der Politik und im persönlichen Zusammenleben, in Migrationsdebatten und Religionskonflikten, in Persönlichkeitsentwicklung und Traumabearbeitung. Aus diesem Grund entwickelt sich in den letzten Jahren Vulnerabilität zu einem Forschungsthema, das auch gesellschaftliches Interesse weckt. Welche Machtwirkungen entfaltet die Vulnerabilität in aktuellen Debatten um Migration und interkulturelle Kompetenz, Homosexualität und Vielfalt der Lebensformen, sexuellen Missbrauch und systemische Gewalt, Terrorgefahr und Radikalisierungsprävention?
Solche Fragen lassen sich interdisziplinär klarer beleuchten. Im Folgenden finden sich daher zu jedem Thema zwei Perspektiven, eine humanwissenschaftliche und eine theologische. „Gemischtes Doppel“ nannten wir dies, als wir in den Sommersemestern 2018 und 2019 an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zwei Ringvorlesungen durchführten, die diesem Buch zugrunde liegen. Im Folgenden rücken dabei zum einen die zerstörerischen Wirkungen der Vulnerabilität in den Blick. Zum anderen gehen wir der Frage nach, ob Verwundung und Verlust auch schöpferische Kräfte freisetzen können; denn Vulnerabilität macht angreifbar, aber auch berührbar. Sie ist Voraussetzung für Empathie und Solidarität, für Freundschaft, Liebe und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Selbst das Stiften von Frieden, eine der wichtigsten humanen Kompetenzen, ohne die die Menschheit keine Überlebenschance hätte, gelingt nur in Öffnung, in Verletzlichkeit.
Das vorliegende Buch ist in drei Themenkomplexe gegliedert, die vielfältig miteinander vernetzt sind.
I Vulneranz – eine humane Herausforderung
Wenn man Vulnerabilität erforscht, stößt man unweigerlich auf das, was seit kurzem und eher noch am Rande Vulneranzgenannt wird: die menschliche Gewaltsamkeit, die auf die Vulnerabilität Anderer zielt und eine Verletzungsmacht entwickelt, die persönlich und politisch verheerend wirkt. Dies zeigen Traumatisierungen, die durch Folter und Krieg, Terror und Fluchtmigration entstehen, in besonderer Weise. Für die Theologie, aber auch für andere Wissenschaften wie die Pädagogik ist zudem das Offenbarwerden der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch Missbrauch und Vertuschung in der katholischen Kirche ein Schlüsseldatum. Wer die Vulnerabilität untersucht, dabei aber die Vulneranz außer Acht lässt, bleibt auf einem Auge blind. Vulneranz ist daher eine humane Herausforderung, die es interdisziplinär zu analysieren und zu erforschen gilt. In diesem Sinn will das vorliegende Buch dazu beitragen, den Begriff der Vulneranz als Schlüsselbegriff der Vulnerabilitätsforschung zu etablieren.
II Liebe und Verletzlichkeit – die Wunde als Ort der Kommunikation
Weil Wunden schmerzlich sind, tun Menschen vieles, um sie zu vermeiden. Zu Recht sichern sie sich gegen Gefahren ab und wollen Schaden präventiv vermeiden. Aber wenn dennoch eine Verwundung geschieht, so zeigt sich Überraschendes: die Wunde wird zum Ort intensiver Kommunikation. Dies ereignet sich in Familienbanden, wo gemeinsam erlittene Wunden Menschen zusammenschweißen, im Guten wie im Bösen. Die Zärtlichkeit zeigt sich als sanfte Macht, die in Zeiten der Spaltung auf größeren gesellschaftlichen und politischen Einfluss drängt. Auch wo homosexuelle Menschen sich lieben, aber gesellschaftlich diskriminiert werden, entwickeln sie kreative Kulturen, die der Diskriminierung wehren. Religionspolitische Gewalt offenbart die dringliche Notwendigkeit zum interkulturellen und interreligiösen Diskurs, der sich in aller Verletzlichkeit dem Fremden öffnet. In Liebe und Zuneigung, Fürsorge und Zärtlichkeit wächst eine Kraft, die Menschen so zusammenführt, dass sie der erlittenen Vulneranz gemeinsam widerstehen.
III Widerstand aus Vulnerabilität – Blickwechsel
Um den kreativen Widerstand zu entdecken, der aus Vulnerabilitätserfahrungen erwachsen kann, sind Blickwechsel erforderlich. Wenn man im Gefängnis nicht nur die Vulneranz, sondern auch die hohe Vulnerabilität der inhaftierten Menschen wahrnimmt, kann vielleicht die unscheinbare, aber wirksame Präsenz Gottes offenbar werden. Die Hölle wird oft von Anderen erzeugt, aber auch im Narzissmus lauert eine Gefahr, die eigene Verwundbarkeit zu leugnen und sich selbst vom Leben abzuschneiden. Vertrauen ist ein hohes Gut, aber in der Pädagogik braucht es auch die Kompetenz, mit verletztem Vertrauen umzugehen und die Praktiken von Kindern zu verstehen, die wieder und wieder Verrat erlebt haben. Die Machtwirkungen, die der menschlichen Vulnerabilität erwachsen, sind vielfältig und immer wieder voller Überraschungen.
Unser herzlicher Dank gilt allen, die zum vorliegenden Buch beigetragen haben:
• Der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), welche die Ringvorlesungen und die Entstehung des Buchs über das Forschungsprojekt „Verwundbarkeiten“ inhaltlich und finanziell ermöglicht hat (gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 3892490411)
• Der Katholisch-Theologischen und der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg für ihre nachhaltige Unterstützung unserer interdisziplinären Forschung
• Unserer Würzburger Forschungsgruppe „Vulnerabilität, Sicherheit und Resilienz“ für die tatkräftige Mitwirkung in allen Phasen unserer Arbeit
• Dem Würzburger Studienprogramm „Gesellschaftliche Systeme und interkulturelle Kompetenz“, der sich ein roter Faden des vorliegenden Buchs verdankt, für die hervorragende Kooperation in Ringvorlesung und Buchentstehung
• Der Domschule Würzburg mit Dr. Rainer Dvorak für ihre entgegenkommende Gastfreundschaft bei der Ringvorlesung
• Dem Echter-Verlag mit Thomas Häußner für die sorgfältige Betreuung der Publikation
• Frau Alexandra Birk für ihre große Mühe mit Formatierungs- und Zusammenführungsaufgaben
• Der Osnabrücker Künstlerin Sybille Hermanns, die uns ein zur Vulnerabilität passendes Bild ihrer Farblandschaften als Titelbild zur Verfügung gestellt hat
• Und last but not least den Autorinnen und Autoren, die sich auf das interdisziplinäre Duett eingelassen und einen Beitrag für dieses Buch verfasst haben. Engagiert kommen sie dem Anspruch nach, Forschung in gesellschaftlicher Verantwortung zu betreiben
Den Leserinnen und Lesern wünschen wir eine anregende Lektüre.
Würzburg, im Januar 2020
Hildegund Keul & Thomas Müller
I Vulneranz,eine humane Herausforderung
Topographie des Traumas – wie entsteht Resilienz?
Das Wort Trauma ist mittlerweile in aller Munde. Unglück und Katastrophen, Kriege und menschliche Gewalt verletzen Menschen so nachhaltig, dass es sie häufig ein Leben lang zeichnet. Aber was genau ist ein Trauma, was eine Posttraumatische Belastungsstörung? Gibt es Wege, mit der erlittenen Gewalt anders umzugehen und ihr Zerstörungspotential einzudämmen? Das erläutern die Praktische Theologin Maike Schult und die Psychologin Eva Barnewitz.
Maike Schult
Verwundbarkeit und Verletzungsmacht: Dynamiken des Traumas
1. Loch, Lücke, wunder Punkt: Zur Topographie des Traumas
Trauma ist ein kurzes Wort für ein komplexes Phänomen. Ein sprachliches Gefäß für Erfahrungen, die unfasslich scheinen und sich kaum auf den Begriff bringen lassen. Das hängt mit der Vielzahl der Ereignisse zusammen, die traumatisierend wirken und heftige Affekte auslösen können. Es hängt aber auch an der Verstörung sprachlicher Zusammenhänge durch das, was die Sprache verschlägt, was fassungslos macht und sich nicht begreifen lässt. Traumatische Ereignisse fahren direkt in die Glieder. Sie wollen nicht in den Kopf. Sie brechen in den Alltag ein, plötzlich und unerwartet. Sie lösen Angst und Schrecken aus, übersteigen die Verarbeitungskapazität eines Individuums, entmächtigen es seiner Souveränität und Handlungsmöglichkeit und ziehen tiefes Leid nach sich. Sie verletzen das menschliche Bedürfnis nach Verlässlichkeit und erschüttern die Vorstellung von dem, was sein sollte und was nicht. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, und alles anders wird, wenn es dennoch geschieht. Doch während die Betroffenen zurückbleiben mit dem Gefühl: nichts ist mehr, wie es war, tun andere oft so, als ob nichts geschehen wäre. So fallen Traumatisierte aus der Gemeinschaft heraus, deren Zeiterleben weiterläuft und deren Grundannahmen unberührt bleiben von dem, was ihnen widerfahren ist. Traumatische Ereignisse haben damit immer eine soziale Dimension. Sie konfrontieren mit den gewaltvollen Aspekten unseres Zusammenlebens, mit den dunklen Seiten unserer Ordnung und mit einer Wahrheit, die niemand wissen will: dass unser Leben zerbrechlich ist und die Welt ein riskanter Ort, an dem Menschen einander schaden, und dass „im Extrem ein einziges Gewaltwiderfahrnis“ ausreicht, um einen Menschen seelisch zu zerstören (Seidler 2013, 17).
Trauma ist daher eng mit dem Tabu assoziiert (Gottfried/Riedesser 2009, 39 &183) und mit einer spezifischen Doppelbewegung verbunden aus Aussprechen und Verschweigen, Verweisen und Verhüllen. Denn der Traumabegriff signalisiert die Verwundungen, die in einer Gesellschaft vorkommen, ohne sie konkretisieren zu müssen. Er verweist auf eine Tabuzone, die um die Verletzungen herum entsteht, ohne sie damit schon zu berühren, und markiert den Tabubezirk, den eine traumatische Erfahrung im Leben der Betroffenen hinterlässt und der ihnen selbst und anderen lange verborgen bleiben kann.
Auch das Trauma ereignet sich oft im Verborgenen: in abgesperrten Bereichen wie Haftanstalten, Lagern und Folterzellen, bei Geheimdiensten und beim Militär, viel öfter aber in öffentlichen Einrichtungen, in staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen wie Firmen, Vereinen und Betrieben, in Familien, Schulen und Kirchen. Dort geschieht es als scheinbare Ausnahme von der Regel, die in den Alltag einbricht und die Tagesordnung durcheinanderwirft, doch wird es von den täglichen Strukturen auch getragen, ja vielfach durch sie erst ermöglicht, wenn es sich innerhalb der verabredeten Gesellschaftsordnung vertuschen und verschleiern, bagatellisieren und legitimieren lässt, statt sanktioniert und geahndet zu werden.
Das Trauma hat dabei eine ambivalente Funktion. Einerseits bricht es als explosive Kraft brutal in den Alltag ein und kann hier mit großer Wucht alle erfassen, die in seinen Sog geraten: nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Beobachter und Zeuginnen, Helfer und Therapeutinnen können emotional von ihm erfasst werden, ja allein die sprachliche Konfrontation kann traumaspezifische Ängste auslösen und auch diejenigen berühren, die nur auf der wissenschaftlichen Ebene mit ihm in Kontakt kommen. Andererseits stellt Trauma auch jedes Ordnungsgefüge, in dem wir leben, subversiv in Frage. Es deckt dessen Grausamkeit auf und kann dazu führen, dass Menschen den Mut aufbringen, das Tabuisierte beim Namen zu nennen, sich politisch und sozial zu engagieren und durch Prävention und Sanktionen dafür zu sorgen, dass die Gewalt begrenzt wird. Das Trauma selbst aber ist ein unberührbarer Bereich. Es ist als historische Tatsache der Vergangenheit präsent und potentiell immer da, für jeden in jedem Augenblick. Doch das Trauma „an sich“, jetzt und hier, gibt es nicht (Bokanowski 2005, 11). Was es gibt, sind traumatogene Ereignisse, die Traumafolgen in Gang bringen können, und das spezifische, individuell recht unterschiedliche Erleben dieser Ereignisse sowie Theorien, Konzepte und Denkmodelle, die das Zusammenspiel von Ereignis und Erleben zu klären suchen, und viele persönliche Leidensgeschichten, die das, was die Sprache verschlägt, nachträglich in Worte fassen. Im besten Fall kann sich dies zu einer Traumaerzählung formen und so das Loch füllen, das durch das Trauma entstanden ist.1 Das Trauma selbst hingegen bleibt eine Wunde ohne Kontur, nicht zu fassen und nicht zu berühren.2
Sprachhistorisch stammt das Wort τραũµα aus dem Griechischen und wird meist mit „Wunde“ oder „Verletzung“ ins Deutsche übersetzt.3 Ursprünglich stammt es aus der griechischen Seefahrersprache und bezeichnete dort Lecks und andere Schäden, die Stürme, Strömungen und Klippen in die Schiffe schlugen und die Mannschaften an Leib und Leben gefährdeten, so dass es auch „Verlust“ und „Niederlage“ bezeichnen konnte.4 Die Medizin übernahm den Begriff für körperliche Wunden und benannte damit die Verletzung eines Gewebes, ehe der Terminus im 19. Jahrhundert von der Chirurgie aus auf psychische Vorgänge übertragen und nun für seelische Verletzungen verwendet wurde, die durch Einwirkung von außen, durch Unfälle und Kriege etwa, entstehen und mit einem Erlebnisgehalt verbunden sind, der die Betroffenen auffallend lange begleitet. In diesem Zusammenhang avancierte Trauma zum zentralen Fachbegriff der Psychoanalyse, später auch der Psychotraumatologie, die teils sich überlappende, teils unterschiedliche Konzepte mit ihm verbinden.
Mit der Anerkennung der Posttraumatischen Belastungsstörung im Jahr 1980 als einer möglichen Traumafolge von vielen und der Gründung der Psychotraumatologie als eigenständiger Wissenschaftsdisziplin im Jahr 1991 lassen sich zwar inzwischen zwei markante Vermessungspunkte zur Topographie der Traumaforschungbenennen, und auch die Präsenz und Popularisierung des Traumabegriffs lässt sich ab den 1990er Jahren gut nachweisen. Das Trauma selbst aber bleibt unsichtbar und undarstellbar.5
Die Frage nach der Darstellbarkeit dieses Undarstellbaren findet sich nun vor allem in der Kunst,6 wofür ein Beispiel genügen soll: 2018 hatte das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe im Rahmen der „Tage des Exils“7 Werke des syrischen Künstlers Khaled Barakeh präsentiert. Barakeh, der 1976 in Damaskus geboren wurde und inzwischen in Berlin lebt, beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit politischen Machtstrukturen, mit Folter, Flucht und Exil und mit den Langzeitfolgen kriegerischer Auseinandersetzungen. Die von ihm entworfenen und in der Hamburger Ausstellung dargebotenen Fotografien hatten Momente des Verlustes gezeigt. Auf ihnen sind Menschen zu sehen, die, nur einen Augenblick entfernt, einen anderen Menschen verloren haben, ein Kind, einen Freund, die eigene Frau vielleicht, und die die Toten noch in den Armen halten. Dabei hatte der Künstler die Körper der Verstorbenen so aus dem Bild ausgeschnitten, dass nur ihre Silhouette als weißer Fleck sichtbar ist und die Identität der Opfer verhüllt bleibt. „The Untitled Images“ heißt die Reihe, die auf diese Weise den Blick auf die Überlebenden lenkt und zugleich die brutale Realität des syrischen Krieges anzeigt – die Grausamkeit des Regimes, aber auch die „Gewalt, die vom Akt des Zeigens durch die Medien ausgeht.“8 Die weiße Leerstelle lässt sich dabei als Traumadarstellung interpretieren. Sie markiert die Lücke, das Loch, den wunden Punkt, den die Überlebenden fassungslos in Händen halten und der ihr Leben von nun an begleiten wird.9
2. Verwundbarkeit und Verletzungsmacht: Zur Wirkung des Traumas
Trauma ist von seiner Wortbedeutung („Wunde“), aber auch von seinen Auswirkungen her der Inbegriff menschlicher Verwundbarkeit, doch taucht das Wort in einschlägigen Handbüchern der Psychotraumatologie eher selten auf. Ähnliches gilt für den latinisierten Fachbegriff ‚Vulnerabilität‘ im Sinne einer bestimmten Anfälligkeit, an etwas zu erkranken.10 Es gilt aber auch für den Vulnerabilitätsdiskurs11 und seinen Gegenspieler, den Resilienzdiskurs, der in der Psychotraumatologie eher zurückhaltend verhandelt wird und hier als „Posttraumatische Reifung“ (posttraumatical growth!) eine eigene Interpretation erfährt.12 Das mag damit zusammenhängen, dass das Trauma auf ein Ereignis der Vergangenheit zurückverweist und zugleich seine anhaltende Gegenwartwirkmächtig markiert:13 Für die Betroffenen ist die Einordnung des Traumas in einen zeitlichen, räumlichen und kausalen Zusammenhang oft nicht möglich. Erinnerungen an das auslösende Ereignis erscheinen fragmentiert wie Bruchstücke, die sich nicht zu einem Gesamtbild fügen. Wird das Ereignis durch bestimmte Trigger neu angesprochen und in Form von Intrusionen wie Flashbacks und Alpträumen wiedererlebt, so geschieht dies in einem „Hier-und-Jetzt-Gefühl“ (Neuner, Schauer & Elbert 2013, 333), das das vergangene Geschehen wie gegenwärtig erleben lässt und die innere Distanzierung verhindert. Vulnerabilität hingegen, so Hildegund Keul (2017, 589ff.), ist eine „Zukunftskategorie“. Er verweise auf die Furcht, in Zukunft verwundet zu werden, und diese Furcht bestimme das Verhalten in der Gegenwart. Daraus könnten sich zwei destruktive Wirkungsweisen entwickeln: Zum einen verkörpere sich die eigene Verwundbarkeit in Form der Narbe, die zurückbleibt – ursprünglich um die Wunde zu schützen, dann aber vielleicht auch mit der Folge, auch lebensfördernde Bindungen zu meiden. Zum anderen könne man dazu übergehen, andere zu verwunden, um nicht selbst verwundet zu werden, und mit dieser „Herodes-Strategie“, dieser Gewaltanwendung aus Selbstschutz, etwas ausprägen, was sie als „Vulneranz aus Vulnerabilität“ bezeichnet.14
Auch in der Traumaforschung lässt sich eine solche Bewegung ablesen und damit noch einmal der Blick lenken auf die komplexe Wirkmacht des Traumas – nicht nur in Bezug auf die Opfer,15 sondern auch in Bezug auf die Täter. Denn auch Täter und Täterinnen können gelegentlich vor ihrer Tat traumatisiert gewesen sein und aus dieser Vorerfahrung überhaupt erst den Antrieb entwickelt haben, einen anderen Menschen zu verletzen – sei es aus Selbstschutz, sei es aus Rache oder um das tiefe Ohnmachtserleben, das für eine traumatogene Situation charakteristisch ist, durch eigenes Machterleben zu kompensieren. Sie können aber auch durch ihre eigene (Straf-) Tat traumatisiert werden (sogenanntes ‚Tätertrauma‘) oder durch die Haft, die sich der Tat anschließt.16 Einen Automatismus zwischen verletzenden Vorerfahrungen und eigenem verletzenden Verhalten gibt es aber nicht: „Nachdrücklich muss davor gewarnt werden, davon auszugehen, dass jeder Mensch mit eigenen Gewalterfahrungen zwangsläufig zum Täter wird“, so der Psychotraumatologe Günter H. Seidler (2013, 163). Und die allermeisten Täter, auch das ist festzustellen, bleiben eigenartig unberührt von dem, was sie getan und zu verantworten haben.17
Ereignisse, die wir mit dem Traumabegriff sprachlich zu fassen suchen und die das Leben von Einzelnen, aber auch ganzer Gesellschaften über die Generationen hinweg prägen können, setzen in der Regel eine Zäsur, die sich trotz guter Therapiemöglichkeiten nicht wieder aus der Welt bringen lässt. Das Leben vor dem Trauma gibt es nicht mehr, und dies zu akzeptieren ist die schmerzhafte, manchmal lebenslange Aufgabe der Betroffenen. Das macht nicht nur den Begriff der Heilung schwierig. Es wirft auch grundsätzlich die Frage auf, wie man mit Unabänderlichem im Leben zurechtkommt und die Spiralen der Gewalt unterbricht. Getanes lässt sich nicht rückgängig machen. Weiße Flecken wie auf den Verlustbildern von Khaled Barakeh lassen sich nicht wieder füllen. Und doch gibt es Möglichkeiten, sich auf die Realität der Verletzlichkeit einzustellen, ohne dem Erlittenen oder Selbstverursachten nur schicksalhaft ausgeliefert zu bleiben, wie ich abschließend an zwei Ansätzen skizzieren will:
1. Mit der jüdischen Philosophin Hannah Arendt (1906– 1975) können wir die menschliche Fähigkeit des Verzeihens als ein „Heilmittel gegen die Unwiderruflichkeit“ (Arendt 2010, 301) verstehen. Das Verzeihen ist für sie der natürliche Gegensatz zur Rache und eine Möglichkeit, die einmal entfesselte Gewalt zu regulieren, die in Gang gebrachte Kettenreaktion zu unterbrechen und sich aus dem Automatismus eines einmal losgelassenen Handlungsprozesses auszulösen: „Verzeihen ist die einzige Reaktion, auf die man nicht gefaßt sein kann, die unerwartet ist, und die daher, wiewohl ein Reagieren, selber ein dem ursprünglichen Handeln ebenbürtiges Tun ist. Weil das Verzeihen ein Handeln eigener und eigenständiger Art ist, das zwar von einem Vergangenen provoziert, aber von ihm nicht bedingt ist, kann es von den Folgen dieser Vergangenheit sowohl denjenigen befreien, der verzeiht, wie den, dem verziehen wird“ (ebd. 307). Das Vergeben ist also eine dem Handeln innewohnende Fähigkeit zur „Korrektur des Mißratenen“ (ebd. 308). Es beziehe sich aber nur auf die Person, nicht auf die Sache selbst – Unrecht bleibt unrecht. Und auch das Verzeihen brauche die Freiheit, es nicht zu tun und stattdessen zu bestrafen. Gerade die Vergehen, die sich als unbestrafbar herausstellen, sind nach Hannah Arendt auch die, die wir außerstande sind zu vergeben: das mit Kant gesprochen „radikal Böse“ (ebd. 309). Wir erkennen es eben daran, dass wir es weder bestrafen noch vergeben können. Es übersteigt den Bereich menschlicher Angelegenheiten und entzieht sich menschlicher Macht. Solche Taten, so Arendt, sind ‚Un-Taten‘, die alles weitere Tun unmöglich machen. Was aber das Verzeihen innerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten betrifft, so habe wohl Jesus von Nazareth dies zuerst gesehen und entdeckt (ebd. 304).18
2. Ein Trauma kann auch theologisch nicht geheilt und nicht aus der Welt gebracht werden. Auch wenn wir mit dem biblischen Erzählbestand beides haben: Traumanarrative19und Hoffnungsbilder, die die „Pathologie der Realität“ (Hillebrandt 2004, 108-109) anzeigen und die Vision eines anderen Zusammenlebens entwerfen, jenseits von Hass und Gewalt. Doch selbst am auferstandenen Christus sind die Wundmale nicht verschwunden, wie insbesondere der ungläubige Thomas verifizieren muss, indem er mit der Hand die Wunden berührt (Johannes 20, 24–29). Mit dem Marburger Theologen Henning Luther (1947–1991) werden wir darum vielleicht insgesamt vorsichtiger, uns über die Bedingungen unseres Zusammenlebens zu täuschen und uns zu schnell mit den „Lügen der Tröster“ (Luther 1998, 376f.) über Verletzungen hinwegzutrösten. Denn selbst wenn wir uns durch Theologie oder Therapie für uns privat beruhigt und wieder in Ordnung fühlen könnten – die strukturellen Bedingungen unseres Zusammenlebens sind damit nicht aus der Welt; das Leid der anderen bleibt.20
Für den theologischen Traumadiskurs wird es daher in Zukunft darum gehen, auch religiös eine Haltung zu finden, die „Schmerz und Sehnsucht“ (Luther 1992, 231ff.) einschließt und Religion nicht als ein Heilmittel (miss-) zu verstehen, das das Leben angenehm macht, sondern sie, in Anlehnung an einen Gedanken von Joachim Gauck, stärker noch als die Kraft zu profilieren, die Menschen dazu ermächtigt, sich dem Unangenehmen im Leben zu stellen,21 um auch angesichts tiefster Verwundungen beunruhigt und berührbar zu bleiben.22
1 Dieses Ziel verfolgt die Narrative Expositionstherapie (NET), vgl. den Beitrag von Eva Barnewitz im vorliegenden Band.
2 Zum Wortfeld Wunde, Haut und Narbe vgl. Fischer-Homberger, E. (2005). Zur Geschichte der Verletzung: Seidler, G. H. & Eckart, W. (2005).
3 Zu dem Verbum τιτρώσκω: eigentlich „durchbohren“, „verwunden“, „verletzen“, aber auch „beschädigen“ (in Bezug auf Schiffe) und „betören“; vgl. Gemoll, W. (1991) und Kluge, F. (2002, 927).
4 Vgl. dazu auch die Sturm-Beispiele im Beitrag von Eva Barnewitz im vorliegenden Band sowie: Schult, M. (2018).
5 Auch die PTBS tritt ja erst „post“, also nach dem Ereignis selber ein.
6 Zur grundlegenden Unterscheidung von Trauma als einem klinischen Fachbegriff und Trauma als einem kulturellen Deutungsmuster vgl.: Schult, M. (2019). Vgl. auch Lançon, Ph (2019), in dem der Autor als Überlebender des Anschlags auf die Redaktion von Charlie Hebdo 2015 Leere und Schmerz der Katastrophe beschreibt.
7 Die „Tage des Exils“ werden von der Körber-Stiftung veranstaltet. Die dritte Reihe fand vom 15. Oktober bis 16. November 2018 statt.
8 Vgl. dazu den Kurztext und die Abbildung von The Untitled Images 2/2014 in: Forschung & Lehre 12 (2018), 1091. Sowie das Interview mit K. Barakeh von M. M. Müller: „Ich will die Strategie von Zeigen und Nichtzeigen begreifen“, Orbanism (17.03.2016). Abrufbar unter: https://orbanism.com/frohmann/tabletalk-europe/2016/ich-will-die-strategie-von-zeigen-und-nichtzeigen-begreifen/.
9 Ähnliche Sprachbilder finden wir in Forschungsberichten zum transgenerationalen Zusammenhang von Traumatisierungen. Dort erscheint das Trauma als dissoziative Lücke, psychische Leere und schwarzes Loch, als Phantom und leerer Kreis, als Fremdkörper im eigenen Selbst, als Schatten oder Introjekt. Vgl. Danieli, Y. (1998).
10 Als „Vulnerabilitäts-Hypothese“ wird hier z.B. die höhere Wahrscheinlichkeit verstanden, aufgrund einer anderen Prädisposition wie Suchtverhalten nach einer Traumaexposition eine Störung wie die PTBS zu entwickeln. Vgl. Schäfer, I (2015, 267).
11 Zur Genese des Vulnerabilitätsdiskurses vgl. Keul, H. (2017).
12 Vgl. dazu Schult, M. (2017). Zur Frage, ob es sich bei den Diskursen zu Verwundung und Resilienz wirklich um Gegenspieler handelt oder ob sich die Phänomene nicht auch konstruktiv zusammendenken lassen vgl. Keul 2017.
13 Der Unterschied im Zeitbezug ist aber nur das eine. Das andere ist, dass in der Geschichte der Traumaforschung sehr lange um die Einsicht gekämpft werden musste, dass nicht nur ‚schwache‘ Naturen Traumafolgestörungen ausprägen, weil sie eine wie auch immer geartete Prädisposition dafür bereits mitbringen, sondern dass Trauma jeden Menschen und auch jede ‚starke‘ Persönlichkeit unwiderruflich aus dem Lot bringen kann.
14 Die Diskursbegriffe Vulneranz und Vulnerabilität gehen zurück auf das lateinische „vulnus“ für „Wunde“ und das Verbum „vulneare“ („jemanden verwunden“) und zeigen damit sprachliche Nähe zum Trauma. Trauma bezeichnet aber eben auch Loch, Leck und Verlust und damit stärker das Nicht-Fassbare und Nicht-Sichtbare einer einschneidenden Verletzung.
15 Vgl. zu den Opfern und zu möglichen therapeutischen Behandlungsschritten den Beitrag von Eva Barnewitz in diesem Band.
16 Vgl. dazu den Abschnitt „Gibt es traumatisierte Täter?“ bei Seidler 2013, 162–164. Zum Phänomen „Tätertrauma“ vgl. Giesen, B. & Schneider, Ch. (2013).
17 Sie erweisen sich damit gerade als besonders ‚resilient‘, was im Resilienzdiskurs nicht immer gut bedacht wird. Dort ist Resilienz meist positiv konnotiert.
18 Aber auch Jesus verzeihe kein radikal Böses. Für den Täter einer solchen Untat sei es besser, mit Jesus zu sagen: „‚Es wäre ihm nützer, daß man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer‘“. Vgl. Arendt, H. (2010), 308.
19 Vgl. exemplarisch die Marburger Dissertation von Poser, R (2012).
20 So in Luther 1998 thematisiert, vgl. aber auch grundlegend die posthum erschienenen Aufsätze in: Luther, H. (1992).
21 So allgemeiner geäußert in der Dankesrede anlässlich der Verleihung der Ehrenpromotion an den Bundespräsidenten a. A. am 29. Oktober 2018 durch die Theologische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Vgl. dazu den abzurufenden Text unter https://www.theol.uni-kiel.de/de/die-fakultaet/retrospektive/ws-2018-19-1/rede-dr-h-c-j-gauck.
22 In diesem Sinne hatte schon H. Luther den Glauben selbst als das Beunruhigende entworfen (Luther 1998), der die Kraft verleihe, sich am Vorfindlichen zu stören und aus ihm aufzubrechen. Vgl. dazu Luther, H. (2008).
Eva Barne witz
Wunden der Seele – wie die Folgen von Folter, Kriegserfahrungen und sequenzieller Traumatisierung überwunden werden können1
„Immer wieder kommen die Alpträume. Dann höre ich, wie das Wasser gegen das Boot schlägt, ich höre die Schreie meiner Freunde. Davon wache ich schweißgebadet auf. Dann brauche ich oft drei Stunden, bis ich wieder einschlafen kann. Und dann geht der Traum wieder von vorne los.“
Traumatisierung – dieser Begriff ist für viele Menschen untrennbar mit Krieg, Folter und Flucht verbunden, und häufig mit Unsicherheit, Angst und Tabus behaftet. Zugleich wurden Begriffe wie „traumatisiert“, „Trauma“ und „Posttraumatische Belastungsstörung“ (PTBS) in den vergangenen Jahren immer häufiger in deutschen Medien und Publikationen verwendet – oft „unscharf bis inflationär“ (Busch & Hermann 2019). Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Trauma genau? Und warum steigt mit der Anzahl der verschiedenartigen erlebten traumatschen Ereignisse die Vulnerabilität für eine Posttraumatische Belastungsstörung? Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Neurobiologie und Psychologie sowie traumatherapeutischer Arbeit mit Geflüchteten wird im Folgenden ein Einblick gegeben in die klinische Definition von „Trauma“, in die Genese der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), und in die Narrative Expositionstherapie, einem evidenzbasierten und kulturübergreifend wirksamen Kurzzeitverfahren zur Behandlung multipel und sequenziell traumatisierter Personen (Schauer et al. 2005). Am Kompetenzzentrum Psychotraumatologie der Universität Konstanz habe ich mehrere Jahre Geflüchtete mit dem Ansatz der Narrativen Expositionstherapie behandelt; für vivo international e.V. und andere NGOs im internationalen Kontext bilde ich Therapeuten und Therapeutinnen darin aus, mehrfach und sequenziell traumatisierte Personen zu behandeln. Traumatische Ereignisse sind nicht nur weltweit präsent; sie sind so alt wie die Menschheit. Es ist an der Zeit, die Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Definition sowie ihrer Auswirkungen auf das Individuum, und Berührungsängste hinsichtlich des Umgangs mit belastenden Folgen aufzulösen.
1. Leidvolle Ereignisse
„Und dann sagte mein Vater mir, dass er sich von meiner Mutter trennen würde. Für mich brach eine Welt zusammen. Für einen Moment hielt die Zeit an. Wie sollte es jetzt weitergehen?!Ich würde mich entscheiden müssen zwischen ihnen.“
Umgangssprachlich wird „traumatisch“ häufig synonym mit „leidvoll“ verwendet – Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung (Schröder 2011; Spiewak 2014) und ähnliche Ereignisse werden als traumatisch betitelt. Obgleich solche Ereignisse als hoch belastend erlebt werden können und die Vulnerabilität für verschiedene psychische Erkrankungen steigern können, sind sie im klinischen Sinne nicht als „traumatisch“ zu bezeichnen. Bereits im 19. Jahrhundert beschäftigte sich die Forschung mit Möglichkeiten der Benennung, Differenzierung und den Auswirkungen traumatischer Ereignisse; „Kriegsneurose“, „Hysterie“ und „Dissoziation“ sind hier beispielhaft zu benennen (vgl. van der Kolk & van der Hart 1989). 1991 prägten van der Kolk & van der Hart den Begriff des „Sprachlosen Schreckens“ als Zustand, in den Menschen nach traumatischen Ereignissen geraten können. Worte können nicht beschreiben, was passiert ist, während die Erinnerung an das traumatische Geschehen mit all ihrem Entsetzen allgegenwärtig bleibt. Doch es bleibt die Frage: „Was ist ein traumatisches Ereignis?“
2. Traumatische Ereignisse
„Der Himmel war plötzlich ganz dunkel. Ich dachte: ‚Hoffentlich schaffen wir es.‘ Ich spürte, wie der Wind an meiner dünnen Jacke zerrte. Mir war kalt. Im Gesicht spürte ich das kalte Wasser. Ich schmeckte es auch. Mein Herz schlug schnell. Wir waren mitten im Meer und im Sturm, und es war keiner da, der uns helfen konnte. Wir haben oft geschrien ‚ Was sollen wir tun?‘“
Das DSM-V (Diagnostischer und Statistischer Leitfaden psychischer Störungen, 5. Auflage, American Psychological Association APA 2013), bietet eine klare Definition traumatischer Ereignisse: Es bezeichnet solche Erfahrungen oder Ereignisse als traumatisch, bei denen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit einer Person bedroht oder verletzt wird; diese Ereignisse können (a) selbst erlebt werden, (b) direkt bezeugt werden (sehen/hören), (c) indirekt bezeugt werden (eine Person erfährt, dass das traumatische Ereignis einer/einem Familienangehörigen oder anderen nahestehenden Person widerfahren ist) oder (d) die Person wird wiederholt oder extrem aversiven Details traumatischer Ereignisse ausgesetzt (beispielsweise Mitglieder der Staatsanwaltschaft, die wiederholt gewaltvolles Material sichten) (APA 2013). Nach dieser Definition wird die subjektive Reaktion der Person auf das Ereignis sowohl in der Situation wie auch später ausgeklammert. Aussagen wie „Das war damals gar nicht so schlimm“ oder „Am Ende ist es ja doch gut ausgegangen“ sind für die therapeutische Arbeit zwar interessant, doch irrelevant für die Beurteilung, ob ein Ereignis im klinischen Sinne als „traumatisch“ anzusehen ist. Auch begleitende Umstände wie Vulnerabilität durch belastende Kindheitserfahrungen, genetische Faktoren, Dauer des erlebten Ereignisses, oder protektive Faktoren wie psychosoziale Unterstützung werden in der klinischen Definition nicht berücksichtigt. Das Vorliegen eines solchen traumatischen Ereignisses ist die Voraussetzung für die klinische Diagnose einer post-traumatischen Belastungsstörung, deren Symptome im Folgenden erläutert werden.
3. Posttraumatische Belastungsstörung
„Ich glaube manchmal, ich bin verrückt geworden. Wenn jemand mich nach meiner Fluchtgeschichte fragt, will ich gar nicht darüber reden. Ich sage dann einfach, es sei gar nicht so schlimm gewesen. Aber mein Herz schlägt ganz schnell. Ich glaube, ich werde niemals ruhig daran denken können.“
Entsteht durch ein traumatisches Ereignis ein Bruch in der Lebensgeschichte, kann die betroffene Person eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln, die laut DSM-V folgende Symptombereiche umfasst: Intrusionen (plötzlich und ungewollt auftretende Erinnerungen, Alpträume, Flashbacks, starke emotionale oder körperliche Reaktionen auf Erinnerungsreize); Vermeidung (externale und internale Hinweisreize auf das Erlebte werden soweit als möglich umgangen, z.B. Gespräche über das Erlebte, Kontakt zu bestimmten Personen oder Tätigkeiten); Negative Veränderungen in Kognition und Stimmung (die Unfähigkeit, positive Gefühle zu empfinden, andauernde emotionale Taubheit und Isolation, Vertrauensverlust); und Übererregung (Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Wutausbrüche, massiv erhöhte Schreckreaktionen). Um im klinischen Sinne von einer PTBS sprechen zu können, müssen aus allen Symptombereichen mindestens ein oder mehrere Symptome über eine Zeitspanne von mindestens vier Wochen vorliegen; des Weiteren muss eine Einschränkung der Funktionalität in relevanten Lebensbereichen (soziale/familiäre Beziehungen, schulische/berufliche Leistungen) vorliegen (APA 2013). Zeigt eine Person die oben genannten Symptome innerhalb der ersten vier Wochen nach einem traumatischen Ereignis, wird dies als „Akute Belastungsreaktion“ bezeichnet (DSM-5, APA). Hausmann (2016, 51) schreibt hierzu: „Sie wird als normale Reaktion auf ein extrem bedrohliches oder schreckliches Ereignis angesehen, die nach einigen Tagen wieder abklingt, sofern das Ereignis vorbei ist.“
Lange wurde die PTBS als Angststörung klassifiziert (APA 2000); sie kann aber ebenso als Störung des Erinnerungsvermögens angesehen werden, denn das Geschehen des „Damals“ und „Dort“ kann nicht mehr adäquat vom Erleben im „Hier“ und „Jetzt“ getrennt werden (Elzinga & Bremner 2002). Der Schrecken der Vergangenheit erhält – über Intrusionen, Schreckreaktionen und Alpträume – Einzug in die Gegenwart. Dieser erlebte Bruch spiegelt sich auch auf neurobiologischer Ebene wider: Erinnerungselemente, die normalerweise verknüpft sind, werden fragmentiert abgespeichert. Nach Squire & Zola-Morgan (1991) können Gedächtnisinhalte unterteilt werden in „explizites“ (verbalisierbares), und „implizites“ (nicht verbalisierbares) Gedächtnis. Das explizite Gedächtnis enthält sowohl Faktenwissen als auch autobiographische Informationen; diese umfassen neben allgemeinen Informationen über Lebensabschnitte auch ereignisspezifische, faktenbezogene Informationen zum Kontext dieses Erlebnisses („Was ist passiert? Wo ist es passiert? Wann ist es passiert?“). Diese „kalten Informationen“ sind bei emotional relevanten Ereignissen eng verknüpft mit den sogenannten „heißen Erinnerungen“ (Metcalfe & Jacobs 1996; Elbert & Schauer 2002), die als Netzwerk aus sensorischer Wahrnehmung, Emotionen, Kognitionen und Körperempfindungen gespeichert werden (siehe Abb. 1). Dabei sind zwei Strukturen des Gehirns von besonderer Relevanz: Amygdala und Hippocampus. Die Amygdala, die bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Reizen wie auch bei der Furchtkonditionierung eine wichtige Rolle spielt, ist vorwiegend für die Konsolidierung des heißen Gedächtnisses zuständig (Correll, Rosenkranz & Grace 2005). Das kalte Gedächtnis wird vorwiegend über den Hippocampus gebildet, der für die Informationsweitergabe vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis und für die Erfassung und Konsolidierung von Kontextinformationen zuständig ist (Elbert et al. 2015). So erklärt sich, dass wir beim Hören eines bestimmten Liedes an spezifische Situationen erinnert werden oder ein bestimmter Geruch unmittelbar die Erinnerung an bestimmte Menschen wach werden lässt; im Beispiel der Abbildung exemplarisch der Anblick des Schulhofs, der die Erinnerung an den Tag der positiv erlebten Einschulung weckt.
Abb 1: Sensorisch-Perzeptuelles Netzwerk eines positiv erlebten Ereignisses, in Anlehnung an Elbert et al., 2015
Unter Einwirkung von massivem Stress steigt die Aktivität der Amygdala, während die Aktivität des Hippocampus signifikant beeinträchtigt wird. So werden bei traumatischen Ereignissen die „heißen“ Erinnerungsinhalte intensiv und gut verknüpft „ins Gedächtnis gebrannt“, während die „kalten“ und Kontext herstellenden Elemente deutlich weniger gut abgespeichert werden (Pitman et al. 2000; Neuner et al. 2013).
Werden mehrere verschiedenartige traumatische Ereignisse erlebt, überschneiden sich in der Regel die Elemente der einzelnen Ereignisse (Angst, Hilflosigkeit, Anspannung, etc.), wodurch ein sogenanntes „Furchtnetzwerk“ entsteht (siehe Abbildung 2) (Elbert et al. 2015). Wird ein Element dieses Netzwerks aktiviert (z.B. durch Anblick eines Bootes), wird das gesamte Netzwerk aktiviert. Dabei können zeitgleich alle Teile der „heißen“ Erinnerung aktiv sein; im Hippocampus kann zugleich jedoch immer nur eine Orts- und Zeitzuordnung erfolgen. So werden – der Hebb’schen Lern-Regel (1949) „What fires together wires together“ folgend – die Verknüpfungen zwischen den heißen Elementen verschiedener Ereignisse immer stabiler, während die Verknüpfungen zu den kalten Elementen vergleichsweise schwächer werden. Betroffene erleben die Intrusionen als „plötzlich auftretend“ – die Auslöser sind dabei oft unbewusst, was das Gefühl der Hilflosigkeit weiter verstärkt.
Abb 2: Furchtnetzwerk, in Anlehnung an Elbert et al., 2015
Doch nicht jede Person, die ein traumatisches Ereignis erlebt, entwickelt in der Folge eines traumatischen Ereignisses eine Posttraumatische Belastungsstörung. In einer repräsentativen Umfrage in Deutschland gaben 24,2% der untersuchten Personen in der Altersgruppe der 14-93jährigen an, ein oder mehrere traumatische Ereignisse im Verlauf ihres Lebens erlebt zu haben; die Prävalenz einer PTBS lag jedoch bei nur 2,3% (Maercker et al. 2008). In den USA gaben bei einer 2016 veröffentlichten repräsentativen Studie 68,6% der Teilnehmenden an, mindestens ein traumatisches Ereignis erlebt zu haben – lediglich 4,7% erfüllten hier die diagnostischen Kriterien der PTBS (Goldstein et al. 2016). Und auch bei Geflüchteten zeigt sich ein ähnliches Muster: In einer in Leipzig durchgeführten Studie gaben 85,5% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, mindestens ein traumatisches Ereignis erlebt zu haben; bei 35,6% lag eine PTBS vor (Nesterko et al. 2019).
Verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle: In zahlreichen Studien konnte der Building Block Effekt (Schauer et al. 2003) festgestellt werden. Dieser Effekt beschreibt, dass die Vulnerabilität für die Entwicklung einer PTBS mit der Anzahl verschiedenartiger traumatischer Ereignisse ansteigt (Mollica et al. 1998; Schauer et al. 2003; Catani et al. 2008; Kolassa et al. 2010). Darüber hinaus haben „man made“ traumatische Ereignisse (interpersonelle Gewalt, Folter, Missbrauch) eine stärkere Prädiktionskraft einer PTBS als Unfälle oder Naturkatastrophen (Bromet et al. 2017). Ein weiterer Forschungsbereich befasst sich mit der Frage nach Resilienz, die auch in diesem Kontext eine bedeutsame Rolle innehat (siehe hierzu beispielsweise Werner 2004). Auch die psychosoziale Versorgung in den ersten Tagen und Wochen nach einem erlebten traumatischen Ereignis kann protektiv wirken (Hobfoll et al. 2007). Doch nicht alle Menschen bringen genügend Ressourcen mit, kommen in den Genuss einer guten Erstversorgung oder erleben eine so geringe Anzahl an traumatischen Ereignissen, dass die eigenen Kräfte zur Integration in die eigene Biographie ausreichen. Dann kann es hilfreich sein, seelsorgerische oder therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
4. Narrative Expositionstherapie
„Eigentlich wollte ich das nie jemandem erzählen. Ich dachte auch, ich kann das nicht.“
In der Narrativen Expositionstherapie (NET) verhelfen Therapeuten und Therapeutinnen PTBS-Patientinnen und -patienten dazu, die Sprachlosigkeit zu überwinden und das Geschehene in ihrer eigenen Biographie zu verorten und zu vergeschichtlichen (Schauer et al. 2011). Dabei folgt die NET einem manualisierten Ablauf, der 8 bis 12 Therapiesitzungen à 90 Minuten vorsieht. Anhand einer ‚lifeline‘ wird zunächst ein visuell-haptischer Überblick über das gesamte Leben des Patienten/der Patientin erstellt. Ein auf den Boden gelegtes Seil symbolisiert das Leben; der Anfang bildet die Geburt ab, das aufgerollte Ende die Zukunft. In biographischchronologischer Reihenfolge werden bedeutsame Lebensereignisse von dem Patienten/der Patientin benannt und anhand von Gegenständen repräsentiert. Zur Verfügung stehen als Symbole Blumen für positive Ereignisse, Steine für angstbesetzte Ereignisse und Kerzen für Verlust. Dabei liegt der Fokus auf der kalten Seite des Gedächtnisses, also auf den Fragen „Was ist passiert?“, „Wann ist es passiert?“ und „Wo ist es passiert?“. Dabei soll der Patient/die Patientin explizit nicht jedes Ereignis ausführlich schildern, sondern nur in wenigen Sätzen darlegen, wofür das jeweilige Symbol steht.
In den folgenden Sitzungen werden in chronologischer Reihenfolge die belastendsten Ereignisse per narrativer (erzählender) Exposition bearbeitet. Dabei leitet der Therapeut die Erzählung durch strukturierende Fragen, die alle Ebenen der heißen und kalten Erinnerung (Wahrnehmungen, Gedanken, Emotionen, Körperempfindungen und den räumlichen & zeitlichen Kontext) aktivieren. Der Patient wird also innerhalb eines sicheren äußeren Rahmens durch seine eigene Erzählung in das Wiedererleben geführt; das beinhaltet auch ein Wiedererleben der Angst, der Körperreaktionen und der Gedanken, teilweise sogar der sensorischen Wahrnehmungen, die beim damaligen Ereignis präsent waren. Gleichzeitig wird das ‚Damals‘ und ‚Dort‘ Erlebte ständig mit dem Erleben im ‚Hier‘ und ‚Jetzt‘ kontrastiert (z.B. „Du hast gesagt, dass Du damals den Wind auf der Haut gespürt hast. Was spürst Du jetzt, in diesem Moment, auf Deiner Haut?“). Durch die gleichzeitige Aktivierung des heißen und kalten Gedächtnisses (geleitet von den Fragen des Therapeuten/der Therapeutin nach einzelnen Elementen) können vormals fragmentierte Gedächtnisinhalte wieder miteinander in Verbindung gebracht werden. Das Ereignis wird in der Sitzung von Anfang bis Ende durchgesprochen; dabei wird besonders viel Zeit mit dem Moment verbracht, in dem die Angstreaktion am größten war. So gelingt es – wie auch bei anderen Expositionen, beispielsweise bei Phobien – bereits während der ersten Exposition, eine Abnahme der Angstreaktion hervorzurufen. Eine dieser Logik folgenden und in Therapie entstandene Narration könnte wie folgt lauten:
5. Traumatisches Ereignis, erlebt von Amer2
„Ich war 17 Jahre alt. Es war drei Wochen vor Ostern. Seit sechs Monaten war ich schon unterwegs. Es war noch kalt in der Türkei. Wir sind nachts zu einem Strand gefahren; erst mit einem Bus, dann ging es weiter zu Fuß. Dort am Strand hat man das Geräusch vom Wasser gehört. Wir waren insgesamt dreizehn Leute. Die anderen waren auch aus Syrien. Jeder hatte eine Weste an. Als ich die orange Weste angezogen habe, hatte ich die Sorge ‚Wie werden wir das Wasser überqueren?‘ (…) Wir haben das Boot aufgepumpt und sind los. Bis 3.00 Uhr nachts sind wir einfach gerudert. Zuerst war alles ok. Aber dann kam Wind. Die Wellen waren immer stärker. Bei manchen Wellen ist auch Wasser ins Boot gekommen. Ich hatte große Angst. (…) Wir hatten vorher ordentlich im Takt gerudert, aber als die Wellen kamen, war alles ganz durcheinander. Am Anfang von dem Sturm haben wir noch gesagt; Wir müssen schneller rudern, dass wir schneller ankommen.‘ Einer von den anderen hat erbrochen. Von dem säuerlichen Geruch wurde mir schlecht. (…) Ich spürte, wie der Wind an meiner dünnen Jacke zerrte. Mir war kalt. Im Gesicht spürte ich das kalte Wasser. Mein Herz schlug schnell. Wir waren mitten im Meer und imSturm, und es war keiner da, der uns helfen konnte. Wir haben oft geschrien ‚Was sollen wir tun?‘ Ich habe gedacht: ‚Jetzt ist alles vorbei.‘ Ich hatte Angst zu sterben. Die Angst habe ich im ganzen Körper gespürt. (…) In dem Sturm habe ich vor allem das Wasser gehört, aber auch die Stimmen der anderen. Jeder schrie vor Angst. Als die große Welle kam, ist meine Seite vom Boot hochgegangen. Es gab nichts, an dem ich mich festhalten konnte. Ich habe noch gedacht: ‚Jetzt werde ich ertrinken.‘ Dann war ich unter Wasser. Durch die Rettungsweste bin ich wieder hochgekommen, aber dann gleich wieder unter das Wasser gekommen. Ich habe viel Wasser geschluckt, und musste auch viel husten. Im Mund hatte ich den bitter-salzigen Geschmack vom Wasser. Ich habe gedacht: ‚Jetzt sterbe ich.‘ Ich hatte keine Kraft mehr und konnte mich nicht mehr bewegen. Meine Beine und meine Hände waren eiskalt. (…) Von den Wellen und der Strömung wurde ich in Richtung Land getrieben. Da standen Leute, und irgendwann haben sie mich gesehen. Sie haben geschrien, und als ich das gehört habe, war ich erleichtert. Ich habe gedacht: ‚Ich werde gerettet.‘ (…) Sie brachten mich an Land, und haben dort Feuer gemacht. Das Feuer war ganz nah an mir dran, das war ein gutes Gefühl. Allmählich konnte ich die Wärme spüren. Ganz langsam konnte ich auch meinen Körper wieder bewegen. Ich musste viel husten. Ich habe den Geruch von dem Holzfeuer gerochen. Die Angst war immer noch da in meinem Körper, aber weniger. Zwei bis drei Stunden war ich dort an dem Feuer. Allmählich konnte ich meine Hände und Beine wieder bewegen. Es wurden noch drei andere gerettet und auch zu mir ans Feuer gebracht. Als wir uns mit der Zeit wieder bewegen und sprechen konnten, haben wir gefragt: ‚Wo sind die anderen?‘ Keiner wusste es. (…) Dann wurden wir vom Roten Kreuz versorgt. “
Die so entstandene Narration, eine Topographie des eigenen Lebens, wird von der Therapeutin/dem Therapeuten verschriftlicht und in der folgenden Sitzung vorgelesen. Das nochmalige Vorlesen dient vor allem der Habituation, einer in der Expositionstherapie regelmäßig genutzten Gewöhnungsreaktion an einen aversiven Stimulus: Bei der ersten Exposition hat der Patient/die Patientin bereits einmal erlebt, dass er/sie es schaffen kann, das traumatische Ereignis vollständig zu berichten, und dabei die Angst zwar zu spüren und wieder zu erleben, aber ihr nicht hilflos ausgeliefert sein und in ihr verhaftet zu bleiben. Darum ist es unabdingbar, eine Geschichte bis zu ihrem Ende, dem relativ sicheren Moment, erzählen zu lassen. Beim nochmaligen Vorlesen kommt es zur erneuten Habituation, d.h. die Angstreaktion auf den aversiven Stimulus, auf die eigene Geschichte, steigt nicht mehr so stark an wie beim ersten Mal. Anschließend an das Vorlesen wird das nächste traumatische Ereignis in gleicher Weise bearbeitet. So wird die Therapie fortgeführt, bis ein komplettes Dokument über die Biographie des Patienten/der Patientin entstanden ist. Die Erinnerung an die traumatischen Ereignisse wird also nicht gelöscht oder verdrängt – wie es von Patienten und Patientinnen oft gewünscht wird – sondern in den eigenen autobiographischen Kontext integriert. Die eigene Verwundbarkeit bleibt präsent, und die Erinnerungen bleiben – doch nun nicht mehr als schmerzende und eiternde Wunden, sondern als Narben, die bezeugen, was geschehen ist.
Zum Abschluss der Therapie wird die Lebenslinie erneut gelegt; anschließend wird die Narration von allen Anwesenden (Patient/Patientin, Therapeut/Therapeutin, ggf. Dolmetscher/Dolmetscherin) unterschrieben und – wenn gewünscht – übergeben.
6. Wirksamkeit der Narrativen Expositionstherapie
Randomisiert kontrolliert durchgeführte Studien haben von Beginn an die Anwendung und (Weiter-) Entwicklung der NET begleitet. Inzwischen liegen Daten für die Behandlung verschiedener Personengruppen mit NET vor, u.a. Opfer häuslicher Gewalt, Folterüberlebende, Geflüchtete, Überlebende des zweiten Weltkriegs, und ehemaligen Kindersoldaten. Für die Reduktion der Symptome einer PTBS zeigen sich durchgängig im Vergleich zu anderen Therapieverfahren und Wartegruppenbedingungen hohe Effektstärken (Robjant & Fazel 2010; Jacob et al. 2017; Lely et al. 2019). Neben der Reduktion der PTBS-Symptomatik wurden in manchen Studien auch Reduktionen komorbider Störungsbilder (Depression, Suizidalität, somatische Beschwerden) festgestellt (Jacob et al. 2017; Kaltenbach et al. 2018; Lely et al. 2019).
7. Zusammenfassung und Ausblick
„Trauma“ beschreibt im klinischen Sinne Ereignisse, in denen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit einer Person unmittelbar bedroht oder verletzt wurde; sie können selbst erlebt werden, direkt oder indirekt bezeugt werden, oder im beruflichen Kontext durch wiederholte und extreme Auseinandersetzung mit belastenden Details traumatischer Ereignisse auftreten. Die Genese und die Symptome einer PTBS sind vor dem Hintergrund des Building Block Effekts, des Furchtnetzwerks, und der Neurobiologie des autobiographischen Gedächtnisses erklärbar. Die Narrative Expositionstherapie ist ein interkulturell valides und evidenzbasiertes Kurzzeitverfahren für die Behandlung von Menschen, die multipel und sequenziell traumatisiert sind. Durch Expositionssitzungen und Habituationsreaktionen gelingt die Verarbeitung und Integration der traumatischen Ereignisse, sodass die eigene Lebensgeschichte wieder erzählt werden kann und der sprachlose Schrecken überwunden wird.
Seit Menschengedenken erleben wir traumatische Ereignisse. Auch der Verlust der Heimat wurde bereits in den ältesten Schriften beschrieben. Immer wieder werden wir mit traumatischen Ereignissen und ihren Folgen konfrontiert – sei es als Opfer, als Zeuge/Zeugin, oder als Täter/Täterin. Und doch bemühen sich zahlreiche Menschen, die Konfrontation mit traumatisierten Menschen zu vermeiden. Durch Schweigen, durch Wegsehen, durch fragwürdige Praktiken im Grenzschutz… und durch Verfahren, die den Grundsatz der Seenotrettung in Frage stellen. Wenn die Wellen hochschlagen – wer wünscht sich nicht, und wem sei es nicht vergönnt, einen guten Ausgang des Sturmes zu erleben?
„Und siehe, es erhob sich auf dem See ein gewaltiger Sturm, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn; sie riefen: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde!“ (Matthäus 8, 24-25).
1 Der vorliegende Beitrag ist in ähnlicher Form erschienen: Trauma, PTBS und Narrative Expositionstherapie – den sprachlosen Schrecken überwinden. Blickpunkt EFL-Beratung, 41 (modern times – Beziehung und Bindung heute), S. 58-67.
2 Name geändert, Geflüchteter aus Syrien, erarbeitet in einer NET-Sitzung.
Migration und Flucht – im Spannungsfeld von Trauma, Kreativität und Resilienz
Wenn Menschen vor Krieg und Verfolgung, Hunger und Gewalt fliehen, sind sie bereits Verwundete. Doch ihre Vulnerabilität steigert sich nochmals erheblich durch die Gefahren, die auf ihren Fluchtwegen lauern. Die unzähligen Toten im Mittelmeer bezeugen dies. Welche Gefahr drohende Rechtlosigkeit birgt, beschreibt die Pädagogin Melissa Silva mit Rückgriff auf Hannah Arendt. Und der Moraltheologe Bernhard Kohl zeigt im Vergleich von Kanada und Deutschland, welche Bedeutung Narrative zur Migration in Staaten haben, die geflüchtete Menschen aufnehmen.
Bernhard Kohl
Migration und Flucht – philosophisch-theologische Perspektiven
1. Kanadische und deutsche Migrationserzählungen
21,9% der Kanadier und Kanadierinnen haben einen Migrationshintergrund. In großen Städten und Ballungsräumen wie Toronto liegt der prozentuale Anteil mit 51,1% nochmals wesentlich höher (Statista Research Department, Ethnien in Kanada 2014). Auf der anderen Seite nimmt das Land relativ wenig geflüchtete Menschen auf. Im Jahr 2016 war eine Zielvorgabe wegen des staatlichen Resettlement-Programms für syrische Flüchtlinge von 25.000 Personen gesetzt (was einem Anteil von 0,07% an der Gesamtbevölkerung entspricht), bereits im Folgejahr aber wieder auf 7.500 (0,02%) reduziert worden. Im Vergleich dazu nahm die Bundesrepublik Deutschland 2016 ca. 746.000 Asylsuchende auf (0,89%) und 2017 ca. 223.000 (0,27%) (Amnesty Report, Kanada 2018). Umgekehrt proportional zu den Zahlen verhalten sich die „Erzählungen“ beider Länder zu „ihren“ Migranten, Migrantinnen und geflüchteten Menschen.
Der Multikulturalismus ist seit 1971 das politische Begleitprogramm, welches 1988 im „Canadian Multiculturalism Act“ unter dem Slogan „Einheit in Verschiedenheit“ Gesetz wurde. Generell wird eine sehr positive Terminologie in Richtung eingewanderter und nach Kanada geflüchteter Menschen gepflegt: „Diversity is Canada‘s strength. (…) what’s made it work so well in Canada is the understanding that our diversity isn’t a challenge to be overcome or a difficulty to be tolerated. Rather, it’s a tremendous source of strength.”1 Gleichzeitig üben Medien, Politiker, Politikerinnen und Vertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft mit einem gewissen Lustempfinden große Kritik an der Migrationspolitik der USA. Man hält sich selbst für den kleineren, aber feineren Bruder der USA: „Amerika, nur besser.“2
Kurzum: Man feiert sich für seine Offenheit und schreibt Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung einen stark positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu. Und diese Zuschreibung erweist sich als wirksam, wie Umfragen bestätigen. 60% der kanadischen Bevölkerung stehen einer weiteren Aufnahme von geflüchteten Menschen uneingeschränkt positiv gegenüber (s. „Oh wie schön ist Kanada“, Schwarte 2017), und 83% der muslimischen Kanadier und Kanadierinnen sind „sehr stolz“, kanadische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu sein (Clement 2016). Dabei zeigt die Realität, dass Kanada mit seinen Detention Centres, seinem Punktesystem für Einwanderer, der sozialen Schichtung der Bevölkerung etc. viel näher an den USA liegt, als den Kanadiern und ihrem Narrativ lieb sein kann.3
Ein umgekehrtes Bild ergibt sich für Deutschland, das im Vergleich zu anderen westlichen Ländern eine relativ hohe Zahl von geflüchteten Menschen aufnahm – obwohl sie natürlich im Vergleich immer noch verschwindend gering ist. Hier ist die Terminologie aber häufig negativ eingefärbt. Angela Merkels „Wir schaffen das“ wurde durch rechtspopulistische Terminologien wie Flüchtlingswelle, Flüchtlingskrise, Ansturm, oder auch Asyltourismus überdeckt. Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung wird ein eher negativer Einfluss auf die Gesellschaft zugeschrieben. Statistisch ergibt sich hierfür kein Anhaltspunkt, nicht einmal aus der Kriminalitätsstatistik, wie so gerne weisgemacht wird.
Zusammengefasst kann man also festhalten, dass die Situation in Kanada gemessen an der Realität positiver dargestellt wird, als sie tatsächlich ist, und in Deutschland negativer. Am Beispiel der beiden Länder wird deutlich, dass Sprache und Erzählungen bzw. Narrative bedeutsam und existenziell sind: Sie prägen die Stimmung unter Menschen in einer Bevölkerung, lassen Dinge in einem positiven Licht erscheinen und haben gleichzeitig das Potenzial, Fakten und Realitäten zu verbergen oder unsichtbar zu machen.
Um noch einmal auf Kanada und Deutschland zurückzukommen: In beiden Fällen werden Menschen durch Sprache unsichtbar gemacht, man nimmt ihnen ihre eigene Wirkung, ihre eigene Handlungsfähigkeit, da sie für politische Zwecke eingespannt werden. Beispielsweise verschwinden sie hinter den Absichten, für oder gegen eine offene Gesellschaft zu argumentieren. Menschen werden durch solche vulneranten Erzähl- und Sprechweisen in gewissem Sinne aus Gesellschaften und gesellschaftlichen Diskursen ausgeschlossen, da sie hinter den Rollen verschwinden, die ihnen sprachlich zugeschrieben werden und auf die sie sprachlich festgelegt werden. Sei es als positive oder negative Kontrastfolie.
2. Souveränität und Gouvernementalität: Die Produktion nichtautorisierter Vorsubjekte
Für die US-amerikanische Philosophin Judith Butler ist die Voraussetzung für einen solchen Ausschluss von Menschen aus einer Gesellschaft das eigentümliche Zusammenspiel von Souveränität und Gouvernementalität, das eine moderne, sehr zeitgenössische Form der Macht ergibt.





























