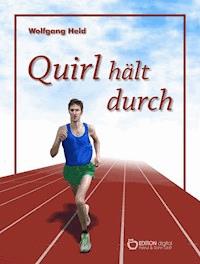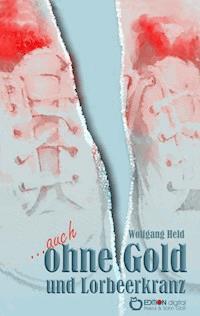7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
"Der Platz hinter dem Pfeiler des Triforiums war überlegt gewählt. Selbst außerhalb des Blickfeldes der Gläubigen bleibend, konnte der untersetzte, rotblonde Mann im verschwitzten Kakianzug das Kirchenschiff bis zum Altar überschauen. Er hatte die Kathedrale einige Minuten nach Beginn der Messe betreten und war auf dem Weg über die steinerne Treppe zur säulengetragenen Galerie von niemandem bemerkt worden . Nun verfolgte er gleichgültig das religiöse Zeremoniell, warf ab und zu einen Blick auf die Uhr und wickelte schließlich eine UZI-Maschinenpistole aus einem Stück verblichenen Sackleinens ..." Henry Kulaman soll erschossen werden. Doch der Premierminister des kleinen, fast ganz vom Dschungel bedeckten Inselstaates entgeht durch Zufall dem Attentat. Wenige Tage später putscht, geschürt von ausländischen Unternehmen, ein Teil der Streitkräfte. In die blutigen Auseinandersetzungen werden auch Unbeteiligte verwickelt. Unter ihnen drei Monteure, die eine aus der DDR importierte Druckerei in einer der größten Städte der Insel aufbauen sollen. Als Martin Katrup auf der Insel landet, sind seine beiden vorausgeflogenen Kollegen spurlos verschwunden. Der erstmals 1976 im Verlag Das Neue Berlin erschienene spannende Abenteuerroman entstand nach dem 1974 vom Deutschen Fernsehfunk (DDR) ausgestrahlten 2-Teiler (Drehbuch von Wolfgang Held) mit Alfred Müller, Gojko Mitic, Barbara Brylska, Angel Stojanov, Wolfgang Dehler, Brigitte Beier, Marita Böhme, Christoph Engel, Hanjo Hasse u. a.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Visa für Ocantros
Abenteuerroman
ISBN 978-3-86394-925-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1976 im Verlag Das Neue Berlin.
.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.ddrautoren.de
Vorbemerkung
OCANTROS ist eine Fiktion, die von realen Strukturen, Prozessen und Ereignissen in einigen kleineren Entwicklungsländern angeregt wurde. Alle Aussagen über Methoden imperialistischer Großunternehmen und des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency (CIA) können authentisch belegt werden. An dieser Stelle danke ich Herrn Doktor Achmed Ismail, der meine Arbeit mit wertvollen Hinweisen und Ratschlägen unterstützte.
1. Kapitel
Der Platz hinter dem Pfeiler des Trifoliums war überlegt gewählt. Selbst außerhalb des Blickfeldes der Gläubigen bleibend, konnte der untersetzte, rotblonde Mann im verschwitzten Kakianzug das Kirchenschiff bis zum Altar überschauen. Er hatte die Kathedrale einige Minuten nach Beginn der Messe betreten und war auf dem kurzen Weg über die steinerne Treppe hinauf zur säulengetragenen Galerie von niemandem bemerkt worden. Nun verfolgte er gleichgültig das religiöse Zeremoniell, warf ab und zu einen Blick auf die Uhr und wickelte schließlich eine kurzläufige UZI-Maschinenpistole aus einem Stück verblichenen Sackleinens.
Der Geistliche im weißen liturgischen Gewand der anglikanischen Kirche, geschmückt mit goldglänzender Stola und bestickter Manipel, sprach das Vaterunser. Orgelmusik setzte ein. Die Stimmen der Frauen und Männer vereinten sich in der schlichten, bewegenden Melodie eines gregorianischen Chorals.
Matthews Sinelakos, der Mann hinter dem Pfeiler, zog ein Magazin aus dem Gürtel. Es barg zweiunddreißig Patronen. Das harte metallische Knacken beim Einrasten in die Halterung der Waffe wurde verschluckt von brausenden Orgelklängen und vielstimmiger Lobpreisung des Heilands.
Im Gestühl beiderseits des langgestreckten Mittelschiffes gab es an diesem Vormittag keinen freien Platz. Die beiden vorderen, den Honoratioren vorbehaltenen Sitzreihen ausgenommen, hockten die Gläubigen so dicht beieinander, dass Schulter gegen Schulter drängte. Hohlwangige Männer, schlaff-brüstige Frauen, Halbwüchsige, in deren Augen Hunger, Hass und Hoffnung schwelten, sangen mit großer Inbrunst das Lob ihres Herrgotts. Von ihm und von Henry Kulaman erwarteten sie zuversichtlich die Erlösung aus dem Elend, das auf Ocantros auch im zweiten Jahr der Unabhängigkeit immer noch in vielen Hütten nistete.
Premierminister Kulaman nahm in der ersten Bankreihe jenen Platz ein, der vom Einweihungstag der Kathedrale an mehr als ein Jahrhundert hindurch dem jeweiligen Gouverneur Ihrer Majestät des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland vorbehalten gewesen war. Kulaman trug Zivilkleidung. Rechts und links von ihm bestimmten die erdnussfarbenen Uniformen der Offiziere das Bild. Auffallend war, dass zu den Gläubigen in dieser ersten Sitzreihe keine Frau zählte.
Gelassen beobachtete Matthews Sinelakos den Sekundenzeiger seiner Uhr. Jede Bewegung dieses Mannes zeugte von Erfahrung und Umsicht. Die Präzision, mit welcher er sein Metier ausübte, hatte ihm den Ruf eingebracht, einer der zuverlässigsten, listenreichsten und geübtesten Menschenjäger des Jahrzehnts zu sein. Der sorgfältigen, beinahe generalstabsmäßigen Vorbereitung seiner Operationen und der Unterstützung durch seine in fast allen Fällen einflussreichen Auftraggeber hatte er es zu verdanken, dass sein Name auf keiner Fahndungsliste und auch nicht in der umfangreichen Kartei der Pariser Interpol-Zentrale zu finden war. Er hatte feste Preise. Für einen Mord forderte er zwanzigtausend Schweizer Franken zuzüglich aller Spesen. Die Hälfte der Summe ließ er sich bei Annahme eines Auftrages auszahlen, der Rest wurde am Tag der Beisetzung des Opfers fällig. Garantien gab er nicht, aber in vierzehn der siebzehn von ihm bisher durchgeführten Aktionen war auch die zweite Hälfte des Honorars auf sein Konto bei der Schweizerischen Nationalbank in Bern eingezahlt worden.
Sinelakos lebte mit seiner Frau und seinen drei Kindern in einer Kleinstadt unweit von Milwaukee am Lake Michigan und betrieb eine einträgliche, über die Grenzen des Staates Wisconsin hinaus bekannte Orchideenzucht. Die Familie genoss bei den Nachbarn hohes Ansehen, und niemand fand es verdächtig, dass der Orchideenzüchter mehrmals im Jahr auf längere Geschäftsreisen ging. Den meisten Leuten in der kleinen Stadt war längst bekannt geworden, dass Sinelakos' Orchideensamen und -setzlinge nach Europa, nach Asien und sogar nach Afrika versandt wurden. Selbst seine Frau ahnte nichts von den tatsächlichen Gründen seiner manchmal wochenlangen Abwesenheit. Seine regelmäßigen Postkartengrüße aus den verschiedensten Winkeln der Erde und die ebenfalls in reichlichem Maße eingehenden überseeischen Samenbestellungen ließen keinerlei Misstrauen aufkommen.
Lautlos bewegte Matthews Sinelakos den Sicherungshebel. Er hob die nun schussbereite Waffe ohne Hast und stemmte den linken Unterarm gegen den Pfeiler. Über Kimme und Korn visierte er den Hinterkopf seines Opfers an. Nach dem genau berechneten und einige Male überprüften Zeitplan hatte für Henry Kulaman die letzte Minute seines Lebens begonnen.
Der Regierungschef der jungen Inselrepublik Ocantros sang den Psalm von der Seligkeit der Frommen mit, war jedoch mit seinen Gedanken bereits bei dem Gespräch, das am Nachmittag zwischen ihm und dem japanischen Gesandten geführt werden sollte. Er versprach sich viel von besseren Wirtschaftsbeziehungen zu dem großen Land. Schon vor seiner Wahl zum Premierminister des unabhängigen Ocantros war er sich darüber klar gewesen, dass die Inselbevölkerung die mittelalterliche Rückständigkeit, in der sie noch lebte, nicht aus eigener Kraft überwinden könnte. Wir haben starke, aber leere Hände, hatte er am Tag seines Amtsantritts vor den gewählten Delegierten der sieben Distrikte erklärt. Wir brauchen alles, was zu einem modernen Industriestaat gehört, am dringlichsten aber brauchen wir hilfsbereite, uneigennützige Freunde überall in der Welt.
Matthews Sinelakos atmete ruhig und gleichmäßig. Niemand hatte ihm gesagt, weshalb Henry Kulaman sterben sollte. Das interessierte ihn auch nicht. Er legte sogar besonderen Wert darauf, über Hintergründe seiner Aufträge in Unwissenheit zu bleiben, weil er fürchtete, durch Kenntnis von Zusammenhängen zu Urteilen herausgefordert zu werden, die seiner Kaltblütigkeit abträglich sein könnten. Er wusste über die Situation auf Ocantros und den Regierungschef der Insel nicht mehr als jeder Leser einer Provinzzeitung zwischen Boston und San Francisco.
Sinelakos zögerte noch einen Augenblick. Er hatte das Ziel im Visier, und er wartete wie immer vor dem Moment des Tötens auf eine innere Regung, die ihn vielleicht zurückhalten würde. Er gab seinem Opfer und dem Herrgott eine Chance, aber nur einmal hatte er jenes heiße, lähmende Gefühl gespürt, das wie die Ankündigung einer schrecklichen Strafe war. Das lag Jahre zurück. Damals hatte er in einem glitschigen Lehmloch südwestlich von Huë gehockt und zum ersten Mal einen lebendigen Menschen im Zielfernrohr gehabt. Einen Jungen, nicht älter als sechzehn. Der als Scharfschütze ausgebildete Sergeant Sinelakos, der vor seiner Einberufung nie eine Waffe besessen oder auch nur abgefeuert hatte, konnte deutlich sehen, wie der junge Mann irgendetwas in den Taschen seiner Hemdbluse suchte. Da fragte ein Gl neben ihm ungeduldig: "Was ist, nimmst du nun den Kerl, oder soll ich ihn platzen lassen?" Matthews Sinelakos hatte geschossen. Als er den Getroffenen mit unnatürlich-ruckhafter Bewegung hochzucken und dann kraftlos stürzen sah, war ihm speiübel geworden. Noch stundenlang hatten ihn Magenkrämpfe gequält. Er war fest entschlossen gewesen, die beklemmende Warnung des Gewissens nicht ein zweites Mal zu missachten, doch sie hatte sich nie wieder eingestellt. Auch jetzt spürte er sie nicht. Langsam krümmte er den Zeigefinger, bis er den sanften Widerstand des Druckpunktes fühlte. Er korrigierte noch ein leichtes Verkanten beim Anvisieren des Zieles und wollte abdrücken, als ein entsetzter Ruf durch das Kirchenschiff gellte.
Von einer unerklärlichen Ahnung gelenkt, hatte der Geistliche den Mann im Triforium entdeckt und die Gläubigen alarmiert. Seine ausgestreckte Hand wies die Richtung, aus der die Gefahr drohte. Doch ehe die Frauen und Männer, die Kinder und Greise begriffen, was vorging, prasselte es wie ein Hagelschlag vom Säulendach herab. Das Krachen widerhallte dutzendfach von den Kreuzgewölben und den hohen, bunten Bogenfenstern. Schrille Schreie mischten sich mit dem Geknatter aus hastig gezückten Offizierspistolen.
"Sei mir gnädig, Gott, mein Gott, sei uns gnädig!", betete laut eine greise, dunkelhäutige Frau. Sie bog ihren hageren Leib schützend über einen kleinen, vor Furcht gelähmten Jungen. Ihre Stimme zitterte. "Ihre Zähne sind wie Spieße und Pfeile ... und ihre Zungen wie scharfe Schwerter ...!"
Martin Katrup hing in den weichen Polstern. Er hielt die Augen geschlossen. Über seinem sonnengebräunten Gesicht lag ein grüngelber Schimmer. In seinem Magen schlingerten Feldsteine. Er zählte die Minuten nicht, er wusste, dass es noch fast zwei Stunden so gehen würde. Widerstandslos lieferte er sich den Peinigungen der Luftkrankheit aus. Seine Erfahrungen auf langen Reisen hatten ihn demütig gemacht.
Das monotone, gedämpfte Dröhnen der Triebwerke hatte die meisten Passagiere eingeschläfert. Nach der Zwischenlandung in Kairo war nur noch ungefähr die Hälfte der einhundertfünfzig Sitze in der Maschine nach Ocantros-City belegt. Martin Katrup saß im hinteren Fahrgastraum. Durch die Fensterovale sah er die mächtigen Tragflächen. Tief unter ihnen dehnte sich türkisfarbene Weite bis zum Horizont. Der Indische Ozean.
"Ein Glas Wasser, bitte!"
Martin Katrup hörte die angenehm klare weibliche Stimme dicht an seiner Seite. Eine Bitte in geübtem Schulrussisch an die Stewardess. Seine Lider blieben gesenkt. Die junge Dame war in Kairo zugestiegen, als ihm bereits bis hoch ans Kinn übel war. Ihre durchaus bemerkenswerte Erscheinung hatte deshalb sein sonst waches Interesse für weibliche Schönheit nicht sonderlich zu reizen vermocht.
"Darf ich Ihnen helfen?", fragte die freundliche Stimme wenig später in Deutsch, das von einem charmant klingenden Akzent gefärbt war. Müde und als wäre es mit Anstrengung verbunden, öffnete Martin Katrup die Augen. Sein Blick bat um Schonung. Die junge, braunhäutige Dame, die einen sportlich geschnittenen hellen Hosenanzug trug, lächelte ihn an. In einer Hand hielt sie das Glas Wasser, in der anderen präsentierte sie eine kleine gelbliche Tablette. "Nehmen Sie! In fünf Minuten ist Ihnen wohler. Bestimmt."
Katrup griff nach Glas und Tablette. Er hatte längst alle einschlägigen Medikamente probiert und versprach sich nichts von der angebotenen Hilfe. Allein um jedem Disput aus dem Weg zu gehen, tat er seiner Nachbarin den Gefallen und schluckte. Ihr Lächeln bekam eine spöttische Nuance.
Über den Bordlautsprecher verkündete eine der Stewardessen in russischer und englischer Sprache, dass die Flughöhe gegenwärtig zehntausend Meter und die Fluggeschwindigkeit achthundertfünfzig Kilometer pro Stunde betrage. Mit der Landung auf Ocantros sei in etwa anderthalb Stunden zu rechnen.
Merkwürdig, überlegte Martin Katrup, die Stewardess hat sie russisch angesprochen und mich deutsch. Woher kann sie wissen, was für ein Landsmann ich bin? Seitdem sie neben mir sitzt, habe ich kein Wort gesagt ... Und lächeln kann sie, dass einem die Ohren heiß werden!
"Na, besser?" Sie hatte bemerkt, dass er die Augen nicht mehr geschlossen hielt. Er stutzte, tastete über die Magengegend und nickte verwirrt. Sie brachte die Tablettenschachtel aus ihrer Handtasche zum Vorschein und gab sie ihm. "Ich hab' noch mehr davon. Nehmen Sie nur."
Martin Katrup schob sich in aufrechte Sitzhaltung. Er las das Etikett. Das Präparat stammte aus einem Budapester Pharmaziebetrieb. "Sind Sie aus Ungarn?", fragte er und stellte sich vor, ehe sie ihm geantwortet hatte.
"Woronicz", sagte sie und drückte die Hand, die er ihr etwas steif entgegenstreckte. "Jagoda Woronicz. Aus Warschau. Journalistin."
Sie kamen ins Gespräch. Er erfuhr, dass sie für PAP, die polnische Nachrichtenagentur, arbeite und schon einmal auf Ocantros gewesen sei. Zu jener Zeit hatte die Insel allerdings noch zum britischen Empire gehört. Die hübsche Polin hatte sich während mehrerer Monate auf ihre zweite Reise vorbereitet und wusste über die Verhältnisse sehr genau Bescheid. Martin Katrup war ein aufmerksamer Zuhörer. Er amüsierte sich über ihre unbekümmerte, die Regeln der Grammatik fröhlich missachtende Art des Umganges mit der deutschen Sprache und konnte bei dieser Unterhaltung Informationen auffrischen, die ihm Mitarbeiter des Außenministeriums mit auf die Reise gegeben hatten.
Ocantros, zwölf Grad nördlich vom Äquator im Indischen Ozean gelegen, stand nicht in den Katalogen der großen Internationalen Reisebüros. Die junge Republik maß, einige dazugehörige kleine Inseln einbezogen, wenig mehr als sechstausend Quadratkilometer. Die Einwohnerzahl wurde auf knapp anderthalb Millionen geschätzt. Über hundert Jahre lang waren die Insulaner friedfertige, demütige Untertanen der englischen Krone. Nach dem zweiten Weitkrieg erwachten erste Unabhängigkeitsbestrebungen, die von den Engländern sorgfältig beobachtet wurden. Man war sich in der Downing Street und im Unterhaus einig, es auf Ocantros nicht zu harten oder gar blutigen Auseinandersetzungen wie in Kenia oder im Südjemen kommen zu lassen. Die Insel war nach übereinstimmender Ansicht führender Tory- und Labourpolitiker einen solchen Preis nicht wert. Auf Ocantros hatte man weder Erdöl noch andere Bodenschätze gefunden, es gab keine nennenswerten Kapitalinvestitionen, und das Eiland hatte zudem infolge der militärtechnischen Entwicklung auch jede strategische Bedeutung verloren. Im Oberhaus und im Unterhaus fand sich keine Stimme gegen die Unabhängigkeitserklärung für ein Fleckchen tropischer Erde, das dem englischen Steuerzahler seit langem keinerlei Gewinn brachte, ihm jedoch alljährlich einige Millionen Pfund Sterling an Verwaltungs- und Erhaltungskosten abverlangte.
"Zwei Jahre Unabhängigkeit können viel verändern", sagte sie, "Ich soll eine Reportage darüber schreiben. Eine interessante Aufgabe ... Und Sie?"
"Monteur", antwortete Martin Katrup. "Wir bauen Druckereimaschinen. Vor einem Jahr haben wir in der Mongolei aufgebaut ... Waren Sie schon mal in Ulan-Bator?"
Seine Frage erreichte die Journalistin nicht. Ihr Interesse galt einem Passagier, der ein wenig unsicheren Schrittes der Toilette zusteuerte. Für Bruchteile von Sekunden begegnete sein Blick dem der Polin. Er bemerkte, wie sie stutzte. Einen Moment zögerte er, doch als sie ihre Aufmerksamkeit schnell wieder dem Mann an ihrer Seite zuwandte, ging er weiter.
"Was sagten Sie eben, Herr Katrup?", fragte Jagoda Woronicz, doch ihre Gedanken hingen offenkundig noch dem anderen Fluggast nach.
"Nichts Wichtiges." Katrup schaute ein wenig verstimmt hinter dem Unbekannten her. Unsympathischer Typ!
Bis zur Landezeit auf Ocantros fehlte nur noch eine reichliche halbe Stunde. Die beiden Männer, die vor dem Monteur und der Journalistin saßen, beendeten ihren mehrstündigen Schachwettkampf. Der eine, ungefähr Mitte dreißig, geschmückt mit einem dichten, blonden Schnauzbart, war Arzt aus Kiew. Er hieß Wassilij Ostschenko. Zwischen zwei Zügen hatte er zuweilen den Hals gereckt und um die hohe Sitzlehne nach hinten zu der attraktiven Polin geäugt. Offensichtlich wäre er ab Kairo sofort bereit gewesen, mit Martin Katrup den Platz zu tauschen. Nun klappte er nach fünf verlorenen Partien das kleine Steckschachbrett zusammen und gab seinem erfolgreichen, nach den unerwartet leichten Siegen enttäuschten Partner zu bedenken, dass auch nicht jeder Engländer ein exzellenter Fußballer sei. Er schaute zur Uhr und gestand: "Ich habe ein bisschen Angst vor Ocantros! Fast vierzigtausend Kinder, und ich werde vorläufig der einzige Pädiater sein!" Der Schachpartner nickte verständnisvoll, obwohl er das Wort Pädiater zum ersten Mal in seinem Leben hörte. Sein Fachgebiet waren Hühner und deren Intensivhaltung.
"Eine Perle aus Allahs goldener Schärpe wird die Insel von den Moslems genannt", schwärmte Jagoda Woronicz. "Palmen, monatelang blauer Himmel, weißer Strand, kilometerlang menschenleer. Das kann man sich nicht vorstellen, das muss man erleben, auskosten ... Auch die Beschaulichkeit des Alltags, der ruhige Atem, den Ocantros hat und international so herrlich bedeutungslos!"
Martin Katrup schmunzelte ungläubig. "Gibt's das denn - bedeutungslos?"
Der Mann, den die Polin so aufmerksam betrachtet hatte, saß wieder neben seinem dösenden Begleiter. Diese beiden Amerikaner waren von London via Prag nach Ocantros unterwegs und machten den Eindruck von Geschäftsleuten, die es nicht ungewöhnlich fanden, am Montag in Tokio, am Mittwoch in Sidney und am Freitag in Berlin zu verhandeln. Während der jüngere von ihnen, in die Passagierliste mit dem Namen Bush Jugder eingetragen, nahezu die gesamte Flugzeit über Kreuzworträtseln gegrübelt oder geschlummert hatte, war der korpulente Endvierziger beharrlich auf einen Flirt mit den beiden Stewardessen aus gewesen. Für sie waren derartige Annäherungsversuche, zumal von Herren reiferen Alters und mit spärlicher werdendem Haarschmuck, nicht ungewöhnlich, deshalb spielten sie mit, solange die Regeln des Anstandes und der Dienstvorschriften nicht überschritten wurden. Alan Peers balancierte gekonnt auf dieser Grenzlinie. Blitzschnell griff er jetzt nach dem Handgelenk der Stewardess, die mit einem Tablett voller Bonbons aus der Anrichte kam. Er hielt sie fest. "Die charmante Dame dort hinten und der Herr neben ihr, gehören die zusammen?"
"Tut mir leid, Mister ..."
"Polin, nicht wahr?" Er gab ihr Gelenk nicht frei. "Der Mann auch?"
Die Stewardess zögerte. "DDR", verriet sie schließlich widerwillig. Alan Peers nahm seine Hand zurück. "Sehr freundlich." Er lächelte.
"Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit", meldete sich der Flugkapitän über den Bordlautsprecher. "Wir haben Funkverbindung mit unserem Zielflughafen. In etwa dreißig Minuten werden wir landen. Die Zentrale von Ocantros-Airport bittet Sie schon jetzt um Verständnis für Verzögerungen, die sich bei der Zoll- und Passkontrolle ergeben können ... Auf Premierminister Kulaman wurde heute ein Attentat verübt. Dieser Umstand hat besondere Sicherheitsmaßnahmen zur Folge ..."
Der Flugkapitän wiederholte die in russisch gegebene Information in englischer Sprache. Die Passagiere reagierten unterschiedlich. In vielen Mienen widerspiegelte sich ungläubige Verwunderung. Einige Mitreisende verhielten sich gleichgültig wie Alan Peers, der beinahe gelangweilt seine Brillengläser zu putzen begann. Ganz anders sein Begleiter. Bush Jugder trug die Spur eines Schmunzelns auf den Lippen und interessierte sich nun, wenn auch unauffällig, für die Gesichter der anderen Fluggäste.
Wassilij Ostschenko, der Kinderarzt, blickte nachdenklich hinaus und überlegte, welche Einflüsse innenpolitische Auseinandersetzungen auf seine bevorstehende Arbeit haben könnten. Ihn beschäftigte der Gedanke an die Möglichkeit, wegen einer sich vielleicht zuspitzenden politischen Lage auf der Insel zurück in die Heimat beordert zu werden. Der Hühnerspezialist wiederum ließ den Blick nicht von der Uhr und rechnete ärgerlich den angekündigten möglichen Zeitverlust in seine geschäftliche Terminplanung ein.
Während der Ansage des Flugkapitäns beobachtete Martin Katrup seine Nachbarin und hatte eine ironische Anspielung auf den von ihr kurz zuvor gepriesenen friedvollen Alltag der Insel im Sinn, doch er schwieg, denn er entdeckte, dass sie von der Nachricht erschreckt worden war. So sieht jemand aus, dem ein Traum zerbrochen ist, dachte er betroffen. Da stirbt ihre Hoffnung auf einen anscheinend vergessenen Winkel Erde ohne Hass und Feindschaft. Bestimmt würde sie sich gut mit Schnuff verstehen!
Auf den Monteur aus Neuenthal übte die Meldung von dem Attentat keine beunruhigende Wirkung aus. In seinem Betrieb gab es Leute, die behaupteten, man müsse Martin Katrup statt seines neuen Trabant mindestens ein lebendiges Nashorn in die Garage stellen, um den Mann aus der Fassung zu bringen. Selbst ein übereifriger Normprüfer, einundzwanzig verregnete Urlaubstage auf dem Campingplatz an der Ostsee und auch das beängstigend hohe Zahnfieber seines Töchterchens Silke hatten das nicht erreicht. "Nur keine Panik!" lautete einer seiner Lieblingsaussprüche, und ein anderer: "Immer sachte, bis ganz klar ist, ob der Stiel zu 'ner Pusteblume oder zu 'ner Handgranate gehört!" Allein die Tatsache, dass jemand versucht hatte, den Premierminister von Ocantros umzubringen, veranlasste ihn keineswegs zu spekulativem Überdenken der neuen Situation. Er wusste, dass ein Mitarbeiter seiner Botschaft ihn am Flugplatz sofort über alles Wichtige informieren würde. Bis dahin war ihm eine andere Sorge viel näher. Sie stellte sich vor jedem Start und jeder Landung ein: Wenn es die Jungs dort vorn im Cockpit nur schön magenfreundlich hinkriegen!
Er nahm einen Bonbon von dem Tablett, das ihm die Stewardess mit einem aufmunternden Lächeln entgegenhielt. "Danke", sagte er, und es klang wie ein Seufzer.
Der Platz vor der Kathedrale war voller Stimmen und Geräusche. Wer ein Huhn zu Geld machen wollte, einen Korb voll Zitrusfrüchte, ein paar Fische, eine geschnitzte Tanzmaske oder geklaute Autoreifen, der breitete seine Waren hier aus. Wer in die Hauptstadt oder in der Umgebung zu ein paar Cents gekommen war, brachte sie hierher. Dieser Platz, so groß wie drei Fußballfelder, war der Supermarkt von Ocantros-City. Hier gab es alles, was Menschenhände ernten, herstellen oder stehlen konnten. Wer hier hockte und auf Kunden wartete, der galt als Händler, unabhängig von der Größe seines Unternehmens. Neben dem Besitzer eines zerschlissenen Zeltdaches und vieler gefüllter Körbe kauerte ein Kerlchen, das auf einem ausgebreiteten Tuchfetzen drei Schachteln amerikanische Zigaretten anbot. Er pries die Ware mit der gleichen singenden Lautstärke an wie sein begüterter Nachbar die seine. Ihr Geschrei wie das der "Konkurrenten" wurden übertönt vom "Yellow Submarine" der Beatles. Der heisere Lautsprecher eines in allen Fugen ächzenden Kinderkarussells plärrte diesen uralten Schlager immer und immer wieder. Dazu lärmten Halbwüchsige, stritten Frauen heftig um den Preis für ein Stück Stoff oder eine nicht mehr ganz frische Hammelkeule, hämmerte ein Kommentator von Radio Aden rau und leidenschaftlich Beschwörungen zur arabischen Einheit aus einem Transistorgerät. Die Nachricht von dem Attentat in der Kathedrale hatte das geschäftige Treiben noch nicht erreicht.
Am Ende des Platzes, wo die Hauptstraße von Ocantros-City mündete, fand Matthews Sinelakos auf seinem Fluchtweg noch Zeit für die Auslagen eines Souvenirverkäufers. Solche Stände waren nach dem Abzug der Engländer hier selten geworden. Sinelakos wählte einen daumengroßen, kunstvoll aus Jade geschnitzten Buddha und zahlte anstandslos die geforderte Summe. Sie erschien ihm angemessen und war doch weit überhöht. Er brachte den Verkäufer um die Freude am Feilschen, und der Mann ärgerte sich offensichtlich, dass er diesem unsympathischen Fremden nicht das Doppelte abgefordert hatte. Als er die zierliche grüne Figur in Seidenpapier wickelte, entstand am Kirchenportal Unruhe. Das Gewirr der Stimmen schwoll an. Der Verkäufer reckte neugierig den Hals und vergaß seinen Unmut. Er verbeugte sich höflich und winkte einem Jungen, der auf den Stand aufpassen sollte. Vor der Kirche sammelte sich eine von Minute zu Minute dichter werdende Menge. Niemand achtete auf den rotblonden Ausländer im Kakianzug, der in entgegengesetzter Richtung davonschlenderte.
Zwei Kugeln aus der Maschinenpistole, die vom Attentäter im Trifolium zurückgelassen worden war, hatten Henry Kulaman getroffen. Minutenlang lag er bewusstlos und stark blutend am Boden, umringt von verstörten, ratlosen Frauen und Männern, die sich auch von den erregten Offizieren nicht wegdrängen ließen. Andere Geschosse hatten sofort den Tod gebracht. Man bettete zwei Leichname vor den Altar. Die Toten waren ein Major aus der Begleitung des Premierministers und ein junger Bastflechter, der nur zum Gottesdienst gegangen war, weil er mit einem Gebet für die Geburt seines ersten Sohnes Dank abstatten wollte. Sinelakos' Kugeln hatten weitere neun Gläubige so schwer verletzt, dass sie ins Hospital gebracht werden mussten.
Als Henry Kulaman von zwei Offizieren endlich auf eine Trage gehoben und zum Ausgang gebracht werden konnte, wich ihm ein hagerer dunkelhaariger Mann mit brennenden Augen nicht von der Seite. Es war Silviari Branco, der Distriktchef des Büros für Sicherheit und Information aus Port Albert, den eine langjährige Freundschaft mit Kulaman verband.
Die Leute vor dem Portal traten zurück. Inzwischen waren zwei Krankenwagen eingetroffen. Schweigend gaben die Frauen und Männer den Weg zu den Fahrzeugen frei. Zum ersten Mal seit Wochen verstummte der Lautsprecher des Kinderkarussells am hellen Tag. Ungewöhnliche Stille lastete über dem Platz. Tiefe Verwirrung hatte sich ausgebreitet. Niemand wusste eine Erklärung für das Verbrechen. Hatte Henry Kulaman plötzlich Feinde? Seit dem Tag, an dem auf Ocantros der Union Jack für alle Zeiten eingeholt worden war, galt dieser Mann als Symbol für die friedlichen Ziele der jungen Inselrepublik. Wer konnte ein Interesse daran haben, dieses Leben auszulöschen?
Matthews Sinelakos verließ die Hauptstraße von Ocantros-City. Er bog in eine enge, übel riechende Gasse ein und gelangte zu einem schmutzigen Hinterhof. Eine kleine Tür öffnete er lautlos. Ungesehen betrat er einen schmalen, auffallend sauberen Toilettenraum. Meergrüne Kacheln bis an die Decke. Schwach-herber Geruch eines Desinfektionsmittels. Hinter verriegelter Tür legte der Mann aus Wisconsin seine Tarnung ab; Brille, rotblonde Perücke und Augenbrauen, die beiden links und rechts vor die Backenzähne geschobenen Plastikwangenpolster. Minuten später betrat er, äußerlich völlig verändert, den Gastraum der "Drei Lotosblumen". Geradewegs ging er auf den Tisch zu, wo noch das von ihm vor seinem Weggehen erst zur Hälfte geleerte Glas Cola-Brandy auf ihn wartete. Auch der Inder, mit dem Sinelakos vor knapp einer Stunde in die "Drei Lotosblumen" gekommen war, saß noch am Tisch hinter seinem Drink und verhielt sich nicht anders, als sei der Amerikaner nur für wenige Augenblicke draußen gewesen. Sie sprachen eine Weile über die neuen Automodelle von Chrysler, dann begannen zwei reizende junge Chinesinnen nach der Regie des fettleibigen Lokalbesitzers mit dem Auftragen einer umfangreichen Mahlzeit. Eröffnet wurde die Speisenfolge vom "Reis der acht Köstlichkeiten", einem Reispudding mit eingeschichteten Mandarinen, Datteln, Mandeln, Äpfeln und Nüssen. Es folgten Jou Szu Chao Mien, die fein gewürzten gebackenen Nudeln. Danach Tang su jü, der süßsauer kandierte Fisch, duftend nach Ingwer und frischen Pilzen, und anschließend Djiaudze, die kleinen, mit Fisch- und Fleischragout gefüllten Teigtäschchen. Als endlich die mit einer Mischung aus Honig, Walnüssen und Ingwerpulver veredelten und goldgelb überbackenen Birnen serviert wurden, waren seit den Schüssen in der Kathedrale fast zwei Stunden vergangen.
Begleitet von dem einsilbigen, aber nicht unfreundlichen Inder fuhr Matthews Sinelakos in einem Taxi zum Flughafen, der auf halbem Weg zwischen den beiden großen Städten der Insel, Ocantros-City und Port Albert, lag. Sein nicht sehr umfangreiches Gepäck hatte man schon am Morgen vom Hotel vorausgeschickt. Bis zum Abflug nach Kairo blieb dem Orchideenzüchter noch eine knappe Stunde Zeit. Während er sich an der Bar einen Bourbon mit Soda bestellte, ging der Inder zur Telefonzelle. Der Flugplatzlautsprecher kündigte die Landung der Maschine aus Prag an. Sinelakos trank ohne Hast, doch nachdem er sein Glas geleert hatte, war der Inder immer noch nicht zurückgekommen. Das lange Fernbleiben seines Kontaktmannes beunruhigte den Amerikaner. Er ließ sich einen zweiten Bourbon geben und merkte, dass seine Hände feucht wurden. Das kam bei ihm nur sehr selten vor. Einige Wochen zuvor allerdings waren seine Finger auch nass wie aus dem Wasser gezogen gewesen, denn er hatte eine Telefonrechnung über achthundertachtundachtzig Dollar bekommen, was sich jedoch später als Folge eines Defektes im Schreibwerk des Computers der Abrechnungsstelle aufklärte. Jetzt begann er um seine noch ausstehenden fünftausend Dollar zu fürchten. Seine Nervosität wuchs. Der Barmixer deutete fragend auf das geleerte Glas.
"Nein danke. Keinen Alkohol mehr! Cola. Mit Eis."
Durch die großflächigen pendelnden Glastüren betraten drei Uniformierte den Warteraum des Flughafens. Ein Dutzend Augenpaare blickten dem Offizier und seinen mit Maschinenpistolen bewaffneten Begleitern gespannt entgegen.
Passkontrolle!
Normalerweise beschränkte sich dieser Vorgang auf Ein- und Ausreisende und wurde an der Durchgangssperre erledigt. Das Attentat hatte besondere Regeln in Kraft gesetzt. Der kontrollierende Offizier kam heran. Matthews Sinelakos zückte die Brieftasche. Sein Blick flog zu den Telefonzellen. Er sah, wie der Inder aus einer der schmalen Türen trat und die Richtung zur Bar einschlug.
"Ihren Pass, bitte", forderte der Offizier höflich. Er blätterte in dem Dokument, prüfte Personalien und die verschiedenen Sichtvermerke, die den Besitzer als weit- und häufig reisenden Geschäftsmann auswiesen, und fragte endlich: "Sie verlassen Ocantros? Der Abflug ist schon länger gebucht? -Aha! - Angenehmen Flug wünsche ich, Mister Sinelakos."
Auch die Ausweispapiere des Inders, der herangekommen war, wurden von der Militärstreife überprüft und nicht beanstandet. Der Offizier wandte sich anderen Gästen zu.
"Als die Kerle auftauchten, sind mir ein paar für Sie nicht gerade freundliche Gedanken durch den Kopf gegangen", gestand Sinelakos leise. "Immerhin bringen fünftausend Dollar leicht auf schlechte Einfälle! Alles in Ordnung?"
Der Inder verzog keine Miene. Mit einem Wink gab er dem Barmixer den Wunsch nach einer Cola zu verstehen. Kaum merklich schüttelte er den Kopf.
Sinelakos hob die Brauen. "Etwa nicht?"
"Nein!" Der Inder sprach, ohne die Lippen erkennbar zu bewegen. Seine Worte mussten für den einige Meter entfernt hantierenden Barmixer unverständlich bleiben. "Er ist nur verwundet. Er wird leben."
Von den beiden Kugeln, die Henry Kulaman getroffen hatten, war eine glatt durch den linken Oberarm geschlagen, die andere steckte noch im linken Schulterblatt. Vermutlich verdankte der Premierminister sein Leben dem Warnruf des Geistlichen, denn keine der beiden Wunden ließ ernsthafte Folgen befürchten. Dieses Untersuchungsergebnis wurde zwar streng geheim gehalten, aber der Frau, mit der Sinelakos' Kontaktmann telefoniert hatte, blieben auf Ocantros nur wenige Türen verschlossen.
"Wir haben für Sie ein schönes, kleines Appartement in Port Albert", sagte der Inder. "Ihr Visum ist ja noch bis zum Monatsende gültig ... Fast zwei Wochen!"
Matthews Sinelakos schaute zu den Glastüren. Der Offizier und die beiden Bewaffneten hatten ihre Kontrolle beendet und verließen den Warteraum. Der Mann vom Lake Michigan dachte angestrengt nach. Einerseits wollte er die in Aussicht stehenden fünftausend Dollar nicht in den Wind schreiben, andererseits konnte er sich leicht ausrechnen, dass die Gefahr für ihn mit jedem weiteren Tag auf Ocantros wuchs.
"Reisende soll man nicht aufhalten", sagte er unschlüssig.
Um die schmalen Lippen des Inders zog ein Anflug von spöttischer Heiterkeit. "Sie würden sich nicht langweilen, Mister Sinelakos", meinte er leise. "Ganz abgesehen vom geschäftlichen Vorteil." Er beugte sich ein wenig vor und nannte eine Summe. Sinelakos stutzte, musterte ihn einen Augenblick misstrauisch und winkte dann dem Barmixer, um die Drinks zu bezahlen. Kurz danach verließ er an der Seite des Inders das Flughafengebäude und stieg in ein Taxi.
Die drei Beamten der Zollkontrolle begegneten mit entwaffnender Freundlichkeit dem Groll der Ankömmlinge. Kein Koffer blieb ungeöffnet, und nach einem undurchschaubaren Modus mussten einige Passagiere sogar strenge Leibesvisitationen erdulden, wollten sie nicht als unerwünschte Personen gleich im Flughafengebäude auf den nächsten freien Platz in einer abfliegenden Maschine warten.
"Chile!", sagte Jagoda Woronicz leise und unvermittelt. Sie stand mit Martin Katrup im Abfertigungsraum etwas abseits an einem der hohen Fenster und schaute hinüber zur Gepäckrampe. Dort verstauten Alan Peers und Bush Jugder missmutig Wäsche und Reiseutensilien wieder in ihre Koffer.
"Santiago de Chile", sagte sie sinnend. "Vor zwei Jahren."
"Journalist?"
Martin Katrup beobachtete, wie auf dem betonierten Abfertigungsvorfeld Spezialfahrzeuge bei der Iljuschin hielten. Der Flugriese wurde bereits für den Rückflug vorbereitet. Weshalb nimmt sie diesen grau eingewickelten Klotz nur so wichtig, überlegte er verstimmt. Wenn es wenigstens einer wäre, nach dem man den Kopf dreht, und nicht so 'ne Sesselknolle, die nach französischem Rasierwasser und nach Geld stinkt!
"Er gehört zur ABMC", erklärte Jagoda Woronicz. Sie ließ Peers nicht aus den Augen. "American British Mining Corporation ... Kupfer. Damals hieß es, er sei in die Konspiration gegen Allende verwickelt gewesen. Man hat ihn ausgewiesen."
"Wegen des Attentats?", Martin Katrup musterte die Polin zweifelnd. "Aber auf Ocantros ist doch nichts mit Kupfer oder so", erinnerte er an ihre Beschreibung von Ocantros. "Hätte dieses Inselchen nur ein paar Brocken Erz aufgewiesen, die Engländer hätten garantiert ihre Teepötte nicht eingepackt, bevor der letzte Krümel aus der Erde gekratzt wäre. Ocantros lebt vom Fischfang, hab' ich im Geografiebuch gelesen. Und von Landwirtschaft. Gewürze ..."
"Ich weiß, ich weiß." Die Journalistin winkte ab. "Aber wegen einer Handvoll Pfefferkörner kommt kein ABMC-Mann über den Ozean!"
Die Gepäcknummer der Polin wurde aufgerufen. Martin Katrup musste noch warten. Als endlich auch seine beiden schweren Lederkoffer auf der Rampe lagen, hatte Jagoda Woronicz die Halle bereits verlassen.
Gelangweilt schaute der Monteur zu, wie der unentwegt schmunzelnde Zöllner zwischen Wäsche und Oberbekleidung kramte, das Reise-Necessaire fand und den Inhalt Stück für Stück in Augenschein nahm, als sähe er derartige Gegenstände zum ersten Mal. Martin Katrup ließ sich von der krötenhaften Langsamkeit des Vorganges nicht aus der Ruhe bringen. Auch die Röntgenblicke der Zöllner machten ihn nicht nervös. Sein Gepäck und seine Taschen waren sauber. Keine Konterbande. Der verstohlene Tipp des kaufmännischen Direktors, man könne auf Ocantros für ein halbes Dutzend ORWO-Filme die wertvolle und fachgerecht gegerbte Haut einer Riesenschlange einhandeln, hatte ihn nicht zu einem Schmuggelversuch verlockt. Krumme Wege mochte er nicht, und mit einer Schlangenhaut hätte er ohnehin absolut nichts anzufangen gewusst. Die ausgefallenen Gewürze und der lebendige Affe auf dem Wunschzettel, den ihm seine Frau und sein Töchterchen mitgegeben hatten, lagen durchaus innerhalb der Möglichkeiten, die er sich bei sparsamem Umgang mit dem Taschengeld legal offenhalten konnte. Also keine grauen Touren.
Genauso verhielt er sich zu Hause im Betrieb. Da war zum Beispiel die Sache mit den zwei Metern Stahlrohr gewesen, die er für seine Fernsehantenne gebraucht hatte. Ein Engpass. Überall in Neuenthal bedauerndes Schulterzucken, vielleicht im nächsten Quartal. Im VEB TRAMAG dagegen lagen genug Rohre mit genau dem richtigen Durchmesser. Sie wurden für die Produktion benötigt. Hunderte von Metern. Was kommt es da schon auf ein paar Schrittlängen an, dachte der eine oder andere Kollege, und in der Nachtschicht flog irgendwo am Rande des Werkgeländes so ein Stück Rohr über den Zaun. Für Martin Katrup kam das nicht infrage. Er wanderte von Bürotür zu Bürotür, bis er endlich alle Genehmigungen hatte, zwei Meter Rohr aus Reststücken zusammenzubauen. Mancher im Werk nannte ihn deswegen einen Moralmuffel, zumal von ihm keine Geschichte in Umlauf war, bei der man sich amüsiert auf die Schenkel schlagen oder wenigstens schadenfroh sein konnte. Tüchtig, zuverlässig und aufgeschlossen, hieß es in seiner Personalakte. Einwandfreies Familienleben. Moralisch nichts Nachteiliges bekannt. Nur drei Leute hatten Kenntnis davon, dass ein im Konstruktionsbüro dringend benötigtes Kopiergerät englischer Produktion von Martin Katrup in Sri Lanka beschafft und unbemerkt durch die Ausfuhr- und Einreisekontrollen gebracht worden war. Es gab durchaus Augenblicke, in denen ihn seine Frau, genannt Schnuff, versonnen musterte und meinte, dass er es wahrscheinlich doch faustdick hinter den Ohren habe.
"Ein Talisman", erklärte Martin Katrup unbefangen. Der Zöllner drehte misstrauisch ein Holzkästchen in den Händen. Er hatte es im zweiten Koffer, vergraben unter Schlafanzügen, gefunden. Der Deckel war fest verschlossen. Dem Beamten erschien ein kleiner, seitlich herausragender Drehgriff und ein flaches Hebelchen als besonders verdächtig. Er witterte Terror. Angestrengt überlegte er, ob er einen Vorgesetzten rufen oder den Fremden auf der Stelle festnehmen sollte. Er kam zu keiner Entscheidung. Ehe er sich versah, hatte ihm Martin Katrup das verdächtige Objekt abgenommen und den winzigen Hebel bewegt. Ein leises Schnurren. Das Blut wich aus dem Gesicht des Zöllners. Martin Katrup lächelte erwartungsvoll. Hell und fein, wie von gläsernen Glöckchen geläutet, klang eine Melodie durch die Halle: "Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht soweit ..." Der Beamte lauschte erleichtert und beinahe andächtig, kratzte dabei seinen Handrücken und fragte schließlich: "Verkaufen Sie das, Mister?"
"Erst als Vorletztes", erwiderte Martin Katrup, und der Beamte nickte, als habe er ebendiese Antwort erwartet.
Über dem betonierten Platz vor dem Flughafengebäude flimmerte Hitze. Ein paar müde, staubige Palmen spendeten kärglichen Schatten für die Leute, die am leer gefegten Taxistand bei ihren Koffern und Reisetaschen hockten. Gegenüber warteten abfahrbereit drei Omnibusse, zwei davon in den blauweißen Farben des staatlichen Verkehrsunternehmens von Ocantros. Es waren Modelle aus den von der britischen Armee zurückgelassenen Materialbeständen. Mindestens zwanzig Jahre alt. Der dritte Bus hob sich deutlich von diesen Militärveteranen ab: hohe Rundsichtscheiben, blinkender Chrom, polierter Lack, WC-Kabine am Ende des Fahrgastraumes, der Motor hinter dem Kühlergrill ein flüsternder Riese. "Hotel Westminster - Port Albert", informierten rote Buchstaben auf silberweißem Grund an den Flanken des Luxusfahrzeuges. Am Heck verhieß ein Slogan: "Westminster - glückliche Tage auf einer glücklichen Insel!"
Im Hotelbus saßen bereits der Arzt aus Kiew und sein Schachpartner, der alle zwei Minuten auf die Uhr schaute und nervös hin und her rutschte. Sie waren eingestiegen, nachdem der olivfarben livrierte Fahrer ihr Gepäck verstaut hatte. Jagoda Woronicz stand noch an der offenen Tür und beobachtete das Portal. Martin Katrup kam als einer der letzten Passagiere der Iljuschin aus dem Flughafengebäude. Er wurde von einem untersetzten, korrekt gekleideten Mann begleitet. Sie winkte dem Monteur zu, doch er war so sehr in das Gespräch vertieft, dass ihr Signal ihn nicht erreichte. Ein Diplomat, vermutete sie. Wer bei über dreißig Grad im Schatten geschlossenen Anzug und Krawatte trägt, kann nur Diplomat sein!
"Ich verstehe das nicht", beteuerte Heinz Förster, Sekretär der DDR-Botschaft. "Ahlert und Tempel wollten Sie abholen. Sie wussten, dass ich den ganzen Vormittag über in der Botschaft erreichbar gewesen bin. Weshalb haben die beiden mich nicht angerufen, wenn es Terminschwierigkeiten gegeben hat?" Er fingerte verstimmt an seinem engen Hemdkragen.
"Vielleicht 'ne Autopanne", erwog Martin Katrup gelassen. Er wusste, dass den Kollegen ein betriebseigener Wartburg zur Verfügung stand.
"Der Wagen ist fast neu", wehrte Förster ab. "Und Ahlert pflegt ihn wie eine Mutter ihr Baby. Jede freie Minute fummelt er daran herum ... Sie müssen mich vom Hotel aus anrufen, Genosse Katrup. Nach siebzehn Uhr. Hier ist meine Nummer ... Oder ich versuche doch besser, jetzt den Minister zu erreichen, damit ich Sie erst mal zum 'Westminster' bringe ..."
Katrup fiel ihm ins Wort. "Verzeihung!" Er feixte. "Manche trauen es mir nicht zu, aber es stimmt: Ich kann schon ganz allein über die Straße gehn! Ehrlich!"
Förster verzog keine Miene, sondern musterte den Monteur nachdenklich. "Hier ist manches anders als bei Ihren bisherigen Auslandseinsätzen", meinte er zurückhaltend.
Der Busfahrer hupte ein paar Mal zum Zeichen dafür, dass er nicht länger auf den letzten Fahrgast warten wollte. Hinter der Scheibe schüttelte der Hühnerspezialist entrüstet den Kopf und klopfte mit dem Zeigefinger auf das Zifferblatt seiner Armbanduhr.
2. Kapitel
Das Hotel Westminster befindet sich im Zentrum der Hafenstadt Port Albert. Unaufdringlich ordnet sich das um die Jahrhundertwende errichtete Gebäude in die graue Häuserfront ein. Allein der in Bronze geprägte Name neben dem Portal hebt das Etablissement anspruchsvoll aus der anonymen Fassadenzeile hervor. Durch sieben Jahrzehnte haben hier alle Inselbesucher von Rang und Namen Unterkunft gefunden. Von einem kleinen Hotel gleichen Niveaus in der Hauptstadt abgesehen, gibt es auf Ocantros für das erste Haus von Port Albert keine Konkurrenz. Die Preise sind entsprechend. Man kann auf der Insel zwar noch einige Gasthäuser oder Pensionen finden, in denen es sich billiger wohnen lässt, doch der Besucher muss dort auf fließend Wasser, Bettwäsche und Sicherheit vor Ungeziefer verzichten. Niemand mutet ausländischen Experten und Facharbeitern derartige Behausungen zu, und so kommt es nicht selten vor, dass im Gästebuch des "Westminster" der Name eines Monteurs aus Europa zwischen solchen millionenschwerer Leute aus der Welt des internationalen Kapitals und des Hochadels steht. Martin Katrup zum Beispiel ist in dieser Liste zwischen einem Mitglied der königlichen Familie Schwedens und einem japanischen Großindustriellen eingetragen.
Das Zimmer des Monteurs liegt auf der Rückseite des Hotels. Von einem Balkon aus sieht er in einen engen, muffigen Hinterhof, der im offenen Rechteck von verwitterten Hauswänden begrenzt wird. Eine Ausfahrt mündet in eine schmale Nebengasse. Küchengeruch, vermischt mit dem Gestank faulender Abfälle, steigt aus der Schattenschlucht. Martin Katrup begreift schon in den ersten Minuten, weshalb es keinen seiner Hotelnachbarn aus der drückenden Schwüle der. Zimmer zu dem auf jedem Balkon stehenden Liegestuhl zieht. Auch er bleibt nicht lange, doch ihm entgeht nicht, dass an der hinteren Ausfahrt des Hotels zwei bewaffnete Männer in Uniform vorüberschlendern, die er bei seiner Ankunft am Portal gesehen hat. Das "Westminster" wird von Militär bewacht!
Martin Katrup bringt den Inhalt seiner beiden Koffer in Schrankfächern und auf Kleiderbügeln unter, doch seine Gedanken bleiben währenddessen noch eine Weile bei den Uniformierten. An und für sich hat er nichts gegen besondere Schutzmaßnahmen für Ausländer. Im Gegenteil. Im Verlauf seiner Einsätze ist er schon einige Male bestohlen worden. In Colombo zum Beispiel hatte man ihm auf nie geklärte Weise das gesamte Reisegepäck aus dem Hotelzimmer entwendet. Die Diebe hatten nicht einmal seine Zahnbürste und den Rasierpinsel zurückgelassen. Sie waren spurlos verschwunden, obwohl dort in jedem Etagenkorridor ein finster blickender Aufpasser gesessen hatte. Gegen die eidesstattliche Erklärung, die Polizei aus dem Spiel zu lassen und über den bedauerlichen Vorfall Stillschweigen zu bewahren, hatte ihm die Hoteldirektion damals den Schaden sehr großzügig ersetzt, aber richtig freuen konnte er sich nicht über die neuen Anzüge, Schuhe und Reiseutensilien. Er gehört, sehr zum Leidwesen seiner Frau, zu den gar nicht seltenen Männern, die sich von einer abgetragenen Hose genauso ungern trennen wie von einem gesunden Zahn. Es gibt eine Menge Sachen, die wesentlich schlimmer sind, als beklaut zu werden, denkt Martin Katrup und hat das unangenehme Gefühl, dass die beiden Bewaffneten vor dem Hotel keine sehr zuverlässige Garantie für einen gefahrlosen Aufenthalt in diesem Land bieten.
Bevor Martin Katrup sich in einem Hotelzimmer einigermaßen heimisch fühlt, muss er davon auf eigentümliche Weise Besitz ergreifen. Auch jetzt tut er das mit Bedacht und in der Reihenfolge, die schon Gewohnheit geworden ist. Nach dem Auspacken der Koffer kontrolliert er zuerst sorgfältig, ob Licht, Telefon, Wasserleitung und Spülbecken einwandfrei funktionieren, dann stellt er das gerahmte Foto von Schnuff und Silke neben den kleinen Ventilator auf das Nachtschränkchen und holt schließlich eine große Spraydose hervor, mit der er sämtliche Winkel, Ecken und Nischen sowie den Spannteppich intensiv und bis zur Neige besprüht. Im Nu stinkt der Raum wie ein Chemielabor, doch der Monteur nimmt das unbekümmert in Kauf, denn er weiß sich nun halbwegs sicher vor dem verschiedensten Ungeziefer. Besser eine Stunde Gestank in der Nase als dauernd exotisches Viehzeug auf der Haut, ist eine seiner Regeln.
Den Abschluss dieser Inbesitznahme bildet stets ein Gang unter die Dusche. Sein Wasserverbrauch ist beachtlich. Und unter dem Brauseregen erwacht gewöhnlich die Lust, sein Wohlbehagen einer möglichst weiten Umwelt leidlich musikalisch mitzuteilen. Dann beginnt er sein mit schmetternden Nasentönen vorgetragenes Repertoire vom Rennsteiglied bis zum Triumphmarsch. So hat er es im Wasa-Hotel in Helsinki gehalten, im "Flying fish" auf Ceylon und im Budapester Hotel "Berlin". Hier im "Westminster" auf Ocantros verstößt er zum ersten Mal gegen dieses Zeremoniell. Ihm steht der Sinn nicht nach Singen. Gleich nach dem Eintreffen hat er vom Empfangschef erfahren, dass seine beiden, ebenfalls im "Westminster" untergebrachten Kollegen Ahlert und Tempel, seit achtundvierzig Stunden nicht mehr gesehen worden sind. Die Polizei ist verständigt und hat das Zimmer der verschwundenen Gäste auch schon nach Anhaltspunkten durchsucht. Angaben über das Ergebnis dieser Ermittlungen konnte er allerdings nicht machen.
Ehe Martin Katrup zu seinem Zimmer hinauffuhr, war er zu einer der Telefonzellen in der Hotelhalle gegangen und hatte die Botschaft in Ocantros-City angerufen, aber Heinz Förster nicht erreichen können. Er hörte jedoch von einem Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung, dass man dort inzwischen über das Verschwinden der beiden DDR-Bürger und über die eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen informiert war. Martin Katrup solle im Hotel bleiben und auf Försters Anruf warten.
Erfrischt von der Dusche, nur mit Badehose bekleidet, versucht er nun, die unter dem Balkonfenster eingebaute Klimaanlage in Betrieb zu setzen. Die Zimmertemperatur beträgt siebenunddreißig Grad über null, aber aus den Schlitzen der Klimaanlage weht nicht der geringste Hauch von Kühle. Martin Katrup kapituliert vorläufig, wirft sich auf das passabel gefederte Bett und erwägt, die Direktion anzurufen, doch dann besinnt er sich anders. Er will nicht riskieren, dass der Apparat blockiert ist, wenn Förster anruft. Regungslos liegt er auf dem weißen Laken, schwitzt, starrt zur Zimmerdecke, lauscht dem monotonen Surren des kleinen Tischventilators und dem nur schwach vernehmbaren Ticken des Miniaturweckers. Seine Gedanken sind bei dem Ingenieur Klaus Ahlert und dem Mechaniker Harry Tempel. Er kennt die beiden Männer nicht nur von vielen hundert gemeinsamen Arbeitsstunden. Gemeinsame Mühen und die Freude über Erfolg hat sie in den Jahren zu Freunden werden lassen. Jeder weiß, was das Wort des anderen wiegt. Martin Katrup zweifelt nicht, dass etwas Schlimmes geschehen sein muss, wenn es von Ahlert und Tempel schon mehr als zwei Tage kein Lebenszeichen gegeben hat.
Blechern scheppert das Telefon.
Martin Katrup meldet sich eilig. Er vernimmt ein metallisches Knacken in der Leitung, danach herrscht wieder Stille. Er ruft, hämmert nervös auf die Gabel, findet kein Echo. Er glaubt an eine Störung, legt kurz auf und wählt dann die Nummer der Telefonzentrale. "Zimmer dreihundertzwölf, Katrup", sagt er und reibt Schweißnässe aus seinen Brauen. "Ich hatte eben einen Anruf. Vermutlich aus Ocantros-City ..." Er stockt. Jemand klopft an die Zimmertür. "Einen Augenblick bitte", murmelt er, legt den Hörer neben den Apparat und geht zur Tür. Seine spärliche Bekleidung zwingt ihm Zurückhaltung auf.
"Branco", sagte der Mann, der geklopft hat. "Silvian Branco ... Ich darf doch eintreten, nicht wahr?" Er steht im Zimmer, noch ehe der Monteur ein Wort über die Lippen gebracht hat. Branco blickt sich im Raum um, entdeckt das Telefon, tritt heran und legt den Hörer auf die Gabel. Er lächelt. "Der Anruf kam von mir. Ich wollte nur wissen, ob Sie im Zimmer sind. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug, Mister Katrup."
Der Monteur mustert den merkwürdigen Eindringling wie jemanden, der auf beiden Ohren Wellensittiche spazieren trägt. Der Besucher ist klein, schlank und dunkelhäutig. Obwohl er höchstens Anfang dreißig sein kann, umgibt ein schwarzer Haarkranz die sonnengebräunte Glatze. Dafür sprießt über seiner Oberlippe ein dichter, wie lackiert glänzender Schnurrbart. Sein sportlich-eleganter Einreiher verrät die Hand eines geschulten und mit den gegenwärtig in Europa vorherrschenden Details in der Herrenmode vertrauten Schneiders. Besonders fällt Martin Katrup ein Ring auf, den der ungebetene Gast an der linken Hand trägt. Ein ziemlich breiter Goldreif öffnet sich rhombisch für einen wasserhellen, erbsengroßen Stein, dessen lebhafter Glanz bei der geringsten Bewegung immer anders funkelnde Lichtreflexe ausstrahlt. Für einen getrockneten Fisch und zwei Hände voll Reis hat er den nicht an den Finger gekriegt, denkt der Monteur. Er mag Männer, die sich Ringe an die Finger stecken, nicht besonders.
"Was wollen Sie von mir?", fragt er, die Hand auf dem Griff der noch offenstehenden Tür.
Brancos Lächeln bleibt freundlich. Er zeigt erst auf die geöffnete Fensterjalousie und dann zum Korridor. "Sie stehen im Zug", stellt er freundlich warnend fest. "Lassen Sie sich nicht von der Hitze täuschen. Sie wären nicht der erste Europäer, den nach zwei, drei Tagen auf Ocantros eine Lungenentzündung erwischt."
Die Tür fällt ins Schloss. "Also?", fragt Martin Katrup.
"Ich bin Leiter des Sicherheitsbüros in Port Albert", erklärt Branco, und seine Miene verändert sich. Unvermittelt wirkt er um Jahre älter. "Es geht um Mister Ahlert und Mister Tempel. Sie haben gehört, dass die beiden verschwunden sind?"
"Kennen Sie den Grund? Haben Sie schon eine Erklärung?"
Branco schüttelt den Kopf.
"Es kann ein Unfall sein", sagt Martin Katrup. Er beginnt sich anzukleiden und wirft dabei Branco einen kurzen, fragenden Blick zu. "Oder?"
"Vorläufig haben wir noch nicht einmal Vermutungen." Der Sicherheitschef wandert durch das Zimmer. Sein Blick findet immer neue Ziele, hält sich aber bei keinem Detail länger als zwei, drei Sekunden auf. "Ihre Kollegen sind vorgestern zum letzten Male gesehen worden, mit Gepäck wie zu einem Picknick. Sie haben ihren Wagen genommen. Da sie gestern Nachmittag noch nicht zurückgekommen waren, hat uns die Hotelleitung verständigt." Er schaut auf seine Uhr. "Jetzt werden sie seit sechsundzwanzig Stunden von der Polizei unseres Landes gesucht. Vergeblich. Leider. Nichts. Keine Spur. Weder von ihnen noch von dem Auto. Dabei ist es der einzige Wagen dieses Typs auf Ocantros."
"Bestimmt ein Unfall", wiederholt Martin Katrup.
"Wahrscheinlich liegen sie irgendwo schwer verletzt. Sie müssen gefunden werden, hören Sie? Ocantros ist doch kein Erdteil."
Branco hält in seiner Wanderung inne und betrachtet den Monteur nachdenklich. "Wir haben das Hotelzimmer nach Anhaltspunkten durchsucht."
"Und?"
"Es sieht nicht nach einem Unfall aus, Mister Katrup."
Martin Katrup stutzt. "Sondern?"
"Merkwürdigerweise haben wir nur wenige persönliche Dinge gefunden. Schlafanzüge, Turnschuhe, Zahnbürsten, einige Wäschestücke ... Keine Koffer, keine Anzüge. Nichts, was von Wert ist. Es sieht alles nach Abreise aus. Nach überstürzter Abreise."
"Was wollen Sie damit sagen?" Martin Katrups Stimme klingt gereizt. Er lässt Branco nicht aus den Augen.
Der Sicherheitschef lockert Krawatte und Hemdkragen. "Bei allen heiligen Kühen, das ist ja nicht zum Aushalten hier!" Er sucht das Wandthermometer. Unwillig schüttelt er den Kopf.
"Die Klimaanlage", klärt Martin Katrup ihn ein wenig ungeduldig auf. "Außer Betrieb ... Unsere Botschaft ist erst heute vom Verschwinden meiner Kollegen verständigt worden. Weshalb haben Sie so lange damit gewartet?"
"Ich hielt es für wichtiger, erst die Suchaktion einzuleiten. Immerhin hätte die Sache auch einen ganz harmlosen Grund haben können ... Ich darf doch?" Er greift zum Telefonhörer und lässt sich mit der Hoteldirektion verbinden.
Martin Katrup versteht nichts von dem Wortschwall, den Branco durch die Sprechmuschel schickt. Der Sicherheitschef spricht arabisch. Martin Katrup hat gelesen, dass diese Sprache für viele Einheimische auf Ocantros trotz unterschiedlichster Nationalität zur Verständigung dient und deshalb auch in absehbarer Zeit zur Amtssprache erklärt werden soll. Er kann am Mienenspiel erkennen, dass sein Besucher mit dem Ergebnis des Telefonats nicht zufrieden ist.
"Wir wollten nicht, dass Mister Ahlert und Mister Tempel wegen eines von unserer Seite übereilten Schrittes Ungelegenheiten mit ihren vorgesetzten Stellen bekommen ... Sie verstehen?"
Wie Ahlert und Tempel, so ist auch Martin Katrup mit jeder der strengen Regeln vertraut, an die sich alle im Ausland tätigen Betriebsangehörigen des VEB TRAMAG halten sollen.
"Keine Ersatzteile", sagt Branco unvermittelt und deutet auf die Klimaanlage. "Defekt auf der ganzen Etage. Die Geräte stammen von einer Firma aus Liverpool. Ein englischer Spezialist ist unterwegs, heißt es. Schon seit zwei Monaten."
Auf dem frischen Hemd, das Martin Katrup angezogen hat, wachsen feuchte Flecken, aber er achtet in diesen Minuten kaum noch auf die drückende Schwüle. "Sie haben doch Vermutungen, nehme ich an. Abreise der beiden ist natürlich Unsinn. Das würde die Botschaft wissen. Außerdem stecken wir noch mitten in der Arbeit. Also? Ein Verbrechen? Entführung?"
"Jedenfalls sieht es nicht, wie von uns anfangs angenommen, nach einer Bagatelle aus." Seine Stimme klingt besorgter als vorher. "Auf unserer Insel geht irgendetwas Miserables vor, Mister Katrup. Wir wissen noch nicht, was dahintersteckt. Attentate, Sabotage gegen Regierungsprojekte ... Jeden Tag eine neue Gemeinheit."
"Sie sehen da Zusammenhänge mit dem Verschwinden meiner Kollegen?
"Wer weiß", erwiderte Silvian Branco unbestimmt.
"Eine Entführung würde durchaus in ein Konzept gegen die Regierung passen. Überlegen Sie mal. Die Druckerei, die Sie für uns bauen, ist die erste und vorläufig einzige auf Ocantros. Sie bedeutet für uns, dass die Kinder mit Lehrbüchern in die Schule gehen können, dass wir endlich eine Zeitung haben werden, dass wir nicht jedes Formular und jedes Flugblatt im Ausland drucken lassen müssen. Eine eigene Druckerei ... Wenn wir reich wären, würden wir sie mit Gold aufwiegen! Begreifen Sie, wie wichtig Ihre Arbeit für uns ist?"
Martin Katrup nickt.