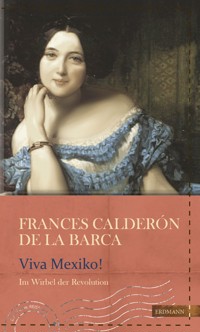
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Erdmann in der marixverlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die kühne Reisende
- Sprache: Deutsch
Sieben stürmische und nervenaufreibende Wochen auf See dauerte es, bis das frisch vermählte Paar Frances und Ángel Calderón de la Barca, von New York kommend, mit Zwischenstopp in Havanna, am 18. Dezember 1839 in Veracruz / Mexiko ankommen. Don Ángel ist der erste Botschafter, der von der spanischen Krone in die junge mexikanische Republik entsandt wurde. Die de la Barcas kommen in ein Land, das sich im Umbruch befindet, in eine Welt, in der es nach der schwer erkämpften Unabhängigkeit von Spanien immer noch brodelt. In Begleitung ihres Mannes, aber auch allein, reist Frances Calderón de la Barca quer durch das Land, auch dorthin, wo Gefahren lauern. Sie nimmt an politischen Ereignissen teil, schließt Freundschaften. In Briefen an ihre Familie und Freunde berichtet sie vom ersten Tag an über ihre spektakulären Erlebnisse und Erfahrungen während ihres zweijährigen Aufenthalts in Mittelamerika. Erstmals auf Deutsch!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE KÜHNE REISENDE
Frances Calderón de la Barca, geboren 1804 als Frances Erskine Inglis, wuchs im schottischen Edinburgh auf. Als ihr Vater, ein angesehener Anwalt, 1830 starb, emigrierte die Mutter mit den zumeist erwachsenen Kindern nach Boston, wo sie eine Mädchenschule gründeten. Frances, die sich bereits als Buchautorin einen Namen gemacht hatte, arbeitete dort zunächst als Lehrerin. 1836 lernte sie den spanischen Diplomaten Ángel Calderón de la Barca kennen. Sie heiratete ihn 1838 und begleitete ihn als ersten Gesandten der spanischen Krone von Ende 1839 bis 1842 nach Mexiko – ein Zeitraum, in den gleich zwei gewaltvolle Revolten fielen. Ihr Buch »Life in Mexico«, ein lebendiger Bericht in Briefform, erschien 1843 in Boston und London. Nach dem Tod ihres Mannes 1861 wurde Fanny, die kinderlos blieb, von der spanischen Regentin Maria Cristina mit der Erziehung der Infantin Isabel de Borbón betraut. Sie starb 1882 im Königspalast in Madrid.
Klaudia Ruschkowski, Autorin, Kuratorin, Dramaturgin und Übersetzerin, lebt in Volterra, Italien, und in Berlin. Sie übersetzt aus dem Italienischen und Englischen, zuletzt u. a. Etel Adnan, Giuseppe Zigaina, Vincenzo Latronico.
Susanne Gretter studierte Anglistik, Romanistik und Politische Wissenschaft in Tübingen und Berlin. Sie lebt und arbeitet als Verlagslektorin in Berlin. Sie ist Herausgeberin der Reihe DIE KÜHNE REISENDE.
Frances Calderón de la Barca
Viva Mexiko!
Im Wirbel der Revolution
Aus dem Englischen übersetzt, bearbeitet und mit einem Vorwort von Klaudia Ruschkowski
Frances Calderón de la Barca (1804–1882)
»Ich will auf die hier und dort lautgewordene Bemerkung ›Frauen haben nichts mit Politik zu tun‹ mit Madame de Staël entgegnen: ›Mag sein, doch wenn einer Frau der Kopf abgeschnitten werden soll, ist es wohl selbstverständlich, dass sie Warum? fragt.‹ Das ist auch meine Meinung. Wenn uns die Kugeln um die Ohren fliegen und Granaten in unseren Garten einschlagen, scheint es mir mehr als verständlich und ausgesprochen weiblich, solchen Phänomenen auf den Grund zu gehen.«
Frances Calderón de la Barca
INHALT
VORWORT
von Klaudia Ruschkowski
1. BRIEFVON NEW YORK NACH HAVANNA
2. BRIEFHAVANNA
3. BRIEFEIN »NORTE«
4. BRIEFANKUNFT IN VERACRUZ
5. BRIEFVON VERACRUZ NACH PUEBLA
6. BRIEFEMPFANG IN MEXIKO
7. BRIEFAZTEKEN UND ALLTAG IN MEXIKO
8. BRIEFMOCTEZUMA UND DIE JUNGFRAU VON GUADALUPE
9. BRIEFSTIERKAMPF, HUMBOLDT UND LA GÜERA RODRÍGUEZ
10. BRIEFAUSFLUG NACH TACUBAYA UND GEDANKEN ZUR WEIBLICHEN SCHÖNHEIT
11. BRIEFDAS COLEGIO DE LAS VIZCAÍNAS
12. BRIEFPASEOS, WASSERSTRASSEN UND SCHWIMMENDE GÄRTEN
13. BRIEFVERWAHRLOSTE HERRLICHKEIT
14. BRIEFKARWOCHE IN MEXIKO
15. BRIEF»LA ENCARNACIÓN« UND DIE GACHUPINA
16. BRIEFVON TEOTIHUACÁN ÜBER SANTIAGO NACH TULANCINGO
17. BRIEFDIE MINEN VON REAL DEL MONTE UND DIE HAZIENDA VON REGLA
18. BRIEFEINTRITT INS KLOSTER
19. BRIEFGLÜCKSSPIEL IN SAN AGUSTÍN, BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN
20. BRIEFSCHULEN, BILDUNG UND ERZIEHUNG
21. BRIEFREVOLUTION IN MEXIKO
22. BRIEFKAPITULATION UND ABZUG DER AUFSTÄNDISCHEN
23. BRIEFUNABHÄNGIGKEITSTAG, HEISSE QUELLEN UND GRAUSIGE BUSSE
24. BRIEFPAMPHLETE, STIERE, MAULTIERMÄRKTE
25. BRIEFWEIHNACHTSTAGE UND POSADAS
26. BRIEFRITT ZUR TIERRA CALIENTE
27. BRIEFCOCOYOTLA UND DIE HÖHLEN VON CACAHUAMILPA
28. BRIEFVON ATLACOMULCO IN DAS TAL VON ATLIXCO UND DAS ALTE CHOLULA
29. BRIEF»LA CONSTANCIA MEJICANA« UND MEXIKANISCHE LITERATEN
30. BRIEFKARWOCHE AUF DEM LAND
31. BRIEFHIERARCHIE UND RECHT IN MEXIKO
32. BRIEFDIE »CASA DE MONEDA«, FALSCHMÜNZEREI, DER »TRAURIGE INDIANER«
33. BRIEFEINE NEUE REVOLTE, ZERSTÖRUNGEN, KAPITULATION
34. BRIEFFINDELHAUS, GEFÄNGNIS UND IRRENHAUS
35. BRIEFTOLUCA, ANGANGUEO, MICHOACÁN, TAXIMAROA, PÁTZCUARO
36. BRIEFABSCHIED VON MEXIKO
VORWORT
»Ich weiß wirklich nicht, ob ich mich freuen soll, nach Mexiko zu gehen, oder nicht«, schreibt Frances Calderón de la Barca am 23. April 1839 aus New Brighton auf Staten Island an den befreundeten Fuhrunternehmer Allyne Otis. »Es scheint mir wie das Ende des Lebens mit meiner eigenen Familie – denn anschließend wird unsere Bestimmung wohl Europa sein.« Wenige Wochen zuvor hatte Don Ángel Calderón de la Barca, der erst im Frühjahr 1838 als bevollmächtigter Gesandter der Spanischen Königin in Washington bestätigt worden war, die Nachricht erhalten, man habe ihn für eine wichtigere Aufgabe ausersehen: als ersten Gesandten Spaniens in Mexiko, der ehemaligen Kolonie, die mit Waffengewalt ihre bereits 1821 deklarierte, doch vom Mutterland lange nicht anerkannte Unabhängigkeit erkämpft hatte. Ende April scheint die Sache besiegelt, und Frances berichtet Otis in einem Brief vom 7. Mai, sie habe bereits einen spanischen Priester gefunden, bei dem sie die Sprache lernt – was ihr, wie sie bemerkt, nicht schwerfällt. Sie kündigt Otis auch schon an, dass sie beabsichtige, »lesenswerte« Briefe aus Mexiko zu schreiben.
Frances’ Leben hat sich in kurzer Zeit sehr verändert. Erst vor sieben Monaten, am 24. September 1838, war die dreiunddreißigjährige protestantische Schottin in New York von einem römisch-katholischen Geistlichen mit dem vierzehn Jahre älteren spanischen Diplomaten Ángel Calderón de la Barca getraut worden. Doch die kluge, lebenslustige und selbstbewusste Fanny, wie sie von Kindheit an genannt wird, wäre nicht sie selbst, hätte sie den neuen Möglichkeiten, die sich hier ergaben, nicht sogleich das Beste abgewinnen und sich auch an der Aussicht auf ein Reiseabenteuer freuen können. Die Rolle, die sie darin spielen wird, kommt in einem Brief ihrer Bostoner Freundin Mary Appleton vom 26. Mai 1839 zum Ausdruck: »Fanny Calderón ist nach Mexiko beordert worden, mit ihrem Don, hat aber über den Zeitpunkt der Abreise noch keine genaue Auskunft.«
Ende August erhält Calderón aus Madrid eine Kopie des Anerkennungsvertrags von Mexiko als unabhängiger Nation. Die beiliegenden Instruktionen weisen ihn an, gemeinsame kulturelle und religiöse Traditionen zu befördern, dabei strikte Neutralität zu wahren, sich nicht in innenpolitische Angelegenheiten zu mischen und stets daran zu denken, dass sich die fragilen Machtverhältnisse innerhalb der mexikanischen Parteien jederzeit ändern können. Fanny tritt Calderón und seiner Mission zuliebe zum Katholizismus über. Sie muss lernen, ihre protestantische Herkunft zu verbergen und sich nach außen hin als überzeugte Katholikin zu zeigen. Der Aufbruch kann so lange hinausgezögert werden, bis die heißesten Monate und damit die Gelbfieberschübe im tiefgelegenen Veracruz, dem wichtigsten Atlantikhafen am Golf von Mexiko, wo man an Land gehen soll, vorüber sind. Am 27. Oktober 1839 ist es soweit: Fanny und Calderón verlassen New York auf dem Paketschiff »Norma« in Richtung Havanna, am Ufer viele, »von denen der Abschied uns wahrhaft schwerfiel«. Lang hält die wehmütige Stimmung jedoch nicht vor. Fanny macht sich daran, das Schiff zu erforschen, erste Einzelheiten der Reise aufzuzeichnen und ihre Mitreisenden auf die ihr eigene pointierte, mitunter scharfzüngige Art zu charakterisieren.
Fanny wurde als Frances Erskine Inglis am 23. Dezember 1804, einem Sonntag, als fünftes von neun Kindern in ihrem Elternhaus in Edinburgh geboren. Ihr Vater William Inglis war Anwalt und führte die 1761 von seinem Vater Laurence begründete Kanzlei. Fannys Mutter Jane Inglis, geborene Stein, stammte aus einer angesehenen Unternehmerfamilie. Beide Eltern legten Wert auf Titel und Verbindungen und führten ein offenes Haus in 49 Queen Street, wozu auch die temperamentvollen Tanzvergnügen zählten, durch die Jane Inglis ihre Töchter in die Gesellschaft einführte. Da Platz für einen Schulraum vorhanden war, wurden alle Kinder zu Hause unterrichtet, und Fanny entdeckte im Alter von dreizehn Jahren nicht nur ihre Liebe zu Abenteuergeschichten, sondern auch zu Lord Byron, dessen Dichtungen sie zeitlebens zitieren wird – so berichten Marion Hall Fisher und Howard T. Fisher in ihrer sehr gründlichen Biographie der Autorin von »Life in Mexico«.
Schon früh begann sie, selbst zu schreiben. 1830 – da war sie sechsundzwanzig Jahre alt – erschien im Londoner Verlag H. Colburn & R. Bentley »Gertrude: A Tale of the Sixteenth Century« (Gertrude: Eine Erzählung aus dem 16. Jahrhundert), ein Roman in zwei Bänden. Fannys jüngster Schwester Lydia zufolge soll sie dieses Werk jedoch bereits als Fünfzehnjährige verfasst haben. »Gertrude« fand in mehreren Literaturzeitschriften Erwähnung. The London Literary Gazette vom 13. März 1830 bezeichnete Fannys Erstling als eine »schöne und romantische Erzählung«.
Von Fannys zweitem Roman »The Affianced One« (Die Versprochene) erhielt die Presse im Winter 1831 einige Vorabkopien, bevor das Buch zum Frühjahr 1832 herauskam. Der Autorin wurde ein »leichter, spritziger und lebendiger Stil« attestiert. Deutlich wird Fannys Affinität zum Süden. Sie beherrschte die italienische Sprache und kannte sich sehr gut in der italienischen Literatur aus. Mit ihren beiden älteren Schwestern hatte sie sich wahrscheinlich von Dezember 1822 bis Herbst 1823 in Italien aufgehalten, vor allem in Mailand und Florenz, hatte Alessandro Manzonis berühmten Roman »I Promessi Sposi« (Die Brautleute) gelesen und Dantes »Divina Commedia« studiert, zu der sie später einen vielbeachteten Kommentar schreiben wird. Dass Fannys Werke aber zu eben jenem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gelangten, war einer familiären Katastrophe geschuldet: 1828 musste William Inglis Bankrott erklären. Die Schulden waren enorm. Der größte Teil des Familienbesitzes wurde beschlagnahmt und zu Geld gemacht, um die Gläubiger auszuzahlen. Die Inglis packten die ihnen verbliebene Habe, verließen Schottland, überquerten den Kanal und fanden Unterkunft in Sainte-Adresse, einer kleinen Gemeinde westlich von Le Havre. Alles, was nur möglich war, musste zur Bestreitung des Lebensunterhalts verkauft werden – darunter auch Fannys Manuskripte, die sie, wie ihre Biographen vermuten, 1829 ihrem Bruder Henry nach London mitgab.
Am 19. Juni 1830 stirbt William Inglis in Sainte-Adresse, gesundheitlich und moralisch ruiniert. Jane Inglis und ihre Töchter nehmen ihr Leben nun selbst in die Hand. Sie beschließen, in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Am 18. November 1831 treffen sie in Boston ein: Jane, vier Töchter und vier Enkeltöchter – neun weibliche Wesen, von denen es schon am 12. Dezember 1831 heißen wird: »Hier ist eine interessante schottische Familie angekommen … die Mädchen tanzen wunderbar.« In Boston eröffnen die Inglis-Frauen eine Schule für junge Damen, die bereits Mitte 1832 gut etabliert ist. Fanny unterrichtet Musik, ihre Schwestern Richmond und Harriet Tanz und Malerei. Sie veranstalten Soireen: »Tanz-und-Unterhaltungsabende« – genau die Art von gesellschaftlichen Ereignissen, zu denen Fanny später auch in Mexiko einladen soll –, wodurch sie rasch bekannt werden. Ihr offenes, lebendiges Wesen verhilft ihnen zu einem großen Freundeskreis. Der Frieden währt jedoch nicht allzu lang. Es kommt zu einem Skandal, den vermutlich Fanny herbeigeführt hat, die neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin auch als Autorin von Erzählungen, Geschichten und Essays zum Unterhalt der Familie beiträgt. Eine Mitte Mai 1833 erschienene Satire, »Scenes at the Fair« (Jahrmarktszenen) – wie Fannys Biographen mutmaßen, ohne ihr Wissen von einem befreundeten Schauspieler veröffentlicht –, in der sie ihre spitze Feder an den prominenten Bostoner Organisatorinnen einer Wohltätigkeitsveranstaltung auslässt, wird ihr von vielen Seiten nicht verziehen. Der Skandal wirkt sich auf die Schule aus, einige der jungen Damen ziehen sich zurück, die Kritik bleibt auch in den nächsten Jahren unterschwellig bestehen. Die Inglis beginnen allmählich, sich nach einem neuen Wirkungskreis umzusehen, und verbringen einige Zeit in Newport, um Kontakte zu knüpfen.
Dort, im Sommer 1836, begegnet Fanny Ángel Calderón de la Barca. Er verliebt sich in die gebildete, unterhaltsame und lebenslustige Schottin. Calderóns Position ist zu jenem Zeitpunkt nicht gesichert. In Spanien war es im Verlauf des Jahres zu Aufständen gegen die Regentin Maria Cristina und deren »Königliches Statut« gekommen, die in der Meuterei von Mitgliedern der Königlichen Garde gipfelten, um die 1812 »von Spaniern für Spanier« erarbeitete Verfassung von Cádiz wieder einzusetzen. Calderón wartet monatelang auf Nachricht aus Madrid, ob und für welchen Posten man ihn unter den veränderten politischen Verhältnissen vorgesehen hat. Vermutlich vermittelt Fanny während dieser Zeit den Kontakt zwischen ihm und dem Bostoner Historiker William H. Prescott, der an seinem ersten Hauptwerk über die spanischen Herrscher Ferdinand und Isabella, die »Katholischen Könige«, arbeitet und bei Calderón detaillierte Sachkenntnis und sprachliche Unterstützung findet. Für seine dreibändige »Geschichte der Eroberung von Mexiko«, die 1843 erscheinen wird, bittet Prescott Fanny und Calderón vor ihrer Abreise, im Land für ihn zu recherchieren und Material zu sammeln. Er selbst wird sich später revanchieren, indem er Fannys Reisebericht durchsehen, »Änderungen und Striche« vorschlagen und ihn als literarisch-historische Autorität mit einem Vorwort versehen wird. Die Quellen, aus denen sich der Bericht speisen wird, sind zum einen die ausführlichen Briefe, die Fanny zwei Jahre lang an ihre Mutter, ihre Tante und ihre Schwester Richmond schreibt, zum anderen drei akribisch geführte Reisetagebücher, von denen eines allerdings verloren ging. »Zwei existieren noch«, referieren Fannys Biographen, »und sie enthalten zahlreiche Passagen, die so, wie sie dort stehen, in das Buch eingeflossen sind – andere Einträge wurden entscheidend verändert, manches fiel weg. Einige der Änderungen hatten zweifellos diplomatische Gründe, doch auch so behielt Fanny noch genügend scharfzüngig formulierte Ansichten und Beobachtungen bei. Sich dessen bewusst, dass sich ihre Einstellungen im Laufe der Reise verändert hatten und ihr Horizont weiter geworden war, entschied sie sich dennoch dafür, ihre allerersten Eindrücke von Mexiko zu publizieren, um ihre Annäherung an eine fremde Kultur in authentischer Weise zu vermitteln.«
Nach einer mehr als sechswöchigen, teilweise entnervenden Schiffsreise, in die ein Zwischenstopp in Havanna fällt, treffen Fanny und Calderón am 18. Dezember 1839 in Veracruz ein, und Fanny notiert: »Etwas Melancholischeres, Verfalleneres und Trübseligeres als das, was sich uns beim Näherkommen zeigte, lässt sich schwerlich vorstellen.« Die Menschen, die sich in Massen zur »Ankunft seiner Exzellenz« versammelt haben, erscheinen ihr arm und abgerissen, das neugierige Gedränge befremdlich, die Küche von Veracruz hält sie schlicht für »scheußlich«, das schönste Haus ist »natürlich das eines Engländers«, und in ihrem Reisejournal findet sich der später nicht in ihr Buch aufgenommene Eintrag: »Ich glaube nicht, dass es irgendetwas auf der Welt gibt, das mich dazu bewegen könnte, hier zu leben.« Nur wenige Tage darauf heißt es jedoch bereits: »Wie in Dantes Göttlicher Komödie schienen wir dem Paradies – nachdem wir das Purgatorium in Gestalt von Veracruz hinter uns gelassen hatten – stufenweise näherzukommen.« Und als sie am 26. Dezember 1839 das heutige Ciudad de México, »Moctezumas geliebte Stadt«, erreichen, ergriffen vom Mythos und der noch spürbaren Schönheit des alten Tenochtitlán, ist Fanny überwältigt von der Vorstellung des »milden bronzefarbenen Aztekenherrschers, erlesen gekleidet, barfuß, inmitten der Schar seiner Edelleute«, um die spanischen Eroberer – »ungebetene Gäste« – zu empfangen. Schon bald schreibt sie in ihr Journal: »Mir bereitet es hier großes Vergnügen; es gibt so viel zu sehen, und die Leute sind nett und freundlich.« Was sie entdeckt und erlebt, ist interessant, erstaunlich und oft spektakulär.
Fanny hat das Glück, mit Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten in Berührung zu kommen. Durch Calderón verkehrt sie auf Regierungs- und Diplomatenebene und lernt die spanische wie mexikanische High Society kennen. Ihre Liebe zum Theater, zur Musik und zur Literatur verhilft ihr zu Bekanntschaften mit Dichtern und Schriftstellern. Sie befreundet sich schon früh mit einer alten Dame, »La Güera Rodríguez«, von der man sagt, »dass Humboldt sie als die schönste Frau verehrte, der er auf seinen Reisen je begegnet war«. Neugierig, Einblicke in die katholische Welt zu erhalten, schließt sie Freundschaft mit Ordensschwestern, die ihr den Zugang zu Konventen und die Teilnahme an verstörenden Ritualen und Zeremonien ermöglichen. Sie schaut sich in Kinderkrippen, Gefängnissen und Irrenhäusern um. Interessiert an Erziehungsfragen, vor allem an den Bildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen, besucht sie Schulen und Lehranstalten und befragt dazu ihre spanischen Freundinnen. Dem Leben der Frauen gelten etliche Passagen in ihren Aufzeichnungen, und obwohl sie auch hier weder mit Dünkel noch spitzen Bemerkungen zu Kleidung, Aussehen und dem weiblichen Alltag in Mexiko spart – was ihr nach Erscheinen des Buches einige Kritik eingebracht hat –, kommt sie zu dem Schluss, dass die Europäerinnen und Amerikanerinnen vielleicht attraktiver sein mögen, doch »was die Liebenswürdigkeit und die Wärme im Umgang betrifft, so bin ich bislang noch keiner Frau begegnet, die es hierin mit den Mexikanerinnen aufnehmen kann«.
In Vorbereitung der Reise muss sich Fanny gründlich mit der spanisch-mexikanischen Geschichte beschäftigt haben. Ihre Charakterisierungen der Generäle Santa Anna und Guadalupe Victoria oder des Präsidenten Bustamante, denen sie gleich nach ihrer Ankunft in Mexiko begegnet, zeugen von historisch-politischer Kenntnis, von ihrer präzisen Beobachtungsgabe und ihrem Scharfsinn, der sie hinter die Maske eines Menschen blicken lässt. »Es ist doch seltsam«, beschreibt sie das Zusammentreffen mit dem ebenso angesehenen wie intriganten General Santa Anna, »wie häufig sich der Ausdruck philosophischen Verzichts und gelassener Schwermut gerade in der Miene der ambitioniertesten und ränkevollsten Männer findet«. Sie hat wohl in Humboldts landeskundlichen Werken nachgeschlagen, um die mexikanische Landschaft, die sie leidenschaftlich und am liebsten zu Pferd erkundet, die Vielfalt ihrer Fauna und Flora und ihre mineralische Beschaffenheit so anschaulich und korrekt wie möglich darstellen zu können. Deutlich tritt ihr Ansatz zutage, mit durchaus didaktischer Ambition den Dingen auf den Grund zu gehen – deutlich wird aber auch ihre unbändige Lust, Geschichten zu erzählen, Anekdoten einzuflechten und szenische Dialoge zu schreiben. Calderóns Mission hält sie nicht davon ab, als Schottin den Spaniern mitunter kritisch gegenüberzustehen und sie mit dem »unwürdigen Leben« der indianischen Bevölkerung zu konfrontieren.
Die Spannungen innerhalb der mexikanischen Gesellschaft – hervorgerufen durch den zwischen 1810 und 1824 geführten Unabhängigkeitskampf, den letzten Versuch der Spanier, Mexiko 1829 zurückzuerobern, die erst Jahre später erfolgte politische Anerkennung der Mexikanischen Republik, die bereits am 4. Oktober 1824 ausgerufen worden war, die disparaten Programme und die Machtkämpfe innerhalb der kurzlebigen, instabilen Regierungen – entladen sich auch während der beiden Jahre, in denen sich Fanny in Mexiko aufhält. Sie ist Zeugin zweier Revolten, Stürme, »die sich seit geraumer Zeit zusammengebraut haben«. Zum ersten Putsch kommt es zwischen dem 15. und 27. Juli 1840 seitens der Föderalisten gegenüber der zentralistischen Regierung von Präsident Bustamante: »Sie haben das Feuer eröffnet! Leute hasten die Straße herauf, die Indianer eilen zurück in ihre Dörfer … Nun beginnt das Dröhnen der Kanonen … Die Sturmglocken läuten. Es scheint ernst zu werden.« Da die Zeitungen ihre Berichterstattung zum Teil aussetzen, sind Fannys Tagebücher, in denen sie unter anderem die Forderungen der Aufständischen und den Gegenkatalog der Regierung dokumentiert, von historischem Wert. Sie verweisen ebenso auf die Ränke hinter den Ansprüchen beider Parteien wie auf die Intrigen einzelner Generäle – allen voran Santa Anna. Gómez Farías, der Anführer des Putsches, »ein angesehener Mann aus Guadalajara«, hat, wie Fanny bitter bemerkt, »trotz seines erklärten Abscheus vor Bürgerkrieg und Blutvergießen … einen grausamen Kampf im Herzen einer bevölkerungsreichen Stadt« angezettelt. Präsident Bustamante und seinem General Valencia gelingt es, »die rebellischen Truppen unter gewissen Bedingungen« zum Niederlegen der Waffen zu bewegen. General Valencia erhält vom Präsidenten das »Schwert der Ehre«. Ironischerweise ist er es, der sich nur ein Jahr später, am 31. August 1841, in einem neuen Pronunciamiento gegen Bustamante wendet. Die Kämpfe ziehen sich diesmal bis in den Oktober hin. Santa Anna, der verkündete, sich nicht einmischen zu wollen, »es sei denn, der Staat braucht mich«, wird als Sieger aus dem Chaos hervorgehen und sich für die nächste Zeit als unumschränkt herrschenden Präsidenten einsetzen. Fanny listet die Revolten und Umstürze der bewegten jüngeren Geschichte Mexikos noch einmal auf und zitiert die Worte des mexikanischen Historikers Zavala, dass es »ganz einfach ist, ein Land in Schutt und Asche zu legen, wenn Uneinigkeit herrscht, doch die Schwierigkeiten, es wieder aufzubauen, sind unermesslich«.
Bevor sie am 8. Januar 1842 in Veracruz ablegen, notiert Fanny: »Ich stelle eine wesentliche Änderung in meinem Geschmack und auch in meiner Meinung fest. Die Küche von Veracruz, die ich vor zwei Jahren widerwärtig fand, erscheint mir jetzt ausgezeichnet. Welch köstlicher Fisch! Wie unvergleichlich die gebackenen Bohnen! Gut, das mag eine Kleinigkeit sein. Doch Kleinigkeiten oder Dinge von Belang: Für einen Reisenden ist es wichtig, seine zu unterschiedlichen Zeiten gefällten Urteile zu überprüfen, sie zu vergleichen und auch zu korrigieren!« Und an Prescott schreibt sie später aus Havanna, dass sie Mexiko nur »mit dem größten Bedauern« verlassen hat.
Vier Monate nach ihrer Rückkehr nach Staten Island legt Fanny eine erste Fassung von »Life in Mexico« vor. Am 31. August schreibt Prescott an Charles Dickens und bittet ihn um Hilfe, einen englischen Verlag für das Buch zu finden. Wie Marion und Howard T. Fisher bemerken, muss ein amerikanischer Verleger schon zugesagt haben: das Bostoner Verlagshaus Little, Brown and Company. Calderón besteht auf Fannys Anonymität als Autorin. Als sie das Manuskript am 12. Dezember – dem Tag der Virgen de Guadalupe, der Schutzheiligen von Mexiko – abgibt, wird die Verfasserin als Mme. C _______ de la B ______ ausgewiesen: nichts hätte ihre Identität kenntlicher machen können. Bereits am 15. Dezember sendet Prescott Andrucke an Dickens, und noch vor Ende des Jahres 1842 ist »Life in Mexico« vorab in den Bostoner Buchhandlungen erhältlich. In England erscheint es 1843 im Londoner Verlag Chapman & Hall. Prescotts Vorwort endet mit den Worten: »Da es mir leid täte, wenn solch lehrreiche und unterhaltsame Geschichten den Augen weniger Freunde vorbehalten blieben, habe ich dringend geraten, sie in die Welt zu tragen. Das ist hiermit geschehen.«
Wie sie es vorausgesehen hatten, wurde Calderón nach Madrid zurückbeordert. Am 16. Mai 1843 verließen er und Fanny die Vereinigten Staaten. Die politische Lage in Spanien war äußerst labil, Calderóns Position auch, obwohl er zeitlebens in der Gunst der Regentin Maria Cristina stand. Von 1844 bis 1853 wurde er erneut in die USA gesandt, als spanischer Botschafter in Washington. Zum ersten Mal seit beider Heirat schien Calderón als Diplomat wirklichen Erfolg zu haben und ein entsprechendes Gehalt zu beziehen. 1847 ernannte man ihn zum »Senator von Spanien« – eine Lebensstellung. Dennoch standen ihm und Fanny nach ihrer Rückkehr nach Spanien im September 1853 erneut unsichere und aufreibende Jahre bevor. Am 31. Mai 1861 starb Calderón in San Sebastián. Im Sommer erhielt Fanny zu ihrer Verwunderung eine Botschaft der Spanischen Königin mit der Bitte, die Erziehung der neunjährigen Infantin Isabel zu übernehmen. Mit siebenundfünfzig Jahren kehrte Fanny zu dem Beruf der Lehrerin zurück, den sie bei ihrer Heirat aufgegeben hatte, und bezog Räume im Königspalast von Madrid. Am 18. September 1876 wurde ihr im Andenken an Calderón, doch ebenso ihrer eigenen Verdienste wegen, der Titel Marquesa de Calderón de la Barca verliehen. Fanny starb in Madrid am 6. Februar 1882.
Klaudia Ruschkowski
Literatur
Marion Hall Fisher and Howard T. Fisher, edited by Alan H. Fisher, »Frances Calderón de la Barca née Frances Erskine Inglis, A biography of the author of Life in Mexico and The Attaché in Madrid«, Xlibris, USA 2016
1. BRIEF
VON NEW YORK NACH HAVANNA
Abfahrt der »Norma« – Letzter Blick auf die Bucht von New York – Ungünstige Winde – Sonnenuntergang in südlichen Breiten – Kolumbus – Beschäftigung an Bord – Berry Islands – Bahama Banks – Abend auf tropischer See – Pan de Matanzas – Castillo del Morro – Bucht von Havanna – Ankunft – Ein stattliches Haus
PAKETSCHIFF »NORMA«, 27. OKTOBER 1839
Heute Morgen um zehn Uhr bestiegen wir den Dampfer »Herkules«, der uns zu dem Paketschiff mit dem klingenden Namen »Norma« bringen sollte. Der Tag war neblig und bewölkt, als lehnte er es ab, getröstet zu werden. Selbst ein gelegentliches Lächeln der Sonne konnte ihn nicht erheitern. Alle prophezeiten, dass die »Norma« heute nicht ablegen werde, doch wo ein Wille ist … Unsere Freunde begleiteten uns zum Kai; der russische Gesandte, der Gesandte von Buenos Aires, der sich angestrengt bemühte, Gefühl zu zeigen, und erstaunlicherweise sogar Tränen hervorzauberte, und etliche andere Menschen, von denen der Abschied uns wahrhaft schwerfiel.
Die »Norma« ankerte an einer der schönsten Stellen der Bucht. Der Lotse schleppte sie von dort aus noch fünf Meilen weit, bis wir die Meerenge passiert hatten. Der Wind war unbeständig, doch der Tag klarte allmählich auf, und die Sonne durchdrang die wässrigen Wolken.
Dennoch: Nichts ist so traurig wie ein Blick zurück. Es ist, als sähe man die Zeit vergehen. Als wir New York verließen, nahmen wir die Schönheiten der Bucht wie durch einen Schleier wahr. Die Küsten, bis ans Wasser von Bäumen in allen Farben des Herbstes gesäumt, die weißen Häuser auf Staten Island – alles verblasste allmählich und schwand wie ein Traum dahin.
Der Lotse hat uns verlassen. Unsere letzte Verbindung zum Festland ist gekappt. Noch sehen wir die Berge von Never-Sink und den Leuchtturm von Sandy Hook. Die Sonne geht unter, und in wenigen Augenblicken müssen wir wohl für Jahre von lang vertrauten Orten Abschied nehmen.
28. OKTOBER
Als ich sagte, dass ich am Leben auf dem Meer Gefallen fände, meinte ich damit nicht dieses Handelsschiff mit seiner stickigen Kabine und den vielen unangenehmen Gerüchen. Wie eine mitreisende Französin mit dem Gehabe eines leidenden Schweinswals salopp bemerkte: »Hier stinkt alles, selbst das Eau-de-cologne.«
Der Wind ist immer noch launisch. Die »Norma« schlingert und kommt schlecht voran. Wir hätten bereits vierundsiebzig Meilen zurücklegen sollen, haben jedoch nur vierzig geschafft. Da heute jeder krank ist, bleibt das Deck die meiste Zeit über verwaist. Das Interessanteste, was ich bislang an Bord entdecken konnte, ist ein hübsches, kleines, taubstummes Mädchen, sehr lebendig und mit einem intelligenten Gesicht, das mir beigebracht hat, mit den Fingern zu sprechen. Ein winziger Erbe aus gutem Hause beweist seine Manieren, indem er den ganzen Tag über schreit. Monsieur B., bleich, ungepflegt und mit der Attitude eines beschäftigungslosen Straßenräubers, überquert das Deck unsicheren Schritts. Unter seinem vogelnestartigen Schnurrbart ragt eine Zigarre hervor, was an eine Feuerstelle in einem verwilderten Wald erinnert, oder an ein Irrlicht in sumpfigem Dickicht. Ein dicker Spanier hält einen Vortrag zum Ruhm der Olla podrida, des beliebten kastilischen Eintopfs. Im Übrigen setzen wir unseren Weg bedächtig fort und werden Kuba bei dieser Geschwindigkeit in drei Monaten erreichen.
31. OKTOBER
Der Tag begann mit einem zornigen Disput zwischen zwei der mitreisenden Herren über die kubanischen Lotterien. Es endete damit, dass sie einander mit Schimpfwörtern überschütteten, die – so berechtigt sie auch sein mochten – überaus heftig ausfielen. Zur Mittagszeit waren sie jedoch bereits wieder freundschaftlich darin vereint, eine riesige Schüssel Gazpacho zuzubereiten, eine dicke Suppe aus Brot, Öl, Essig, in Scheiben geschnittenen Zwiebeln und Knoblauch – und der beleibtere von ihnen erklärte, dass ihm ein Teller Gazpacho mit viel, viel Knoblauch darin helfe, sich bei warmem Wetter frisch wie eine Rose zu fühlen. Er muss ein herrliches Bukett abgeben.
In unserem engen Kabinentrakt geht es morgens dramatisch zu. Nach und nach heben etwa zwanzig Stimmen in Spanisch, Deutsch, Italienisch und einem gebrochenen Englisch an. Aus der benachbarten Suite steckt Nid d’oiseau, das Vogelnest, seinen Kopf: »Stooar! a toomlar!« »Werkzeug! here is no vater!« »Comin, sir, comin.« »Caramba! Stooard!« »Comin, sir, comin!« »Stuart? vasser und toel!« »Here, sir, das Handtuch.« »Amigo! Wie steht der Wind?« Mit dieser Frage erwacht der Señor Ministro, der seinen Kopf halb erstickt aus der Koje steckt. »Oh steward! Steward!« »Yes, Miss.« »Come here, and look at this!« »I’ll fix it, Miss, ich bringe das in Ordnung«, und so fort.
1. NOVEMBER
Erfrischender Wind nach einer schwülen Nacht, und die erfreuliche Hoffnung, am Sonntag die Bahamas zu sehen. Nach und nach tauchen die meisten Passagiere bleich aus den unteren Regionen auf und schleppen sich leidvoll an Deck. Madame A. hat dennoch eine so süßtönende Stimme, vor allem durch den Akzent ihres Bella Italia, es ist erfrischend, ihr zuzuhören. Ich verbrachte den Tag damit, abwechselnd Casimir Delavignes »Les Enfants d’Edouard«1, D’Israelis »Curiosities of Literature«2 und Notizen von Washington Irving3 zu lesen. Auffällig ist, dass ich bei dem passablen Angebot an englischen und französischen Büchern hier an Bord nur ein oder zwei ausgefallene spanische Titel entdecke, obwohl diese Paketschiffe doch ständig von spanischsprechenden Menschen frequentiert werden. Liegt es daran, dass sie keinen Wert auf Literatur legen, oder wird ihnen weniger Aufmerksamkeit zuteil, als den französischen oder amerikanischen Passagieren? Man sollte annehmen, dass es wichtiger wäre, anstelle der banalen Romane Literatur von Cervantes, Lope de Vega, Calderón oder Moratín4 anzubieten.
3. NOVEMBER
Gestern wehte der Wind so lieblich wie an einem Sommermorgen. Ein Landvogel verirrte sich auf das Schiff. Heute hat die Brise gedreht, doch es bleibt weiterhin angenehm. Das Meer ist von einem Schwarm winziger Fliegender Fische übersät. Ein schüchterner Tornado zog heran und starb noch während seiner Geburt. Der Konsul schwärmte von der angenehmen Gesellschaft auf den Sandwichinseln! Dann ein herrlicher Sonnenuntergang, dessen Anblick für die Unannehmlichkeiten der Reise entschädigte. Über den Himmel zogen schwarze, mit Silberrand gesäumte Wolken, umgeben von den verschiedensten farblichen Schattierungen: dunkelblau, milchweiß, zartrosa, violett und orange. Die Abendschatten verdichteten sich. Kurz darauf war der tropische Nachthimmel mit funkelnden Sternen besetzt. Sternschnuppen schossen wie Lichtboten durch die tiefblaue Weite, blitzten kurz auf und verloschen.
Es empfiehlt sich, Kolumbus’ Geschichte auf See zu lesen, vor allem aber in diesen Gewässern, die er in ungewisser Erwartung, doch festem Glauben durchquerte, und auf die Erscheinungen zu achten, an denen sich die Seeleute in diesen Breiten orientieren: das Aufkommen und Abflauen der Brise, die Tönung des Himmels, die Helligkeit und Anzahl der Sterne, die Algen, die es mit dem Wind auf den Golf zutreibt, die kleinen Landvögel, die als Vorboten guter Nachrichten gelten, die Sternschnuppen und das Auftauchen Fliegender Fische. Die Phantasie versetzt uns zurück in ein Jahrhundert, das sich kühn abhebt von anderen, nicht so ereignisreichen Zeitaltern. Wie in einer Vision erscheint uns der Entdecker der Welt an Bord seiner Karavelle, die durch unbekannte und geheimnisvolle Wasserwüsten gleitet, sein wachsames Auge gen Westen gerichtet.
7. NOVEMBER
Heute Morgen wurde die Eintönigkeit von einer herzhaften Sturmbö unterbrochen, begleitet von Sturzregen, heftigem Donner und verästelten Blitzen. Das Schiff taumelte wie ein Betrunkener, und die Passagiere vollführten unfreiwillig die seltsamsten Bewegungen, schlitterten über das Deck, drehten sich im Kreis und fielen um, als stieße Oberons magisches Horn im Herzen der tosenden Winde einen einzigen lauten Ton aus – während die Stewards heiter inmitten von Scherben und herabfallenden Tellern umherspazierten. Vertrieben von unserer Hochburg auf Deck, willkürlich im Schiffsbauch zusammengestopft wie Feigen in einem Fass, das – um mit Carlyle zu sprechen – »hin und her rollt wie ein ägyptischer Krug mit zahmen Vipern«5, die Kabinenfenster verriegelt, bemühten wir uns, es trotz der erdrückenden Hitze mit kühler Gelassenheit zu nehmen.
9. NOVEMBER
An diesem Morgen kam Land in Sicht: ein langgestreckter niedriger Bergzug auf der Insel Eleuthera6. Dort, heißt es, wird Salz gefördert, vor allem von Schwarzen. Nichts von beidem war für das bloße Auge erkennbar, nichts als die grauen Konturen der Hügel, die mit Meer und Himmel verschmolzen. Nachdem wir den ganzen Tag umhergekreuzt waren, fanden wir uns abends genau gegenüber derselben Insel wieder. Es war ein schwacher Trost, dass ein paar Passagiere versicherten, sie seien sechsunddreißig Tage lang zwischen New York und Kuba, »la joya mas preciosa de la corona de España« – dem »kostbarsten Juwel der spanischen Krone« – unterwegs gewesen.
Ich für meinen Teil empfinde keine Ungeduld, eher die Abneigung, meine Position, sofern sie erträglich ist, unnötig zu verändern. Die Luft ist so frisch und balsamisch, sie scheint aus einem Paradies, aus einem Land voll duftender Gewürze zu uns herüberzuwehen. Das Meer sieht aus wie ein Spiegel, und ich habe zum ersten Mal Marryats »Pirat«7 gelesen.
10. NOVEMBER
Ein Sonntag auf See. Wir nähern uns den Berry Islands8, unfruchtbar und felsig, wie die Geographiebücher vermerken. Eine dieser Inseln gehört einem farbigen Mann, der sie für fünfzig Dollar gekauft haben soll – eine preiswert erworbene Hoheitsgewalt. Dort leben er, seine Frau und seine Kinder mit ihren schwarzen Sklaven! und bauen Gemüse an, das direkt nach New York oder an die vorüberfahrenden Schiffe verkauft wird. Bei günstigerem Wind hätten sie uns gewiss ein Boot mit frischem Gemüse, mit Fisch und Früchten geschickt, was sehr willkommen gewesen wäre. Nicht weit vom Ufer entfernt stoßen wir auf das Wrack eines Zweimasters. Wie traurig ist doch der Anblick »eines stolzen Schiffs, das sicher noble Kreaturen mit sich trug, zerschellt! In Stücke geschlagen!« Einige Geschöpfe Gottes werden unweigerlich bei ihm zurückgeblieben sein. Alles, nur das nicht! Ich bin wie Gonzalo und »wollte lieber eines trocknen Todes sterben«.9
Vor uns liegen die Bahama Banks. Das Wasser dort ist sehr klar und blau, mit cremefarbenem Schaum, als würde es über Perlen und Türkise fließen. Ein englisches Kriegsschiff, ein Man-of-War (von der Größe her eher ein Boy-of-War), näherte sich uns mit vollen Segeln. Seine Besatzung ging wohl davon aus, dass es sich bei unserem Schoner um ein Sklavenschiff handelte. Der Kapitän, der uns durch sein Fernrohr einer Prüfung unterzog, musste jedoch bemerkt haben, dass die Hautfarbe an Bord eher gelblich war als schwarz, denn er ließ von einer Verfolgung ab.
Unser Kapitän verbrachte eine sorgenvolle Nacht, hielt Ausschau nach Lichtern auf den Banks, übernahm dann selbst das Steuer oder ließ die Glocke ertönen: »Denn einige müssen wachen, während andere schlafen; so geht die Welt hinfort.«10
11. NOVEMBER
Den ganzen Morgen über werden wir von einem schönen großen Schiff unter vollen Segeln begleitet, der »Orleans« von Kapitän Sears, unterwegs nach New Orleans. Eine langgedehnte halbkreisförmige Linie schwarzer Felsen kommt in Sicht. Ein paar von ihnen sind rund, und einer sieht aus wie ein Totenkopf; ein anderer, zwei oder drei Meilen lang, besitzt die Form einer Schildkröte. Am äußersten Ende der Felsenkette sind die Engländer damit beschäftigt, einen Leuchtturm zu bauen.
12. NOVEMBER
Wir befinden uns gegenüber dem Pan de Matanzas11, etwa sechzig Meilen vor Havanna. Ungeduld breitet sich aus, doch der Wind schwankt, und wir kommen schlecht voran. Trotz allem beginnt man, sich frisch zu machen; einige rasieren sich, andere tauchen ihre Köpfe in kalte Wasserbecken. So könnte es auf Noahs Arche zugegangen sein, als die Taube nicht zurückkehrte – nach einer vierzigtägigen Seereise bereiten sich die Passagiere auf das Festland vor. Unser Berg Ararat ist das Castillo del Morro12, das am späten Nachmittag dunkel und gespenstisch vor uns auftaucht.
Wie eindrucksvoll ist doch der erste Blick auf diese Festung, wie sie mit ihren Türmen und Wehrmauern von einem Felsmassiv aus in die Höhe strebt. Zugleich – und um uns an die Breiten zu erinnern, in denen wir uns befinden – entdecken wir einige fedrige Kakaobäume, die zwischen dem Unkraut wachsen, das die Ufer überwuchert. Großflächig erstreckt sich gleich neben dem Castillo del Morro eine weitere Bastion, kurz La Cabaña13 genannt, die Hütte. Ihre Basteien sind weiß gekalkt, sie selbst schimmert in zartem Rosarot.
HAVANNA, 13. NOVEMBER
Als wir am gestrigen Abend in die schöne Bucht einfuhren, kam uns alles sehr fremd und pittoresk vor. Die Soldaten der Garnison und das von General Tacón14 errichtete Gefängnis; die so unterschiedlich gestalteten Häuser mit ihren rot oder hellblau gestrichenen Fassaden, die einen ebenso freundlichen wie unbewohnten Eindruck machen, da die Fenster keine Glasscheiben besitzen; die großen Fregatten und die Frachter; Schiffe aus jedem erdenklichen Hafen der Handelswelt; kleine Boote mit schneeweißen Segeln, die zwischen ihnen dahingleiten; auf dem Anleger Schwarze – nichts Europäisches. Es herrschte eine Hitze wie an einem Julitag; die Luft stand still.
Je näher wir der Landestelle kamen, umso mehr nahmen Lärm und Geschäftigkeit zu. Die Passagiere drängten sich an Deck, um nichts zu verpassen. Wir lagen kaum vor Anker, als auch schon verschiedene kleine Boote in Sicht kamen, die auf die »Norma« zusteuerten. Im ersten saß ein Offizier, der Grüße des Generalkapitäns seiner Exzellenz überbrachte, verbunden mit dem höflichen Angebot, uns in allem, aber auch allem zu Diensten zu stehen. An Bord des zweiten befand sich der Verwalter des Stadtkommandanten, der uns mit denselben Höflichkeiten bedachte; im dritten der Herr des Hauses, in dem wir uns gerade aufhalten; im vierten die Italienische Oper, die sogleich in die Arme unserer reizenden Madame A. sank; im fünften prosaische Zollbeamte; im sechsten ein Graf und ein Marquis aus Havanna; im siebten die Familie von General M. Wir wurden über die Reling in einen Stuhl gehoben, auf diesem in das Boot der Regierung befördert, und an Land gerudert.
Da es bei unserem Eintreffen schon fast dunkel war, fuhren wir in einer Volante, der in Kuba üblichen Kutsche, zu unserem Ziel, so dass wir von der Stadt nicht viel zu sehen bekamen. Wir bemerkten nur, dass die Gassen eng, die Häuser abwechslungsreich und die meisten Menschen dunkelhäutig waren. Die Volante, ein seltsames Gefährt, das von hinten wie ein schwarzes Insekt mit hochgezogenen Schultern aussieht, wurde von einem kleinen schwarzen Postillion begleitet, der auf einem Pferd oder Maulesel saß und in enormen Stiefeln und einer extravaganten Uniform steckte.
Von den Fenstern des Hauses, in dem wir dank der Gastfreundschaft einer Familie aus Havanna untergebracht sind, hat man den denkbar abwechslungsreichsten Blick und das gesamte Treiben in der Bucht vor Augen. Da es sich um das erste Haus spanischer Art handelt, das ich bislang betreten habe, will ich es hier beschreiben. Es ist als großes Geviert angelegt, und man betritt es über den Hof, in dem die Volantes stehen. Die Lager und Geschäftsräume, die Kammern für die Schwarzen, der Kohlespeicher, die Badestube etc. gehen alle vom Hof ab. Über eine Treppe erreicht man eine breite Galerie, die um das ganze Haus herumführt. Von dort aus gelangt man in die Sala, einen großen kühlen Raum mit Marmorboden, in dem sich Tische, Chaiselongues und Sessel befinden. Ein Vorhang aus weißem Musselin und blauer Seide trennt die Sala von einem kleineren Salon, der mir nun als Ankleidezimmer dient. Er ist herrlich ausgestattet mit einem gotischen Toilettentisch, einem mit Mahagoniintarsien versehenen Sekretär, einem Marmortisch und einem ebenfalls aus Marmor gearbeiteten Beistelltischchen, dazu schöne Spiegel, Rohrmöbel und eine grüngoldene Tapete. Hinter einem weiteren Vorhang aus weißem Musselin und rosafarbener Seide befindet sich ein sehr elegant eingerichtetes Schlafzimmer: französische Betten mit seidenen Decken und durchsichtigen, mit zarter Spitze besetzten Moskitonetzen. Der fensterlose Schlafraum wird auf der einen Seite durch eine Portiere von der Galerie getrennt, auf der anderen öffnet er sich zu weiteren hintereinanderliegenden Räumen hin. Die Fußböden bestehen aus Marmor oder Gips, die hölzernen Dachbalken sind hellblau gestrichen. Alles ist angenehm kühl. Die hohen Fenster der Salons werden abends mit grünen Läden verschlossen.
Die Moskitos stimmen ihr Nachtlied an, das Zeichen, die Lichter zu löschen. Der Mond scheint auf die Bucht, von fern erklingt Militärmusik, und das Meer rauscht in elegischer Monotonie.
1Der französische Dichter Casimir Delavigne (1793–1843) schrieb 1833 das Trauerspiel in drei Aufzügen »König Eduards Söhne«.
2Zu den bekanntesten Werken des britischen Schriftstellers und Literaturhistorikers Isaac D’Israeli (1766–1848) zählt seine zwischen 1791 und 1824 entstandene Essaysammlung »Curiosities of Literature«: Anekdoten über berühmte Persönlichkeiten und Büchersammler.
3Washington Irving (1783–1859), ein New Yorker Schriftsteller, Historiker und Biograph englischer und schottischer Abstammung.
4Miguel de Cervantes (1547–1616), Autor des »Don Quijote«; Lope de Vega (1562–1635), Pedro Calderón de la Barca (1600–1681), Leandro Fernández de Moratín (1760–1828) – bedeutende spanische Dichter und Dramatiker.
5Thomas Carlyle (1795–1881), Zitat aus der Novelle »Sartor resartus« (1836).
6Eine ca. hundertachtzig Kilometer lange, an manchen Stellen jedoch kaum tausend Meter breite Insel der Bahamas.
7Der englische Marineoffizier und Schriftsteller Frederick Marryat (1792–1848) verfasste zahlreiche Seeromane, darunter »The Pirate« (1836).
8Ein zu den Bahamas gehöriges Archipel.
9William Shakespeare (1564–1616), »Der Sturm«, 2. Akt, Szene 1 / 1. Akt, Szene 1
10William Shakespeare, »Hamlet«, 3. Akt, Szene 2
11Ein niedriger Höhenzug im Rücken der nur drei Meter über dem Meeresspiegel gelegenen kubanischen Stadt Matanzas.
12Das Castillo de los Tres Reyes del Morro, benannt nach den Heiligen Drei Königen, ist eine von der spanischen Kolonialmacht ab 1589 errichtete Festungsanlage in Havanna.
13Die Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, ein zwischen 1763 und 1774 von den Spaniern erbauter weitläufiger Festungskomplex, liegt am Ostufer der Einfahrt in die Bucht von Havanna.
14Miguel Tacón y Rosique (1775–1855), von 1834 bis 1838 spanischer Gouverneur von Kuba.
2. BRIEF
HAVANNA
Havannas Aristokratie – »Lucia di Lammermoor« – La Rossi und Montresor – Abendessen – Südwinde – San Cristóbal – Messe – Geburtstag der spanischen Königin – Eisenbahn – Heilung durch Blitzschlag – Geschäfte – Ball im Haus einer Gräfin
15. NOVEMBER 1839
Wir hatten uns auf Gastfreundschaft und einen liebenswürdigen Empfang eingestellt, doch unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen. Die letzten Tage vergingen wie im Flug, mit so vielen Festlichkeiten, dass nicht ein Augenblick zum Schreiben blieb. In unserem vorübergehenden Zuhause treffen sich alle, die in Havanna Rang und Namen haben. Mit Kreuzen und Sternen geschmückte Generäle, Grafen und Marquis gehen seit unserer Ankunft ein und aus. Ich wage noch nicht, Havanna zu beurteilen. Wir haben es bisher ausschließlich en beau gesehen, von seiner schönen Seite.
Gestern Abend fanden wir Zeit für einen Theaterbesuch. Gegeben wurde »Lucia di Lammermoor«. Die Primadonna, Teresa Rossi, hat eine süßtönende Stimme, singt fehlerlos und geschmackvoll, bewegt sich graziös, ist aber leider nicht kraftvoll genug. Dennoch erfüllte sie die Rolle und entsprach meiner Vorstellung von der armen Lucia, hingebungsvoll und mit gebrochenem Herzen, physisch und moralisch schwach. Wie anmutig ist doch die Musik, wie betörend und melodisch – wenngleich die Geschichte verändert wurde und das Interesse an ihr im Laufe des Abends abflaute. Das Orchester spielte gut. Es besteht aus Schwarzen und Weißen, die wie die Tasten des Klaviers in harmonischem Miteinander vereint sind. Das Theater ist ungewöhnlich hübsch und luftig. In seinen rotledernen Sesseln saßen nur gutgekleidete Menschen.
Zu Ende des zweiten Aktes wurde Lucia unpässlich, ihre letzte Arie blieb aus, und ohne weitere Umstände fuhr man ein Standbild auf die Bühne. Giovanni Battista Montresor, der Ravenswood, trat auf, sang und erdolchte sich mit enormem Enthusiasmus. Schade nur, dass ihn die Stimme immer wieder zu verlassen drohte, während über Stil und Gefühl nicht zu klagen war. Wir verließen das Theater durch ein Spalier von Soldaten. Der unvermittelte Übergang vom »Yankee-Land« zu diesem vom Militär beherrschten spanischen »Neger-Land« hatte etwas Unwirkliches. Zum Abendessen bereitete man uns ein wunderbares Fest. Nach dem Kaffee erhob sich der Hausherr und verfasste, zu Calderón gewandt, aus dem Stegreif ein Gedicht, in dem er an Esparteros15 jüngsten Sieg erinnerte und Calderón zu seiner Entsendung in die mexikanische Republik beglückwünschte. Dann traten wir hinaus auf den Balkon. Ein kühler Abendwind war aufgekommen und die Luft köstlich. Ein großes Schiff unter vollen Segeln und einige Dreimaster passierten das Castillo del Morro, auf dessen Mauern barfüßige schwarze Träger diverses Packgut hin- und hertransportierten. Volantes fuhren vorbei, in denen Herren in Galakleidung saßen und schwarzäugige Damen mit kurzen Ärmeln und Blumen im Haar. Schön uniformierte und kriegerisch aussehende spanische Soldaten marschierten vorüber und bedachten die Damen mit allerlei freizügigen Bemerkungen.
17. NOVEMBER
Gestern gab man uns Gelegenheit, die Prozession für San Cristóbal, den Schutzheiligen der Stadt, von den Balkonen der Intendantur aus zu verfolgen – ein großzügiges Gebäude, das ebenso wie der Palast des Generalkapitäns an der Plaza de Armas liegt. Auf dem Platz, einem der ältesten und schönsten der Stadt, drängten sich dunkelhäutige Männer und Frauen, alle weiß gekleidet, was ihre Hautfarbe noch betonte. Zwei Regimenter, zu denen auch ausgezeichnete Musiker gehörten, führten die aus Mönchen und Priestern bestehende Prozession an. Eine große Figur von San Cristóbal, stämmig, mit vergoldeten Beinen, umgeben von goldenen Engeln mit ebensolchen Flügeln, wurde zur Melodie von Bellinis »Suoni la tromba« –, zu der sie den Text einer Hymne auf die Freiheit sangen, vorübergetragen.
Am Vormittag hatten wir an der Messe teilgenommen und uns, wie es Brauch ist, von einem kleinen schwarzen Lakai in die Kirche geleiten lassen. Die dunklen Gesichter der schwarzen Frauen in ihren weißen Mantillas, ihren weißseidenen Schuhen; die schwarzen Seidenkleider und die aus schwarzen Spitzen gefertigten Mantillas der weißhäutigen und schwarzäugigen Damen von Havanna, hinter denen kleine dunkle Bedienstete in Livree in Stellung standen; die Offiziere, die Musik und die langbärtigen Priester – all dies machte großen Eindruck auf uns. Bei meiner Rückkehr fand ich eine ausgezeichnete Harfe von Érard vor, die mir im Namen der Marquise von A., einem weiblichen Krösus, gesandt worden war.
20. NOVEMBER
Anlässlich des Geburtstags der spanischen Königin wurde gestern in der Intendantur ein sehr elegantes Diner für uns gegeben. Den Nachtisch, wie immer eine abwechslungsreiche Fülle an Köstlichkeiten, hatte man in einem besonderen Raum angerichtet. Die Sonne ging gerade unter und einer der Herren schlug vor, auf die Gesundheit der Königin zu trinken. Der Zeitpunkt war geschickt gewählt: Kaum dass der herzlich und mit wahrem Gefühl vorgebrachte Toast beendet war, schossen sämtliche Kanonen des Forts Salut. Nach spanischem Brauch duzt sich der Adel zumeist und nennt sich beim Vornamen; fast alle sind hier durch Heirat miteinander verbunden. Einen höheren Rang erkennt man ausschließlich an dem gesteigerten Respekt, den man ihm entgegen bringt.
23. NOVEMBER
Besuche, Abendessen und Feste haben unsere Zeit so in Anspruch genommen, dass wir vom Land recht wenig gesehen und die Menschen nur in Galakleidung kennengelernt haben, was keine Hilfe ist, wenn man sie aufrichtig beurteilen will. Einen Vormittag widmeten wir jedoch der Arbeit des Stadtkommandanten und besichtigten mit ihm und einer Gruppe von Freunden die Eisenbahn und die Wasserfilter. Das Land, das von der Eisenbahn durchquert wird, ist zum größten Teil flach. Die Vielzahl wilder Blumen, die bei genauerer Betrachtung vor allem zur Spezies der Winden zu gehören scheinen, die Orangenbäume, die Palmenhaine und Kakaopflanzen, die Bananenstauden mit ihren riesigen Blättern, die leuchtend grüne Kaffeepflanze, die Zuckerrohrfelder mit ihrem noch helleren Grün, die nur spärlich bekleideten Schwarzen, die geduckten Holzhütten und die selbst im November glühend heiße Sonne – alles war neu für uns und brachte uns die vielen Meilen zu Bewusstsein, die wir bereits zurückgelegt hatten.
In einem Dorf, wo wir eine Pause einlegten, lauschten wir mit großem Vergnügen der Erzählung eines dicken, gemütlichen Mannes, der auf folgende Weise von einer schweren Krankheit geheilt worden war: Er befand sich im letzten Stadium des Siechtums, als er an einem heißen Julitag von einem Blitz getroffen wurde, einem Feuerball, der seitlich in ihn eindrang, seinen gesamten Körper durchfuhr und durch den Arm wieder austrat. An ebendieser Stelle bildete sich ein großes Geschwür. Als es aufbrach und abheilte, fand er sich bei bester Gesundheit – und ist es bis heute geblieben!
Natürlich konnte ich Havanna nicht verlassen, ohne einen Vormittag mit Einkäufen zu verbringen. Die Geschäfte haben die verführerischsten Namen: Hoffnung, Wunder, Sehnsucht … Die französischen Modisten scheinen einiges an Zeit darauf zu verwenden, um ihre Waren mit gesalzenen Preisen zu versehen. Da es nicht üblich ist, dass die Damen die Läden betreten, bringen die Verkäufer ihre Waren direkt zu den Volantes. Als Ausländerin gestattete ich mir das Privileg, diese Regel ausnahmsweise zu verletzen. Sehr teure Seiden und Satins, erschwinglichere Spitzen und Musselins – dies war im Großen und Ganzen das Ergebnis meiner Erkundungen; doch da sie nur zwei Stunden in Anspruch nahmen und mein einziger Erwerb aus einer unentbehrlichen Mantilla und einem Paar Ohrringe bestand, kann ich die Situation nur mit einer gewissen Zurückhaltung beurteilen.
An unserem letzten Abend richtete die Gräfin F. einen prachtvollen Ball für uns aus. Ihr Haus stand der ausgesuchten aristokratischen Gesellschaft von Havanna offen. Die Frauen waren mit Diamanten, die Männer mit Orden und Schmuck behängt. Überall sah man prachtvolle Lüster und Spiegel, und auf der Galerie musizierte eine mitreißende Kapelle. Der einzige, der schlicht gekleidet erschien, war der Generalkapitän. Er machte einen sehr angenehmen Eindruck und sprach fließend Französisch. Gegen Morgen bat er uns in eine große Suite im Erdgeschoss, in der eine aus mehreren tausend Bänden bestehende Bibliothek untergebracht ist. Dort wurde in wunderbarem Sèvre-Porzellan Kaffee und auf Goldtellern der köstlichste Kuchen serviert. Wir verließen das Haus zu den Klängen der spanischen Nationalhymne, die einsetzte, als wir die Galerie durchschritten.
Sollte der Nordwind, der gefürchtete »Norte«, ausbleiben, werden wir morgen weitersegeln.
15Baldomero Espartero (1793–1879), spanischer General und Politiker, kämpfte für die Regentin Maria Christina von Bourbon gegen die Carlisten. Am 27. April 1838 schlug er die Truppen des Grafen von Negri, womit die letzte carlistische Offensive beendet war.
3. BRIEF
EIN »NORTE«
Abfahrt auf der »Jason« – Spanischer Kapitän und Offiziere – Leben an Bord eines Kriegsschiffs – Unruhen – Fischfang – »Le Petit Tambour« – Ein »Norte« – Pico de Orizaba – Theorie und Praxis – Gegenwind – »Kleopatra des Ozeans«





























