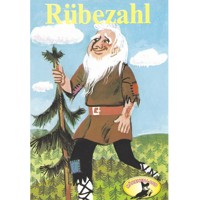Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Sammlung von Märchen (besser: Kunstmärchen), Legenden und Sagen in fünf Bänden, die volkstümliche (aber literarisch vermittelte!) und satirische Elemente miteinander verbindet. Inhalt: Die Bücher der Chronika der drei Schwestern Richilde Rolands Knappen Legenden von Rübezahl Die Nymphe des Brunnens Libussa Der geraubte Schleier Liebestreue Stumme Liebe Ulrich mit dem Bühel Dämon Amor Melechsala Der Schatzgräber Die Entführung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1029
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volksmärchen der Deutschen
Johann Karl August Musäus
Inhalt:
Johann Karl August Musäus – Biografie und Bibliografie
Vorbericht an Herrn David Runkel
Die Bücher der Chronika der drei Schwestern
Richilde
Rolands Knappen
Legenden von Rübezahl
Die Nymphe des Brunnens
Libussa
Der geraubte Schleier
Liebestreue
Stumme Liebe
Ulrich mit dem Bühel
Dämon Amor
Melechsala
Der Schatzgräber
Die Entführung
Volksmärchen der Deutschen, J. Musäus
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632465
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Johann Karl August Musäus – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 29. März 1735 in Jena, gest. 28. Okt. 1787 in Weimar, studierte seit 1754 in Jena Theologie, wurde 1763 Pagenhofmeister am weimarischen Hof, 1770 Professor am dortigen Gymnasium. Seine erste literarische Veröffentlichung war: »Grandison der Zweite« (Eisenach 1760–62, 2 Bde.; später umgearbeitet: »Der deutsche Grandison«, das. 1781–82, 2 Bde.), womit er dem schwärmerisch-sentimentalen Enthusiasmus für den gleichnamigen Roman des Engländers Richardson satirisch entgegenwirken wollte. Dann folgten die gegen Lavater gerichtete Satire »Physiognomische Reisen« (Altenb. 1778–79, 4 Hefte) und die »Volksmärchen der Deutschen« (Gotha 1782–86, 5 Bde., u. ö.; neue Ausg. von M. Müller, Leipz. 1868, 3 Tle.; von Klee, Hamb. 1870), welche die aus dem Volksmund genommenen Märchen- und Sagenstoffe keineswegs in naiv volksmäßiger Gestalt wiedergeben, sie vielmehr in Wielands Manier mit allerlei satirischen Streif- und Schlaglichtern ausstatten, aber dennoch durch joviale Laune, liebenswürdige Schalkhaftigkeit und lebendige Anmut des Vortrags, die aus ihnen spricht, einen eigentümlichen Reiz besitzen. Unter M.' übrigen Schriften sind hervorzuheben: »Freund Heins Erscheinungen in Holbeins Manier« (Winterth. 1785), Darstellungen mehr betrachtender als erzählender Manier, und die Sammlung von Erzählungen: »Straußfedern« (Berl. 1787, Bd. 1). Seine »Nachgelassenen Schriften« wurden mit Charakteristik herausgegeben von seinem Verwandten und Zögling Aug. v. Kotzebue (Leipz. 1791). Vgl. M. Müller, Johann Karl August M. (Jena 1867); Ad. Stern, Beiträge zur Literaturgeschichte (Leipz. 1893); Andrae, Studien zu den. Volksmärchen der Deutschen' von J. K. A. M. (Dissertation, Marburg 1897).
Vorbericht an Herrn David Runkel
Denker und Küster an der St. Sebaldskirche in – meinen sehr werten Freund
Wir Schriftsteller pflegen sonst die Vorreden unsrer Lukubrationen gewöhnlich an den geneigten Leser, oder ans ganze erlauchte Publikum zu adressieren; ich entsage dieser Gewohnheit aus guten Gründen. Zu bescheiden, mir herauszunehmen, das Auge der Leser in den rechten Sehpunkt zu rücken, oder wie viele tun, mit Lorgnette und Brille ihnen entgegen zu laufen; denn das heißt im Grunde doch, sie samt und sonders für Dreischrittseher erklären; zu stolz mein Produkt ihnen anzupreisen, und zu leutescheu das ganze erlauchte Publikum in einer Vorrede anzuschreien, das von den Hausierern, die auf den Märkten ihre Ware ausrufen, ungern Notiz zu nehmen scheint, gedenke ich das lediglich mit Ihm, werter Freund, zu verabhandeln, was ich in Autorangelegenheiten gegenwärtig auf dem Herzen habe.
Gleich beim Uranfang unsrer Bekanntschaft, welche ich, wie ganz Deutschland, Herrn Daniel Chodowiecky verdanke1, ist mir Seine Physiognomie so auffallend gewesen, daß ich von den Talenten Seines Geistes ein sehr günstiges Vorurteil hege. Schlauheit und Spähungsgeist blickt Ihm unverkennbar aus den Augen. Die gewölbte vorstrebende Stirn gleicht einer silbernen Schüssel, in welcher die Hirndrüse, der goldne Apfel des Verstandes für die drei operationes mentis allgnugsam Platz und Raum hat; die aufgestutzte Nase scheint eine der weitriechenden zu sein; die dünnen Lippen und das spitze Kinn – doch beide deuten minder auf Eigenschaften des Geistes als des Herzens: daher enthalte ich mich darüber zu urteilen, und überlasse diese Prüfung Seiner Geliebten und nun vermutbaren Ehekonsortin, welche Er in dem Augenblick unsrer ersten Bekanntschaft mit einem Heuratsantrag unterhielt, wovon zwar kein Wort hörbar, aber doch aus Seiner ganzen Körperform zu urteilen war, daß Er in einem hohen Tenor perorierte, und jedes auf der Waagschale des Verstandes abgewogne Wort, mit großer Bedächtlichkeit und Präzision über die dürren Lippen fallen ließ.
Mit diesen Talenten versehen, ist Er gerade der Mann, den ich wünsche, um mich gegen Ihn, in Betreff des Büchleins, das Er vor Augen sieht, zu expektorieren.
Bei der flüchtigen Übersicht des Titels könnt Ihm, wenn Er ein Küster von gemeinem Schlage, das ist, der gewöhnlichen Menschen einer wär, der schale Gedanke einfallen: wozu dienet dieser Unrat? Märchen sind Possen, erfunden Kinder zu schweigen und einzuschläfern, nicht aber das verständige Publikum damit zu unterhalten. Allein Seine Physiognomie ist mir Bürge, daß es Ihm nicht begegnen kann, ein so mächtig windschiefes Urteil ohne nähere Untersuchung der Sache sich entfallen zu lassen. Er, als ein spekulativer Kopf und Menschenspäher, hat sonder Zweifel längst die Beobachtung gemacht, daß der menschliche Geist in seinem unaufhörlichen Ringen und Streben nach Beschäftigung und Unterhaltung, eben so wenig ein Kostverächter ist, als sein Nachbar und Hausgenoß der Magen nach Nahrung und Speise; daß aber der eine wie der andere zu Zeiten eine Abwechselung begehrt, um Ekel und Überdruß zu vermeiden. Ich trau Ihm so viel literarische Kenntnis zu, daß er weiß, wie die Aktien der dermaligen Modelektüre laufen, welche zur angenehmen Beschäftigung und Unterhaltung des Geistes bestimmt ist; oder wenn Ihm das Amt der Schlüssel an der St. Sebaldskirche, wie das ein sehr möglicher Fall ist, an der Erweiterung Seiner Erkenntnis sollte hinderlich gewesen sein, so will ich Ihm nicht verhalten, daß in dem letzten Jahrzehend die leidige Sentimentalsucht in der modischen Büchermanufaktur dergestalt überhand genommen, daß der Sturm des Herzdranges der deutschen Skribenten mehr empfindsame Schriften ins Publikum gewehet hat, als ehedem der heiße Südwind vom Schilfmeer her Wachteln ins Israelitische Lager warf. Daher denn eben nicht zu verwundern ist, wenn dem deutschen Publikum ebenso, wie vormals dem israelitischen, für der losen Speise ekelt, und ersteres nach den Zeitbedürfnissen zur Unterhaltung, sich nach einer Abwechselung sehnt. Was ist billiger und leichter, als diesen Wunsch zu vergnügen? Meiner unvorgreiflichen Meinung nach wär's wohl Zeit, die Herzgefühle eine Zeitlang ruhen zu lassen, das weinerliche Adagio der Empfindsamkeit zu endigen, und durch die Zauberlatern der Phantasie das ennüyierte Publikum eine Zeitlang mit dem schönen Schattenspiel an der Wand zu unterhalten.
Er würde eine große Ignoranz in der Menschenkunde verraten, mein werter Herr Runkel, wenn Er sich den Zweifel beigehen ließ, ob die Spielwerke der Phantasie dem Geiste auch gnügliche Unterhaltung gewähren, oder mit andern und zweckmäßigern Worten: ob Volksmärchen den empfindsamen Schriften beim lesenden Publikum die Waage halten möchten? das würde beweisen, daß Er noch wenig über die Natur der Seele nachgedacht hätte; die Erfahrung müßte Ihn sonst belehret haben, daß die Phantasie gerade die liebste Gespielin des menschlichen Geistes und die vertrauteste Gesellschafterin durchs Leben sei, von der ersten Entwickelung der Seele aus der kindischen Hülse, bis zum Einschrumpfen der körperlichen Organisation im späten Alter. Das Kind verläßt sein liebes Spielwerk, Puppe, Steckenpferd und Trommel, der wildeste Gassenläufer sitzt still und horchsam, wenn ein Märchen, das ist, eine wunderbare Dichtung seine Phantasie anfacht, hört stundenlang mit gespannter Aufmerksamkeit zu, da er bei der Erzählung wahrer Begebenheiten ermüdet, und sobald es möglich, dem instruktiven Schröckh entläuft. Der Hang zum Wunderbaren und Außerordentlichen liegt so tief in unsrer Seele, daß er sich niemals auswurzeln läßt; die Phantasie, ob sie gleich nur zu den untern Seelenfähigkeiten gehöret, herrscht wie eine hübsche Magd gar oft über den Herrn im Hause über den Verstand. Der menschliche Geist ist also geartet, daß ihm nicht immer an Realitäten genügt; seine grenzenlose Tätigkeit wirkt in das Reich hypothetischer Möglichkeiten hinüber, schifft in der Luft und pflügt im Meere. Was wär das enthusiastische Volk unsrer Denker, Dichter, Schweber, Seher, ohne die glücklichen Einflüsse der Phantasie? Aber auch selbst der kalte Vernünftler gestattet ihr zuweilen ein vertrauliches tête-à-tête, wirft Möglichkeit und Wirklichkeit durcheinander, und bildet sich unterhaltende Träume; oder nutzt die Erfindungen einer fremden Zauberlaterne, um seinen philosophischen Forschungsgeist damit zu nähren. Denn außer Zweifel ist es dem Studium der Menschenkunde angemessen und der Beobachtung eines Denkers anständig, nicht nur zu bemerken, wie Menschen nach ihrer verschiedenen Lage in der wirklichen Welt im Denken und Handeln sich benehmen, sondern auch, wie unsre Väter zu sagen pflegten, zu erlaubter Gemütsergötzung zu erforschen, wie sie in einer idealischen Welt, wenn andre Umstände und Verhältnisse einträten, sich äußern würden.
Hieraus wird Ihm nun wohl, werter Freund, klar einleuchten, daß die Spiele der Phantasie, welche man Märchen nennt, zur Unterhaltung des Geistes allerdings sehr bequem sind, und daß das hochlöbliche Publikum mit dem Tausche, statt des empfindsamen Gewinsels sich mit Volksmärchen amüsieren zu lassen, nichts einbüßen würde. Wenigstens hat bereits die Erfahrung gelehret, daß das italienische Publikum die Volksmärchen des Herrn Carl Gozzi, der ihnen ein dramatisches Gewand gab, sehr günstig aufgenommen. Nun kann es Ihm auch nicht schwer fallen, die allegorische Titelvignette sich zu erklären, welche zu entziffern Er ohne vorgängige Belehrung Seinen spekulativen Kopf vergeblich würde angestrengt haben. Wer sieht nicht, daß der Genius Verstand sich freundlich an die wohlgenährte Nymphe Phantasie anschmiegt, und mit ihr traulich im Gebiete ihrer erträumten Zauberpaläste lustwandelt? Oder mit andern Worten: wer sieht nicht, daß die Phantasie nach der Sitte unsers Zeitalters auch hier mit dem Verstande davonläuft?
Nächst dieser wohlgemeinten Belehrung halt ich noch eine anderweite Zurechtweisung für Ihn nicht überflüssig. Er könnte leicht auf den Irrwahn geraten, der Erzähler dieser Volksmärchen ließe sich beigehen, das Publikum auf einen andern Ton zu stimmen; aber das zu wollen wäre Vermessenheit. Hat doch Klopstock mit all seinem Gewicht und Ansehen nicht vermocht durch seinen publizierten orthographischen Kodex einen einzigen Buchstaben von der Stelle zu rücken, wie könnt ein Skribent ohne Namen sich erdreusten, dem Geschmack des Publikums eine andere Richtung zu geben? Hör Er Freund, wie die Sache stehet.
Viele und zum Teil berühmte Männer, haben das Bedürfnis, der angenehmen Lektüre ein neues Feld zu eröffnen, damit der Leserenthusiasmus nicht erkalte, der die edle Bücherfabrik in Atem erhält, bereits erkannt, und demselben möglichst abzuhelfen sich bestrebt. Der gelehrte Rektor Voß, dessen Name Ihm vermöge des Nexus zwischen Kirch und Schule nicht unbekannt sein kann, ist unter uns zuerst darauf verfallen, das lesende Publikum von der abgenutzten Empfindsamkeit zu den mannichfaltigen Spielen der Phantasie zurückzuführen, und hat rasch die bekannten morgenländischen Erzählungen der Tausend und Einen Nacht ohne Zutat der geringsten Spezerei wieder aufgewärmt. Ob nun gleich diese Olla potrida den Hochgeschmack der Neuheit längst verloren, und solchen in der Vossischen Küche wahrlich! nicht wiedererlangt hat: so beweist doch der schnelle Fortgang des Werkes, daß der Meister Koch richtig kalkuliert und für den Geschmack des Publikums eine interimistische Mahlzeit aufgetischt habe. Zu gleicher Zeit nahm Freund Bürger der Seifensieder2 aus dem nämlichen Bewegungsgrunde dasselbe Pensum in Arbeit, Vorhabens die ganze Masse umzuschmelzen und nach eigner Komposition ein Produkt daraus zu schaffen, das die Erwartung des Publikums nicht würde getäuscht haben. Aber entweder ist ihm das Feuer zu zeitig ausgegangen; oder die Masse hat sich verkocht, ist umgeschlagen, oder noch nicht zu gehöriger Konsistenz gediehen; gnug er hat seine Zusage bis jetzt noch nicht erfüllt. Dem ungeachtet heißt es hier: et voluisse sat est, um das daraus zu folgern, weshalb diese historischen Belege hier angezogen werden.
Kennt Er den Wielandschen Oberon? Ohne Zweifel hat dieses glänzende Meteor auch in dem engbegrenzten Horizont Seiner niedrigen Wohnung hinter dem hohen Schieferdache der St. Sebaldskirche geleuchtet. Nun, was ist denn dies Gedicht anders als ein schön versifiziertes Märchen von achtzehn oder mehr tausend Reimen? Und hat nicht die erhabne Beherrscherin eines Weltteiles, die Früchte einer blühenden Einbildungskraft unlängst zum Nutzen und Vergnügen ihrer thronwürdigen Enkel reifen lassen?
Daß eine solche Konkurrenz mehrer zu einer Klasse gehörigen auffallenden Produkte, in dem Geschmack der Lesebücher aller Wahrscheinlichkeit nach eine Revolution bewirken werde, kann Ihm als einem feinen Denker nicht verborgen sein, und was Er vermöge dieser Belehrung einsieht, das hat der weise Raspe in Nürnberg durch eigne Spekulation bereits seit Jahr und Tag eingesehen, welcher flugs mit einer neuen Auflage der veralteten hölzernen Übersetzung des Kabinetts der Feen von der Madame d'Aunoy in neun Teilen zum Vorschein gekommen ist, ohne zu besorgen, daß ihm die ganze Auflage, oder nur ein Exemplar davon zu Makulatur werde.
Hieraus, werter Freund, wird Er unschwer ermessen, daß der Referent gegenwärtiger Märchen kein ander Verdienst sich zueignen könne als das, in dem wieder neuangebauten Felde der unterhaltenden Lektüre ein eignes Stückgen Acker eingezäunt zu haben, um unter den verschiedenen Gattungen von Märchen, das Volksmärchen, auf dessen Kultur bisher noch kein deutscher Skribent verfallen war, zu bearbeiten. Aber da ist ein böser Nachbar gekommen, welcher, da der neue Pflanzer mit Schippe und Spaten geschäftig war, sich einfallen läßt, gerade neben ihm sich anzusetzen, durch gleiches Beginnen ihm ins Metier zu greifen, und frischweg im Ostermeßkatalog die Früchte seiner Ernte, ohne Mißwachs oder Wetterschlag zu ahnden, auf künftige Herbstmesse anzukündigen3. Um daher seine wohlgegründeten Prioritätsjura zu wahren, und bei Ihm, Herr Patron, nicht in den Verdacht zu geraten, als ob Sein Klient jemands Nachtreter sei, oder auf einen Einfall, der bereits das Eigentum eines andern war, Jagd gemacht zu haben, hat sich dieser zu seiner Legitimation genotdrungen gesehen, zwischen der Meßzeit mit seinem Spizilegium hervorzutreten, und das ist die Ursache, werter Freund, daß Er diese Bogen zu einer Zeit empfängt, wo die Meßprodukte sonst noch nicht zu reifen pflegen. Beiläufig sieht Er hieraus, was die Autorambition für eine zarte empfindsame Pflanze sei, die eine so sorgfältige Prozedur zu erfordern scheinet. Wiewohl es sich begeben kann, daß beide Erzähler sich gar nicht in Weg treten. Denn da der Berliner nur Übersetzungen verheißt, hier aber, wie Er vor Augen sieht, vaterländische Originale aufgetischt werden, so kann es leicht sein, daß der eine von uns eine Stiege Hühner, der andre Gänse zu Markte trägt, die doch nicht einerlei sind, ob sie gleich beide zu der Familie der Haustiere oder des zahmen Geflügels gehören.
Noch find ich, werter Herr Runkel, dies und das in Seinem Kopfe zu berichtigen, ehe wir uns scheiden, um zu verhüten, daß Er, an dessen günstigen Urteil mir alles liegt, diese Probe nicht schief beurteile. Dieser Fingerzeig betrifft Wesen, Form, Ton und Haltung der vorliegenden Erzählungen.
Volksmärchen sind keine Volksromane, oder Erzählungen solcher Begebenheiten, die sich nach dem gemeinen Weltlaufe wirklich haben zutragen können; jene veridealisieren die Welt, und können nur unter gewissen konventuellen Voraussetzungen, welche die Einbildungskraft, solang sie ihrer bedarf, als Wahrheit gelten läßt, sich begeben haben. Ihre Gestalt ist mannichfaltig, je nachdem Zeiten, Sitten, Denkungsart, hauptsächlich Theogenie und Geisterlehre jedes Volkes, auf die Phantasie gewirket hat. Doch dünkt mich, der Nationalcharakter veroffenbare sich darin ebensowohl, als in den mechanischen Kunstwerken jeder Nation. Reichtum an Erfindung, Üppigkeit und Überladung an seltsamen Verzierungen, zeichnet die morgenländischen Stoffe und Erzählungen aus; Flüchtigkeit in der Bearbeitung, Leichtigkeit und Flachheit in der Anlage, die französischen Feereien und Manufakturwaren; Anordnung, und Übereinstimmung und handfeste Komposition, die Gerätschaft der Deutschen und ihrer Dichtungen.
Volksmärchen sind aber auch keine Kindermärchen; denn ein Volk, weiß Er wohl, bestehet nicht aus Kindern, sondern hauptsächlich aus großen Leuten, und im gemeinen Leben pflegt man mit diesen anders zu reden, als mit jenen. Es wär also ein toller Einfall wenn Er meinte, alle Märchen müßten im Kinderton der Märchen meiner Mutter Gans erzählet werden. Ob Er gleich Seinem Amt und Beruf nach mit dem Orgelton nichts zu schaffen hat, wie Ihm im Göttinger Taschenkalender fälschlich beigemessen wird4: so weiß ich doch, daß Er überhaupt viel auf guten Ton hält. Darum merk Er zu beliebiger Notiz, daß ich den Ton der Erzählung, so viel möglich, nach Beschaffenheit der Sache und dem Ohr der Zuhörer, das heißt, einer gemischten Gesellschaft aus groß und klein zu bequemen bemüht gewesen bin. Hab ich's Ihm, werter Herr Runkel, damit zu Danke gemacht, so ist mir's angenehm; wo nicht, so tut mir's leid. Wenn Er sich inzwischen den Erzähler als Komponisten denkt, der eine ländliche Melodie mit Generalbaß und schicklicher Instrumentalbegleitung versieht: so hoff ich wird schon alles recht sein.
Übrigens ist keins dieser Märchen von eigner oder ausländischer Erfindung, sondern, soviel ich weiß, sind sie insgesamt einheimische Produkte, die sich seit mancher Generation, bereits von Urvätern auf Enkel und Nachkommen durch mündliche Tradition fortgepflanzet haben. Im wesentlichen ist daran nichts verändert; sie sind nicht eingeschmolzen, auch nicht umgeprägt wie ehedem die französischen Goldmünzen, auf welchen in einem seltsamen Gemisch, Ludwig des XV. Bildnis oft mit der Perücke oder Nase seines Ältervaters zum Vorschein kömmt. Doch hat sich der Verfasser erlaubt, das Vage dieser Erzählungen zu lokalisieren und sie in Zeiten und Örter zu versetzen, die sich zu ihrem Inhalt zu passen schienen. Ganz in ihrer eigentümlichen Gestalt waren sie nicht wohl zu produzieren. Ob es aber mit Bearbeitung dieser rohen Massen ihm also gelungen, wie seinem Nachbar dem Bildner, der mit kunstreicher Hand durch Schlägel und Meißel, aus einem unbehülflichen Marmorwürfel bald einen Gott, bald einen Halbgott oder Genius hervorgehen läßt, der nun in den Kunstgemächern pranget, da er vorher ein gemeiner Mauerstein war: das zu entscheiden, werter Herr Runkel, ist jetzt Seine Sache.
Geschrieben im Rosenmond 1782.
Die Bücher der Chronika der drei Schwestern
Erstes Buch
Ein reicher, reicher Graf vergeudete sein Gut und Habe. Er lebte königlich, hielt alle Tage offne Tafel; wer bei ihm einsprach, Ritter oder Knappe, dem gab er drei Tage lang ein herrliches Bankett, und alle Gäste taumelten mit frohem Mut von ihm hinweg. Er liebte Brettspiel und Würfel; sein Hof wimmelte von goldgelockten Edelknaben, Läufern und Heiducken, in prächtiger Livree, und seine Ställe nährten unzählige Pferde und Jagdhunde. Durch diesen Aufwand zerrannen seine Schätze. Er verpfändete eine Stadt nach der andern, verkaufte seine Juwelen und Silbergeschirr, entließ die Bedienten und erschoß die Hunde; von seinem ganzen Eigentum blieb ihm nichts übrig, als ein altes Waldschloß, eine tugendsame Gemahlin und drei wunderschöne Töchter. In diesem Schlosse hauste er von aller Welt verlassen, die Gräfin versah mit ihren Töchtern selbst die Küche, und weil sie allerseits der Kochkunst nicht kundig waren, wußten sie nichts als Kartoffeln zu sieden. Diese frugalen Mahlzeiten behagten dem Papa so wenig, daß er grämlich und mißmütig wurde, und in dem weiten leeren Hause so lärmte und fluchte, daß die kahlen Wände seinen Unmut widerhallten. An einem schönen Sommermorgen ergriff er aus Spleen seinen Jagdspieß, zog zu Walde, ein Stück Wild zu fällen, um sich eine leckerhafte Mahlzeit davon bereiten zu lassen.
Von diesem Walde ging die Rede, daß es darin nicht geheuer sei; manchen Wandrer hatte es schon irre geführt, und mancher war nie daraus zurückgekehrt, weil ihn entweder böse Gnomen erdrosselt oder wilde Tiere zerrissen hatten. Der Graf glaubte nichts und fürchtete nichts von unsichtbaren Mächten, er stieg rüstig über Berg und Tal, und kroch durch Busch und Dickig, ohne eine Beute zu erhaschen. Ermüdet setzte er sich unter einen hohen Eichbaum, nahm einige gesottne Kartoffeln und ein wenig Salz aus der Jagdtasche, um hier sein Mittagsmahl zu halten. Von ungefähr hub er seine Augen auf, siehe da! ein grausam wilder Bär schritt auf ihn zu. Der arme Graf erbebte über diesen Anblick, entfliehen konnt er nicht, und zu einer Bärenjagd war er nicht ausgerüstet. Zur Notwehr nahm er den Jägerspieß in die Hand, sich damit zu verteidigen, so gut er könnte. Das Ungetüm kam nah heran; auf einmal stund's und brummte ihm vernehmlich diese Worte entgegen: »Räuber, plünderst du meinen Honigbaum? Den Frevel sollst du mit dem Leben büßen!« »Ach«, bat der Graf, »ach, freßt mich nicht, Herr Bär, mich lüstet nicht nach Eurem Honig, ich bin ein biedrer Rittersmann. Seid Ihr bei Appetit, so nehmt mit Hausmannskost vorlieb und seid mein Gast.« Hierauf tischt er dem Bären alle Kartoffeln in seinem Jagdhute auf. Dieser aber verschmähete des Grafen Tafel und brummte unwillig fort: »Unglücklicher, um diesen Preis lösest du dein Leben nicht; verheiß mir deine große Tochter Wulfild augenblicks zur Frau, wo nicht, so freß ich dich!« In der Angst hätte der Graf dem veramorten Bären wohl alle drei Töchter verheißen, und seine Gemahlin obendrein, wenn er sie verlangt hätte; denn Not kennt kein Gesetz. »Sie soll die Eure sein, Herr Bär«, sprach der Graf, der anfing, sich wieder zu erholen; doch setzte er trüglich hinzu, »unter dem Beding, daß Ihr nach Landes Brauch die Braut löset und selber kommt, sie heimzuführen.« »Topp«, murmelte der Bär, »schlag ein«, und reichte ihm die rauhe Tatze hin, »in sieben Tagen lös ich sie mit einem Zentner Gold und führ mein Liebchen heim.« »Topp«, sprach der Graf, »ein Wort ein Mann!« Drauf schieden sie in Frieden auseinander, der Bär trabte seiner Höhle zu, der Graf säumte nicht, aus dem furchtbaren Walde zu kommen, und gelangte bei Sternenschimmer kraftlos und ermattet in seinem Waldschloß an.
Zu wissen ist, daß ein Bär, der wie ein Mensch vernünftig reden und handeln kann, niemals ein natürlicher, sondern ein bezauberter Bär sei. Das merkte der Graf wohl, darum dacht er, den zottigen Eidam durch List zu hintergehen, und sich in seiner festen Burg so zu verpallisidieren, daß es dem Bär unmöglich wär, hineinzukommen, wenn er auf den bestimmten Termin die Braut abholen würde. Wenngleich einem Zauberbär, dacht er bei sich, die Gabe der Vernunft und Sprache verliehen ist, so ist er doch gleichwohl ein Bär, und hat übrigens alle Eigenschaften eines natürlichen Bären. Er wird also doch wohl nicht fliegen können, wie ein Vogel; oder durchs Schlüsselloch in ein verschlossenes Zimmer eingehen, wie ein Nachtgespenst; oder durch ein Nadelöhr schlüpfen. Den folgenden Tag berichtete er seiner Gemahlin und den Fräuleins das Abenteuer im Walde. Fräulein Wulfild fiel vor Entsetzen in Ohnmacht, als sie hörte, daß sie an einen scheußlichen Bär vermählt werden sollte, die Mutter rang und wand die Hände und jammerte laut, und die Schwestern bebten und bangten vor Wehmut und Entsetzen. Papa aber ging hinaus, beschauete die Mauren und Graben ums Schloß her, untersuchte, ob das eiserne Tor schloß- und riegelfest sei, zog die Zugbrücke auf und verwahrte alle Zugänge wohl, stieg darauf auf die Warte, und fand da ein Kämmerlein hochgebaut unter der Zinne und wohlvermauert, darin verschloß er das Fräulein, die ihr seidenes Flachshaar zerraufte, und schier die himmelblauen Augen ausweinte.
Sechs Tage waren verflossen und der siebente dämmerte heran, da erhob sich vom Walde her groß Getöse, als sei das wilde Heer im Anzuge. Peitschen knallten, Posthörner schallten, Pferde trappelten, Räder rasselten. Eine prächtige Staatskarosse mit Reutern umringt rollte übers Blachfeld daher ans Schloßtor. Alle Riegel schoben sich, das Tor rauschte auf, die Zugbrücke fiel, ein junger Prinz stieg aus der Karosse, schön wie der Tag, angetan mit Sammet und Silberstück, um seinen Hals hatte er eine goldne Kette dreimal geschlungen, in der ein Mann aufrechts stehen konnte, um seinen Hut lief eine Schnur von Perlen und Diamanten, welche die Augen verblendete, und um die Agraffe, welche die Straußfeder trug, wär ein Herzogtum feil gewesen. Rasch, wie Sturm und Wirbelwind, flog er die Schneckentreppe im Turm hinauf, und einen Augenblick nachher bebte in seinem Arm die erschrockne Braut herab.
Über dem Getöse erwachte der Graf aus seinem Morgenschlummer, schob das Fenster im Schlafgemach auf, und als er Roß und Wagen, und Ritter und Reisige im Hofe erblickte, und seine Tochter im Arm eines fremden Mannes, der sie in den Brautwagen hob, und nun der Zug zum Schloßtor hinausging, fuhr's ihm durchs Herz, und er erhob groß Klaggeschrei: »Ade, mein Töchterlein! Fahr hin, du Bärenbraut!« Wulfild vernahm die Stimme ihres Vaters, ließ ihr Schweißtüchlein zum Wagen herauswehen, und gab damit das Zeichen des Abschieds.
Die Eltern waren bestürzt über den Verlust ihrer Tochter, und sahen einander stumm und staunend an. Mama traute gleichwohl ihren Augen nicht, und hielt die Entführung für Blendwerk und Teufelsspuk, ergriff ein Bund Schlüssel und lief auf die Warte, öffnete die Klause, fand aber ihre Tochter nimmer, auch nichts von ihrer Gerätschaft; doch lag auf dem Tischlein ein silberner Schlüssel, den sie zu sich nahm, und als sie von ungefähr durch die Luke blickte, sah sie in der Ferne eine Staubwolke gegen Sonnenaufgang emporwirbeln, hörte Getümmel und Jauchzen des Brautzugs bis zum Eingang des Waldes. Betrübt stieg sie vom Turm herab, legte Trauerkleider an, bestreute ihr Haupt mit Asche, weinte drei Tage lang und Gemahl und Töchter halfen ihr wehklagen. Am vierten Tage verließ der Graf das Trauergemach, um frische Luft zu schöpfen, wie er über den Hof ging, stand da eine feine dichte Kiste von Ebenholz, wohlverwahrt und schwer zu heben. Er ahndete leicht, was drinnen sei, die Gräfin gab ihm den Schlüssel, er schloß auf, und fand einen Zentner Goldes eitel Dublonen, eines Schlags. Erfreut über diesen Fund vergaß er all sein Herzeleid, kaufte Pferde und Falken, auch schöne Kleider für seine Gemahlin und die holden Fräulein, nahm Diener in Sold, hob von neuem an zu prassen und zu schwelgen, bis die letzte Dublone aus dem Kasten flog. Dann machte er Schulden, und die Gläubiger kamen scharenweis, plünderten das Schloß rein aus, und ließen ihm nichts als einen alten Falken. Die Gräfin bestellte wieder mit ihren Töchtern die Küche, und er durchstreifte tagtäglich das Feld mit seinem Federspiel aus Verdruß und Langerweile.
Eines Tages ließ er den Falken steigen, der hob sich hoch in die Lüfte und wollte nicht auf die Hand seines Herrn zurückkehren, ob er ihn gleich lockte. Der Graf folgte seinem Flug, so gut er konnte, über die weite Ebne. Der Vogel schwebte dem grausenvollen Walde zu, welchen zu betreten der Graf nicht mehr waghalsen wollte, und sein liebes Federspiel verloren gab. Plötzlich stieg ein rüstiger Adler über dem Walde auf und verfolgte den Falken, welcher den überlegenen Feind nicht sobald ansichtig wurde, als er pfeilgeschwind zu seinem Herrn zurückkehrte, um bei ihm Schutz zu suchen. Der Adler aber schoß aus den Lüften herab, schlug einen seiner mächtigen Fänge in des Grafen Schulter, und zerdrückte mit dem andern den getreuen Falken. Der bestürzte Graf versuchte mit dem Speer von dem gefiederten Ungeheuer sich zu befreien, schlug und stach nach seinem Feinde. Der Adler ergriff den Jagdspieß, zerbrach ihn wie ein leichtes Schilfrohr, und kreischte ihm mit lauter Stimme diese Worte in die Ohren: »Verwegner, warum beunruhigest du mein Luftrevier mit deinem Federspiel? Den Frevel sollst du mit deinem Leben büßen.« Aus dieser Vogelsprache merkte der Graf bald, was für ein Abenteuer er zu bestehen habe. Er faßte Mut und sprach: »Gemach, Herr Adler, gemach! Was hab ich Euch getan? Mein Falk hat seine Schuld ja abgebüßt, den laß ich Euch, stillt Euren Appetit.« »Nein«, fuhr der Adler fort, »mich lüstet eben heut nach Menschenfleisch, und du scheinst mir ein fetter Fraß.« »Pardon, Herr Adler«, schrie der Graf in Todesangst, »heischt was Ihr wollt von mir, ich geb es Euch: nur schont meines Lebens.« »Wohl gut«, versetzte der mörderische Vogel, »ich halte dich beim Wort; du hast zwo schöne Töchter, und ich bedarf ein Weib. Verheiß mir deine Adelheid zur Frau, so laß ich dich mit Frieden ziehen, und löse sie von dir mit zwo Stufen Gold, jede einen Zentner schwer. In sieben Wochen führ ich mein Liebchen heim.« Hierauf schwang sich das Ungetüm hoch empor und verschwand in den Wolken.
In der Not ist einem alles feil. Da der Vater sahe, daß der Handel mit den Töchtern so gut vonstatten ging, gab er sich über ihren Verlust zufrieden. Er kam diesmal ganz wohlgemut nach Hause, und verhehlte sorgfältig sein Abenteuer; teils den Vorwürfen, die er von der Gräfin fürchtete, auszuweichen; teils der lieben Tochter das Herz vor der Zeit nicht schwer zu machen. Zum Schein klagte er nur über den verlornen Falken, von welchem er vorgab, er habe sich verflogen. Fräulein Adelheid war eine Spinnerin, als keine im Lande. Sie war auch eine geschickte Weberin, und schnitt eben damals ein Stück köstlicher Leinwand vom Weberstuhle, so fein wie Battist, welche sie unfern der Burg auf einem frischen Rasenplatze bleichte. Sechs Wochen und sechs Tage vergingen, ohne daß die schöne Spinnerin ihr Schicksal ahndete: obgleich der Vater, der doch etwas schwermütig wurde, als der Termin der Heimsuchung nahete, ihr unter der Hand manchen Wink davon gab, bald einen bedenklichen Traum erzählte, bald die Wulfild wieder in Andenken brachte, die längst vergessen war. Adelheid war frohen und leichten Sinnes, wähnte, das schwere Herzblut des Vaters erzeuge hypochondrische Grillen. Sie hüpfte sorgenlos bei Anbruch des bestimmten Tages hinaus auf den Bleichrasen, breitete ihre Leinwand aus, damit sie vom Morgentau getränkt würde. Wie sie ihre Bleiche beschickt hatte, und nun ein wenig umherschauete, sah sie einen herrlichen Zug Ritter und Knappen herantraben. Sie hatte ihre Toilette noch nicht gemacht, darum verbarg sie sich hinter einen wilden Rosenbusch, der eben in voller Blüte stand, und glostete hervor, die prächtige Kavalkade zu schauen. Der schönste Ritter aus dem Haufen, ein junger schlanker Mann in offnem Helm, sprengte an den Busch, und sprach mit sanfter Stimme: »Ich sehe dich, ich suche dich, fein Liebchen, ach verbirg dich nicht; rasch schwing dich hinter mich aufs Roß, du schöne Adlerbraut!« Adelheid wußte nicht wie ihr geschah, da sie diesen Spruch hörte; der liebliche Ritter gefiel ihr baß; aber der Beisatz, Adlerbraut, machte das Blut in ihren Adern erstarren; sie sank ins Gras, ihre Sinnen umnebelten sich, und beim Erwachen befand sie sich in den Armen des holden Ritters, auf dem Wege nach dem Walde.
Mama bereitete indes das Frühstück; und als Adelheid dabei fehlte, schickte sie die jüngste Tochter hinaus, zu sehen, wo sie bliebe. Sie ging und kam nicht wieder. Die Mutter ahndete nichts Gutes, wollte sehen, was ihre Töchter so lange weilten. Sie ging und kam nicht wieder. Papa merkte, was vorgegangen sei, das Herz schlug laut in seiner Brust, er schlich sich auch nach dem Rasenplatze, wo Mutter und Tochter noch immer nach der Adelheid suchten und ängstlich sie beim Namen riefen, er ließ seine Stimme gleichfalls weidlich erschallen, wiewohl er wußte, daß alles Rufen und Umsuchen vergeblich war. Sein Weg führte ihn vor dem Rosenbusche vorüber, da sah er was blinken, und wie er's genau betrachtete, waren's zwo goldene Eier, jedes einen Zentner schwer. Nun konnt er nicht länger anstehn, seiner Gemahlin das Abenteuer der Tochter zu offenbaren. »Schandbarer Seelverkäufer«, rief sie aus, »o Vater! o Mörder! Opferst du um schändlichen Gewinstes willen also dein Fleisch und Blut dem Moloch auf?« Der Graf, sonst wenig beredsam, machte jetzt seine Apologie aufs beste, und entschuldigte sich mit der dringenden Gefahr seines Lebens. Aber die trostlose Mutter hörte nicht auf, ihm die bittersten Vorwürfe zu machen. Er wählte also das souveräne Mittel, allem Wortstreit ein Ende zu machen, er schwieg und ließ seine Dame reden, solange sie wollte, brachte indessen die goldnen Eier in Sicherheit, und wälzte sie gemachsam vor sich her, legte darauf Wohlstands halber drei Tage lang Familientrauer an und dachte nur darauf, seine vorige Lebensart wieder zu beginnen.
In kurzer Zeit war das Schloß wieder die Wohnung der Freude, das Elysium gefräßiger Schranzen. Ball, Turnier und prächtige Feten wechselten täglich ab. Fräulein Bertha glänzte am Hofe ihres Vaters den stattlichen Rittern in die Augen, wie der Silbermond den empfindsamen Wandlern in einer heitern Sommernacht. Sie pflegte bei den Ritterspielen den Preis auszuteilen, und tanzte jeden Abend mit dem siegenden Ritter den Vorreihen. Die Gastfreigebigkeit des Grafen und die Schönheit der Tochter, zog von den entlegensten Örtern die edelsten Ritter herbei. Viele buhlten um das Herz der reichen Erbin, aber unter so vielen Freiwerbern hielt die Wahl schwer, denn einer übertraf den andern immer an Adel und Wohlgestalt. Die schöne Bertha kürte und wählte so lang, bis die goldnen Eier, bei welchen der Graf die Feile nicht gespart hatte, auf die Größe der Haselnüsse reduziert waren. Die gräflichen Finanzen gerieten wieder in den vorigen Verfall, die Turniere wurden eingestellt, Ritter und Knappen verschwanden allgemach, das Schloß nahm wieder die Gestalt einer Eremitage an, und die gräfliche Familie kehrte zu den frugalen Kartoffelmahlzeiten zurück. Der Graf durchstrich mißmütig die Felder, wünschte ein neues Abenteuer und fand keins, weil er den Zauberwald scheuete.
Eines Tages verfolgte er ein Volk Rebhühner so weit, daß er dem schauervollen Walde nahe kam, und ob er gleich sich nicht hineinwagte, so ging er doch eine Strecke an der Brahne hin, und erblickte da einen großen Fischweiher, der ihm noch nie zu Gesichte gekommen war, in dessen silberhellen Gewässer er unzählige Forellen schwimmen sah. Dieser Entdeckung freuete er sich sehr. Der Teich hatte ein unverdächtiges Ansehen, daher eilte er nach Hause, strickte sich ein Netz und den folgenden Morgen stand er bei guter Zeit am Gestade, um solches auszuwerfen. Glücklicherweise fand er einen kleinen Nachen mit einem Ruder im Schilfe, er sprang hinein, ruderte lustig auf dem Teich herum, warf das Netz aus, fing mit einem Zuge mehr Fohren als er tragen konnte, und ruderte vergnügt über diese Beute dem Strande zu. Ungefähr einen Steinwurf vom Gestade stund der Nachen in vollem Lauf fest und unbeweglich, als säß er auf dem Grunde. Der Graf glaubte das auch, und arbeitete aus allen Kräften, ihn wieder flott zu machen, wiewohl vergebens. Das Wasser verrann rings umher, das Fahrzeug schien auf einer Klippe zu hangen, und hob sich hoch über die Oberfläche empor. Dem unerfahrnen Fischer war dabei nicht wohl zu Mute; obgleich der Nachen wie angenagelt stund, so schien sich doch von allen Seiten das Gestade zu entfernen, der Weiher dehnte sich zu einer großen See aus, die Wogen schwallen auf, die Wellen rauschten und schäumten, und mit Entsetzen wurd er inne, daß ein ungeheurer Fisch ihn und seinen Nachen auf dem Rücken trug. Er ergab sich in sein Schicksal, ängstlich harrend, welchen Ausgang es nehmen würde. Urplötzlich tauchte der Fisch unter, der Nachen war wieder flott, doch einen Augenblick nachher war das Meerwunder über Wasser, sperrte einen abscheulichen Rachen gleich der Höllenpforte auf, und aus dem finstern Schlunde schallten, wie aus einem unterirdischen Gewölbe, vernehmlich diese Worte hervor: »Kühner Fischer, was beginnst du hier? du mordest meine Untertanen? den Frevel sollst du mit dem Leben büßen!« Der Graf hatte nun bereits so viel Routine in den Abenteuern erlangt, daß er wußte, wie er sich bei dergleichen Gelegenheiten zu nehmen hatte. Er erholte sich bald von seiner ersten Bestürzung, da er merkte, daß der Fisch doch ein vernünftig Wort mit sich reden ließ, und sprach ganz dreuste: »Herr Behemot, verletzt das Gastrecht nicht, vergönnt mir ein Gerichte Fisch aus Eurem Weiher, sprächt Ihr bei mir ein, so stünd Euch Küch und Keller gleichfalls offen.« »So traute Freunde sind wir nicht«, versetzte das Ungeheuer, »kennst du noch nicht des Stärkern Recht, daß der den Schwächern frißt? Du stahlst mir meine Untertanen, sie zu verschlingen, und ich verschlinge dich!« Hier riß der grimmige Fisch den Rachen noch weiter auf, als wollt er Schiff mit Mann und Maus verschlingen. »Ach schonet, schont mein Leben«, schrie der Graf, »Ihr seht, ich bin ein mageres Morgenbrot für Euren Walfischbauch!« Der große Fisch schien sich etwas zu bedenken: »Wohlan«, sprach er, »ich weiß, du hast eine schöne Tochter, verheiß mir die zum Weibe, und nimm dein Leben zum Gewinn.« Als der Graf hörte, daß der Fisch aus diesem Tone zu reden anfing, verschwand ihm alle Furcht. »Sie stehet zu Befehl«, sprach er, »Ihr seid ein wackrer Eidam, dem kein biedrer Vater sein Kind versagen wird. Doch, womit löset Ihr die Braut nach Landes Brauch?« »Ich habe«, erwiderte der Fisch, »weder Gold noch Silber; aber im Grunde dieser See liegt ein großer Schatz von Perlenmuscheln, du darfst nur fordern.« »Nun«, sagte der Graf, »drei Himten Zahlperlen sind wohl nicht zu viel für eine schöne Braut.« »Sie sind dein«, beschloß der Fisch, »und mein die Braut, in sieben Monden führ ich mein Liebchen heim.« Hierauf stürmt' er lustig mit dem Schwanze, und trieb den Nachen bald an den Strand.
Der Graf brachte seine Forellen heim, ließ sie sieden und sich diese Karthäusermahlzeit nebst der Gräfin und der schönen Bertha wohl schmecken, und die letztere ahndete nicht, daß ihr dies Mahl teuer würde zu stehen kommen. Unterdessen nahm der Mond sechsmal ab und zu, und der Graf hatte sein Abenteuer beinahe vergessen; als aber der Silbermond zum siebendenmal sich zu runden begann, dacht er an die bevorstehende Katastrophe, und um kein Augenzeuge davon zu sein, drückte er sich ab, und unternahm eine kleine Reise ins Land. In der schwülen Mittagsstunde, am Tage des Vollmonds, sprengte ein stattlich Geschwader Reuter ans Schloß; die Gräfin, bestürzt über so vielen fremden Besuch, wußte nicht, ob sie die Pforte öffnen sollte oder nicht. Als sich aber ein wohlbekannter Ritter anmeldete, ward ihm aufgetan. Er hatte gar oft zur Zeit des Wohlstandes und Überflusses in der Burg den Turnieren beigewohnt, und zu Schimpf und Ernst gestochen, auch manchen Ritterdank von der schönen Bertha Hand empfangen, und mit ihr den Vorreihen getanzt; doch seit der Glücksveränderung des Grafen, war er gleich den übrigen Rittern verschwunden. Die gute Gräfin schämte sich vor dem edlen Ritter und seinem Gefolge ihrer großen Armut, daß sie nichts hatte, ihm aufzutischen. Er aber trat sie freundlich an, und bat nur um einen Trunk frisch Wasser aus dem kühlen Felsenbrunnen des Schlosses, wie er auch sonst zu tun gewohnt war, denn er pflegte nie Wein zu trinken, daher nennte man ihn scherzweise nur den Wasserritter. Die schöne Bertha eilte auf Geheiß der Mutter zum Brunnen, füllte einen Henkelkrug und kredenzte dem Ritter eine kristallene Schale, er empfing solche aus ihrer niedlichen Hand, setzte sie da an den Mund, wo ihre Purpurlippen die Schale berührt hatten, und tat ihr mit innigem Entzücken Bescheid. Die Gräfin befand sich indessen in großer Verlegenheit, daß sie nicht vermögend war, ihrem Gaste etwas zum Imbiß aufzutragen; doch besann sie sich, daß im Schloßgarten eben eine saftige Wassermelone reifte. Augenblicklich drehete sie sich nach der Tür, brach die Melone ab, legte sie auf einen irdenen Teller, viel Weinlaub drunter und die schönsten wohlriechenden Blumen ringsumher, um sie dem Gaste aufzutragen. Wie sie aus dem Garten trat, war der Schloßhof leer und öde, sie sahe weder Pferde noch Reisige mehr, im Zimmer war kein Ritter, kein Knappe; sie rief ihre Tochter Bertha, suchte sie im ganzen Hause und fand sie nicht. Im Vorhause aber waren drei Säcke von neuer Leinwand hingestellt, die sie in der ersten Bestürzung nicht bemerkt hatte, und die von außen anzufühlen waren, als wären sie mit Erbsen gefüllt, genauer sie zu untersuchen, ließ ihre Betrübnis nicht zu. Sie überließ sich ganz ihrem Schmerz, und weinte laut bis an den Abend, wo ihr Gemahl heimkehrte, der sie in großem Jammer fand. Sie konnt ihm die Begenbenheit des Tages nicht verhehlen, so gern sie es getan hätte, denn sie befürchtete von ihm große Vorwürfe, daß sie einen fremden Ritter in die Burg gelassen, der die liebe Tochter entführt hätte. Aber der Graf tröstete sie liebreich und frug nur nach den Erbssäcken, von welchen sie ihm gesagt hatte, ging hinaus, sie zu beschauen und öffnete einen in ihrer Gegenwart. Wie groß war das Erstaunen der betrübten Gräfin, als eitel Perlen herausrollten, so groß, wie die großen Gartenerbsen, vollkommen gerundet, fein gebohrt, und von dem reinsten Wasser. Sie sahe wohl, daß der Entführer ihrer Tochter jede mütterliche Zähre mit einer Zahlperl bezahlt hatte, bekam von seinem Reichtum und Stande eine gute Meinung, und tröstete sich damit, daß dieser Eidam kein Ungeheuer, sondern ein stattlicher Ritter sei, welche Meinung ihr der Graf auch nicht benahm.
Nun gingen die Eltern zwar aller schönen Töchter verlustig; aber sie besaßen einen unermeßlichen Schatz. Der Graf machte bald einen Teil davon zu Gelde. Vom Morgen bis zum Abend war ein Gewühl von Kaufleuten und Juden im Schlosse, um die köstlichen Zahlperlen zu handeln. Der Graf löste seine Städte ein, tat das Waldschloß an einen Lehnsmann aus, bezog seine vormalige Residenz, richtete den Hofstaat wieder an, und lebte nicht mehr als ein Verschwender, sondern als ein guter Wirt, denn er hatte nun keine Tochter mehr zu verhandeln. Das edle Paar befand sich in großer Behäglichkeit, nur die Gräfin konnte sich über den Verlust ihrer Fräuleins nicht beruhigen, sie trug beständig Trauerkleider, und wurde nimmer froh. Eine Zeitlang hoffte sie, ihre Bertha mit dem reichen Perlenritter wieder zu sehen, und wenn ein Fremder bei Hofe gemeldet wurde, ahndete sie den wiederkehrenden Eidam. Der Graf vermocht es endlich nicht länger über sich, sie mit leerer Hoffnung hinzuhalten; in der traulichen Bettkammer, welche so manchem Männergeheimnis Luft macht, eröffnete er ihr, daß dieser herrliche Eidam ein scheußlicher Fisch sei. »Ach«, erseufzte die Gräfin, »ach, ich unglückliche Mutter! Hab ich darum Kinder geboren, daß sie ein Raub grausender Ungeheuer werden sollten? Was ist alles Erdenglück, was sind alle Schätze für eine kinderlose Mutter!« »Liebes Weib«, antwortete der Graf, »beruhiget Euch, es ist nun einmal nicht anders, wenn's von mir abhing, sollt es Euch an Kindersegen nicht gebrechen.« Die Gräfin nahm diese Worte zu Herzen, meinte, ihr Gemahl mache ihr Vorwürfe, daß sie altere und die Unfruchtbare im Hause sei, denn er war noch ein feiner rüstiger Mann. Darüber betrübte sie sich so sehr, daß sie in große Schwermut fiel, und Freund Hein wär ihr wohl ein willkommner Gast gewesen, wenn er bei ihr eingesprochen hätte.
Zweites Buch
Alle Jungfrauen und Dirnen am Hofe nahmen großen Teil an den Leiden ihrer guten Frau, jammerten und weinten mit ihr, und suchten sie zu Zeiten auch durch Sang und Saitenspiel aufzuheitern; aber ihr Herz war der Freuden nicht mehr empfänglich. Jede Hofdame gab weisen Rat, wie der Geist des Trübsinns weggebannet werden möchte, gleichwohl war nichts zu erdenken, den Kummer der Gräfin zu mindern. Die Jungfrau, welche ihr das Handwasser reichte, war vor allen andern Dirnen klug und sittsam und bei ihrer Gebieterin wohlgelitten, sie hatte ein empfindsames Herz, und der Schmerz ihrer Herrschaft lockte ihr manche Träne ins Auge. Um nicht vorlaut zu scheinen, hatte sie immer geschwiegen, endlich konnte sie dem innern Drange nicht widerstehen, auch ihren guten Rat zu erteilen. »Edle Frau«, sagte sie, »wenn Ihr mich hören wolltet, so wüßt ich Euch wohl ein Mittel zu sagen, die Wunden Eures Herzens zu heilen.« Die Gräfin sprach: »Rede!« »Unfern von Eurer Residenz«, fuhr die Jungfrau fort, »wohnet ein frommer Einsiedler in einer schauervollen Grotte, zu welchem viel Pilger in mancherlei Not ihre Zuflucht nehmen, wie wär's, wenn Ihr von dem heiligen Manne Trost und Hülfe begehrtet? Wenigstens würde sein Gebet Euch die Ruhe Eures Herzens wiedergeben.« Der Gräfin gefiel dieser Vorschlag, sie hüllte sich in ein Pilgerkleid, wallfahrtete zu dem frommen Eremiten, eröffnete ihm ihr Anliegen, beschenkte ihn mit einem Rosenkranze von Zahlperlen, und bat um seinen Segen, welcher so kräftig war, daß, eh ein Jahr verging, die Gräfin ihrer Traurigkeit quitt und ledig war, und eines jungen Sohns genas.
Groß war die Freude der Eltern über den holden Spätling, die ganze Grafschaft verwandelte sich in einen Schauplatz der Wonne, des Jubels und der Feierlichkeiten bei der Geburt des jungen Stammerben. Der Vater nannte ihn Reinald das Wunderkind. Der Knabe war schön, wie der Amor selbst, und seine Erziehung wurde mit solcher Sorgfalt betrieben, als wenn die Morgenröte der philanthropistischen Methode damals schon wär angebrochen gewesen. Er wuchs lustig heran, war die Freude des Vaters und der Mutter Trost, die ihn wie ihren Augapfel wahrte. Ob er nun wohl der Liebling ihres Herzens war, so verlosch doch das Andenken an ihre drei Töchter nicht in ihrem Gedächtnis. Oft, wenn sie den kleinen lachenden Reinald in die Arme schloß, träufelte eine Zähre auf seine Wangen, und als der liebe Knabe etwas heranwuchs, frug er oft wehmütig: »Gute Mutter, was weinest du?« Die Gräfin verhehlte ihm aber mit Vorbedacht die Ursache ihres geheimen Kummers: denn außer dem Gemahl wußte niemand, wo die drei jungen Gräfinnen hingeschwunden waren. Manche spekulative Köpfe wollten wissen, sie wären von irrenden Rittern entführt worden, welches damals nichts Ungewöhnliches war; andere behaupteten, sie lebten in einem Kloster versteckt; noch andere wollten sie im Gefolge der Königin von Burgund, oder der Gräfin von Flandern, gesehen haben. Durch tausend Schmeicheleien lockte Reinald der zärtlichen Mutter dennoch das Geheimnis ab, sie erzählte ihm die Abenteuer der drei Schwestern nach allen Umständen, und er verlor kein Wort von diesen Wundergeschichten aus seinem Herzen. Er hatte keinen andern Wunsch als den, wehrhaft zu sein, um auf das Abenteuer auszugehen, seine Schwestern im Zauberwalde aufzusuchen und ihren Zauber zu lösen. Sobald er zum Ritter geschlagen war, begehrte er vom Vater Urlaub, einen Heereszug, wie er vorgab, nach Flandern zu tun. Der Graf freuete sich des ritterliches Mutes seines Sohnes, gab ihm Pferde und Waffen, auch Schildknappen und Troßbuben, und ließ ihn mit Segen von sich, so ungern auch die sorgsame Mutter in den Abschied willigte.
Kaum hatte der junge Ritter seine Vaterstadt im Rücken, so verließ er die Heerstraße und trabte mit romantischen Mute auf das Waldschloß zu, begehrte von dem Lehnsmann Herberge, der ihn ehrlich empfing und wohlhielt. Am frühen Morgen, da im Schloß noch alles in süßen Schlummer lag, sattelte er sein Roß, ließ sein Gefolge zurück, und jagte voll Mut und Jugendfeuer nach dem bezauberten Walde hin. Je weiter er hineinkam, je dichter wurde das Gebüsch, und vom Huf seines Pferdes schalleten die schroffen Felsen wider. Alles um ihn her war einsam und öde, und die dichtverwachsenen Bäume schienen dem jungen Waghals den weitern Eingang mitleidig zu versperren. Er stieg vom Pferde, ließ es grasen und machte sich mit seinem Schwert einen Weg durch den Busch, klimmete an steilen Felsen hinan und gleitete in Abgründe hinab. Nach langer Mühe gelangte er in ein gekrümmtes Tal, durch welches sich ein klarer Bach schlängelte. Er folgte den Krümmungen desselben, in der Ferne öffnete eine Felsengrotte ihren unterirdischen Schlund, vor welcher etwas, das einer menschlichen Figur ähnlich war, sich zu regen schien. Der kecke Jüngling verdoppelte seine Schritte, nahm den Weg zwischen den Bäumen hin, blickte der Grotte gegenüber hinter den hohen Eichen durch, und sahe eine junge Dame im Grase sitzen, die einen kleinen ungestalten Bär auf dem Schoße liebkoste, indes noch ein größerer um sie schäkerte, bald ein Männchen machte, bald einen possierlichen Purzelbaum schlug, welches Spiel die Dame sehr zu amüsieren schien. Reinald erkannte nach der mütterlichen Erzählung die Dame für seine Schwester Wulfild, sprang hastig aus seinem Hinterhalt hervor, sich ihr zu entdecken. Sobald sie aber den jungen Mann erblickte, tat sie einen lauten Schrei, warf den kleinen Bär ins Gras, sprang auf, dem Kommenden entgegen, und redete ihn mit wehmütiger Stimme und ängstlicher Gebärde also an: »O Jüngling, welcher Unglücksstern führt dich in diesen Wald? Hier wohnt ein wilder Bär, der frißt all Menschenkind, die seiner Wohnung nahen, flieh und errette dich!« Er neigte sich züchtiglich gegen die bildschöne Dame und antwortete: »Fürchtet nichts, holde Gebieterin, ich kenne diesen Wald und seine Abenteuer, und komme, den Zauber zu lösen, der Euch hier gefangen hält.« »Tor!« sprach sie, »wer bist du, daß du es wagen darfst, diesen mächtigen Zauber zu lösen, und wie vermagst du das?« Er: »Mit diesem Arm und durch dies Schwert! Ich bin Reinald das Wunderkind genannt, des Grafen Sohn, dem dieser Zauberwald drei schöne Töchter raubte. Bist du nicht Wulfild, seine Erstgeborne?« Ob dieser Rede entsetzte sich die Dame noch mehr, und staunte den Jüngling mit stummer Verwunderung an. Er nutzte diese Pause und legitimierte sich durch so viel Familiennachrichten, daß sie nicht zweifeln konnte, Reinald sei ihr Bruder. Sie umhalste ihn zärtlich, aber ihr Kniee wankten vor Furcht wegen der augenscheinlichen Gefahr, worin sein Leben schwebte.
Sie führte hierauf ihren lieben Gast in die Höhle, um da einen Winkel auszuspähen, ihn zu beherbergen. In diesem weiten düstern Gewölbe lag ein Haufen Moos, welches dem Bär und seinen Jungen zum Lager diente; gegenüber aber stand ein prächtiges Bette, mit roten Damast behangen und mit goldnen Tressen besetzt, für die Dame. Reinald mußte sich bequemen, eiligst unter der Bettlade Platz zu suchen, und da sein Schicksal zu erwarten. Jeder Laut und alles Geräusch war ihm bei Leib und Leben untersagt, besonders prägte ihm die angstvolle Schwester wohl ein, weder zu husten, noch zu niesen. Kaum war der junge Waghals an seinem Zufluchtsorte, so brummte der fürchterliche Bär zur Höhle herein, schnoberte mit blutiger Schnauze allenthalben umher; er hatte den edlen Falben des Ritters im Walde ausgespürt und ihn zerrissen. Wulfild saß auf dem Thronbette wie auf Kohlen, ihr Herz war eingepreßt und beklommen, denn sie sahe bald, daß der Herr Gemahl seine Bärenlaune hatte, weil er vermutlich den fremden Gast in der Höhle merkte. Sie unterließ deshalb nicht, ihn zärtlich zu liebkosen, streichelte ihn sanft mit ihrer sammetweichen Hand den Rücken herab, grauete ihm die Ohren; aber das grämliche Vieh schien wenig auf diese Liebkosungen zu achten. »Ich wittere Menschenfleisch«, murmelte der Fresser aus seiner weiten Kehle. »Herzensbär«, sagte die Dame, »du irrst dich, wie käm ein Mensch in diese traurige Einöde?« »Ich wittere Menschenfleisch«, wiederholte er, und spionierte um das seidene Bette seiner Gemahlin herum. Dem Ritter ward dabei nicht wohl zu Mute. Ungeachtet seiner Herzhaftigkeit, trat ihm ein kalter Schweiß vor die Stirne; indessen machte die äußerste Verlegenheit die Dame herzhaft und entschlossen: »Freund Bär«, sprach sie, »bald treibst du mir's zu bunt, fort hier von meiner Lagerstatt, sonst fürchte meinen Zorn.« Der Schnauzbär kümmerte sich wenig um diese Drohung, er hörte nicht auf, um den Bettumhang herum zu tosen. Allein so sehr er auch Bär war, so stund er gleichwohl unter dem Pantoffel seiner Dame; wie er Miene machte, seinen Dickkopf unter die Bettlade zu zwängen, faßte sich Wulfild ein Herz, und versetzte ihm einen so nachdrücklichen Fußtritt in die Lenden, daß er ganz demütig auf seine Streu kroch, sich niedertat, brummend an den Tatzen sog und seine Jungen leckte. Bald darauf schlief er ein und schnarchte wie ein Bär. Hierauf erquickte die traute Schwester ihren Bruder mit einem Glase Sekt und etwas Zwieback, ermahnte ihn, gutes Muts zu sein, nun sei die Gefahr größtenteils vorüber. Reinald war von seinem Abenteuer so ermüdet, daß er bald darauf in tiefen Schlaf fiel, und mit dem Schwager Bär um die Wette schnarchte.
Beim Erwachen befand er sich in einem herrlichen Prunkbette, in einem Zimmer mit seidenen Tapeten, die Morgensonne blickte freundlich zwischen den aufgezogenen Gardinen herein, neben dem Bette lagen auf einigen mit Sammet bekleideten Taburetts seine Kleider und die ritterliche Waffenrüstung, auch stund ein silbernes Glöcklein dabei, den Dienern zu schellen. Reinald begriff nicht, wie er aus der schaudervollen Höhle in einen prächtigen Palast sei versetzt worden, und war zweifelhaft, ob er jetzt träume, oder vorhin das Abenteuer im Walde geträumt habe. Aus dieser Ungewißheit zu kommen, zog er die Glocke. Ein zierlich gekleideter Kammerdiener trat herein, frug nach seinen Befehlen, und meldete, daß seine Schwester Wulfild und ihr Gemahl Albert der Bär, seiner mit Verlangen warteten. Der junge Graf konnte sich von seinem Erstaunen nicht erholen. Ob ihm gleich bei Erwähnung des Bären der kalte Schweiß an die Stirn trat, so ließ er sich doch rasch ankleiden, trat ins Vorgemach heraus, wo er aufwartende Edelknaben, Läufer und Heiducken antraf, und mit diesem Gefolge gelangte er durch eine Menge Prachtgemächer und Vorsäle zum Audienzzimmer, wo ihn seine Schwester mit dem Anstande einer Fürstin empfing. Neben sich hatte sie zwei allerliebste Kinder, einen Prinzen von sieben Jahren und ein zartes Fräulein, das noch am Gängelbande geleitet wurde. Einen Augenblick hernach trat Albrecht der Bär herein, der jetzt sein grausendes Ansehen und alle Eigenschaften eines Bären abgelegt hatte, und als der liebenswürdigste Prinz erschien. Wulfild präsentierte ihren Bruder an ihn, und Albert umhalste seinen Schwager mit aller Wärme der Freundschaft und Bruderliebe.
Der Prinz war mit all seinem Hofgesinde durch einen feindseligen Zauber auf Tage verzaubert. Das heißt, er genoß die Vergünstigung, alle sieben Tage von einer Morgenröte bis zur andern des Zaubers entlediget zu werden. Sobald aber die silbernen Sternlein am Himmel erbleichten, fiel der eherne Zauber wieder mit dem Morgentau aufs Land; das Schloß verwandelte sich in einen schroffen unersteiglichen Felsen, der reizende Park ringsumher in eine traurige Einöde, die Springbrunnen und Kaskaden in stehende trübe Sümpfe, der Inhaber des Schlosses wurde ein Zottenbär, die Ritter und Knappen Dächse und Marter; Hofdamen und Zofen wandelten sich in Eulen und Fledermäuse um, die Tag und Nacht girrten und wehklagten. An einem solchen Tage der Entzauberung war es, wo Albrecht seine Braut heimführte. Die schöne Wulfild, die sechs Tage geweint hatte, daß sie an einen zottigen Bär vermählt werden sollte, ließ ihren Trübsinn schwinden, als sie sahe, daß sie sich in den Armen eines jungen wohlgemachten Ritters befand, der so minniglich sie umfaßte und sie in einen herrlichen Palast einführte, wo ein glänzendes Brautgepränge ihrer wartete. Sie wurde von schönen Dirnen in Myrtenkränzen mit Gesang und Saitenspiel empfangen, ihrer ländlichen Kleidung entlediget, und mit königlichem Brautschmuck angetan. Ob sie gleich nicht eitel war, so konnte sie doch das geheime Entzücken über ihre Wohlgestalt nicht verhehlen, da ihr die kristallenen Spiegel von allen Wänden des Brautgemachs tausend Schmeicheleien sagten. Ein splendides Gastmahl folgte auf die Vermählungszeremonie, und ein glänzender Ball Paré beschloß die Feierlichkeit des festlichen Tages. Die reizende Braut atmete Wonne und Seligkeit in den Gefühlen der Liebe, die an ihrem Brauttage nach der Sitte der keuschen Vorwelt sich zum erstenmal in ihrem jungfräulichen Herzen regten, und das widernde Bärenideal war ganz aus ihrer Phantasie verdrungen. In der Mitternachtstunde wurde sie von ihrem Gemahl mit Pomp in die Brautkammer eingeführt, wo alle Liebesgötter im Plafond von Freude belebt ihre goldnen Flügel zu regen schienen, da das liebende Paar hineintrat. – Der süßeste Morgentraum schwand eben dahin, als die Neuvermählte erwachte und ihren Gemahl mit einem liebevollen Kuß gleichfalls aus dem Schlafe zu wecken vorhatte; wie groß war ihr Erstaunen, da sie ihn nicht an ihrer Seite fand, und den seidenen Vorhang aufhebend, sich in ein düster Kellergewölbe versetzt sahe, wo das gebrochene Tageslicht durch den Eingang hineinfiel und nur so viel Hellung gab, daß sie einen furchterweckenden Bär wahrnehmen konnte, der aus einem Winkel hervor trübsinnig nach ihr hinblickte.
Sie sank auf ihr Lager zurück, und starb vor Entsetzen hin. Nach einer langen Pause kam sie erst wieder zu sich und sammelte so viel Kräfte, eine laute Klage anzuheben, welche die krächzenden Stimmen von hundert Eulen außerhalb der Höhle beantworteten. Der empfindsame Bär konnt's nicht aushalten, diese Jammerszene mit anzusehen, er mußte hinaus unter Gottes freien Himmel, den Schmerz und Unwillen über sein hartes Schicksal auszukeuchen. Schwerfällig hob er sich vom Lager und zottete brummend in den Wald, aus welchem er nicht eher als am siebenten Tage kurz vor der Verwandlung zurückkehrte. Die sechs traurigen Tage wurden der untröstbaren Dame zu Jahren. Über der hochzeitlichen Freude hatte man aus der Acht gelassen, die Bettlade der Braut mit einigen Lebensmitteln und Erfrischungen zu versehen, denn über alle leblosen Dinge, welche die schöne Wulfild unmittelbar berührte, hatte der Zauber keine Macht; aber ihr Gemahl würde auch selbst in ihren Umarmungen in der Stunde der Verwandlung zum Bären worden sein. In der Beklommenheit ihres Herzens schmachtete die Unglückliche zwei Tage dahin, ohne an Nahrungsmittel zu gedenken, endlich aber forderte die Natur die Mittel ihrer Erhaltung mit großem Ungestüm und erregte einen wilden Heißhunger, der sie aus der Höhle trieb, einige Nahrung zu suchen. Sie schöpfte mit der hohlen Hand ein wenig Wasser aus dem vorüberrieselnden Bächlein und erquickte damit ihre heißen trocknen Lippen, pflückte einige Hambutten und Brombeere, und verschlang in wilder Betäubung eine Handvoll Eicheln, die sie gierig auflas, und noch eine Schürze voll aus mechanischen Instinkt mit in die Höhle zurücknahm, denn um ihr Leben war sie wenig bekümmert: sie wünschte nichts sehnlicher als den Tod.
Mit diesem Wunsche schlief sie am Abend des sechsten Tages ein, und erwachte am frühen Morgen in eben dem Gemache wieder, in welches sie als Braut eingetreten war, sie fand da alles noch in der nämlichen Ordnung, wie sie es verlassen hatte, und den schönsten zärtlichsten Gemahl an ihrer Seite, der in den rührendsten Ausdrücken ihr sein Mitleid über den traurigen Zustand bezeigte, in welchen seine unwiderstehliche Liebe zu ihr, sie gebracht hätte, und sie mit Tränen in den Augen um Verzeihung bat; er erklärte ihr die Beschaffenheit des Zaubers, daß jeder siebente Tag solchen unwirksam mache, und alles in seiner natürlichen Gestalt darstelle. Wulfild wurde durch die Zärtlichkeit ihres Gemahls gerührt; sie bedachte, daß eine Ehe noch gut genug wäre, wo der siebente Tag immer heiter sei, und daß nur die glücklichsten der Ehen sich dieser Prärogative rühmen könnten; sie fand sich in ihr Schicksal, vergalt Liebe mit Liebe, und machte ihren Albert zum glücklichsten Bär unter der Sonne. Um nicht wieder in den Fall zu kommen, in der Waldhöhle zu darben, legte sie jederzeit, wenn sie zur Tafel ging, ein Paar weite Poschen an, diese belastete sie mit Konfekt, süßen Orangen und andern köstlichen Obst. Auch den gewöhnlichen Nachttrunk ihres Herrn, der ins Schlafgemach gestellt wurde, verbarg sie sorgfältig in ihrer Bettlade, und so war ihre Küche und Keller immer für die Zeit der Metamorphose zureichend bestellt. Einundzwanzig Jahr hatte sie bereits im Zauberwalde verlebt, und diese lange Zeit hatte keinen ihrer jugendlichen Reize verdrungen; auch war die wechselseitige Liebe des edlen Paares noch Gefühl des ersten mächtigen Instinkts. Die Mutter Natur behauptet aller anscheinenden Störungen ungeachtet allenthalben ihre Rechte, auch in der Zauberwelt wacht sie mit großer Sorgfalt und Strenge dafür, und wehret allem Fortschritt und den allmähligen Veränderungen der Zeit ab, solange durch die heterogenen Eingriffe der Zauberei die Dinge dieser Unterwelt ihrer Botmäßigkeit entzogen sind. Laut Zeugnis der heiligen Legende stiegen die frommen Siebenschläfer, nachdem sie ihren hundertjährigen Schlaf ausgeschlafen hatten, so munter und rüstig aus den römischen Katakomben hervor, wie sie hineingegangen waren, und hatten nur um eine einzige Nacht gealtert. Die schöne Wulfild hatte nach der Komputation der guten Mutter Natur, in den einundzwanzig Jahren nur drei Jahre verlebt, und befand sich noch in der vollen Blüte des weiblichen Alters. Eben diese Beschaffenheit hatte es auch mit ihren Gemahl und dem ganzen verzauberten Hofstaat.
Alles das eröffnete das edle Paar dem holden Ritter auf einer Promenade im Park, unter einer Laube, woran sich wilder Jasmin und Hills kletterndes Geißblatt zusammen verflochten. Der glückliche Tag schwand unter dem Gepränge einer bunten Hofgala und wechselseitigen Freundschaftsbezeugungen nur zu bald dahin. Man nahm das Mittagsmahl ein, nachher war Appartement und Spiel, ein Teil der Höflinge lustwandelten mit den Damen im Park, trieben Scherz und Minnespiel, bis man zur Abendtafel trompetete, wo in einer Spiegelgalerie unter Beleuchtung unzähliger Wachskerzen gespeiset wurde. Man aß, trank und war fröhlich bis zur Mitternachtsstunde, Wulfild versorgte nach Gewohnheit ihre Poschen und riet ihrem Bruder, seine Taschen auch nicht zu vergessen. Als abgetragen war, schien Albert unruhig zu werden, flüsterte seiner Gemahlin etwas ins Ohr, sie nahm darauf ihren Bruder beiseite und sprach wehmütig also: »Geliebter Bruder, wir müssen uns scheiden, die Stunde der Verwandlung ist nicht mehr fern, wo alle Freuden dieses Palastes hinschwinden; Albert ist um dich bekümmert, er fürchtet für dein Leben; er würde dem tierischen Instinkt nicht widerstehen können, dich zu zerreißen, wenn du die bevorstehende Katastrophe hier abwarten wolltest, verlaß diesen unglücklichen Wald und kehre nie wieder zu uns zurück.« »Ach«, erwiderte Reinald, »es begegne mir, was das Verhängnis über mich beschlossen hat, scheiden kann ich mich nicht von euch, ihr Lieben! Dich, o Schwester, aufzusuchen, war mein Beginnen, und da ich dich gefunden habe, verlaß ich diesen Wald nicht ohne dich. Sag, wie ich den mächtigen Zauber lösen kann?« »Ach«, sprach sie, »den vermag kein Sterblicher zu lösen!« Hier mischte sich Albert ins Gespräche, und wie er den kühnen Entschluß des jungen Ritters vernahm, mahnte er ihn mit liebreichen Worten von seinem Vorhaben so kräftig ab, daß dieser endlich dem Verlangen des Schwagers und den Bitten und Tränen der zärtlichen Schwester nachgeben, und zum Abschied sich bequemen mußte.