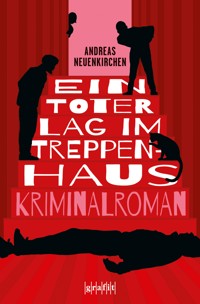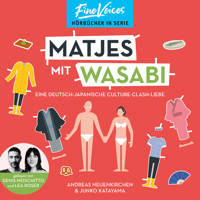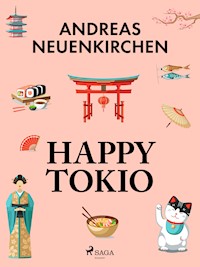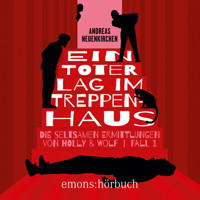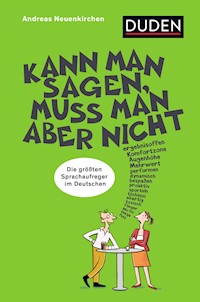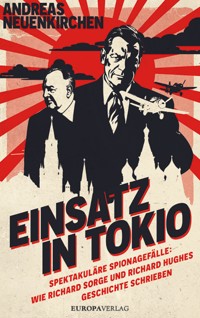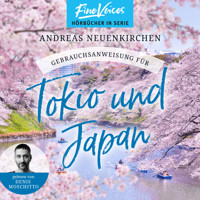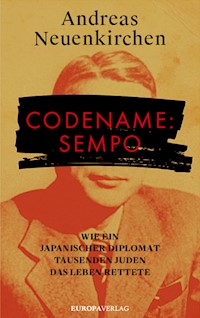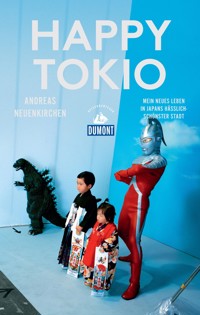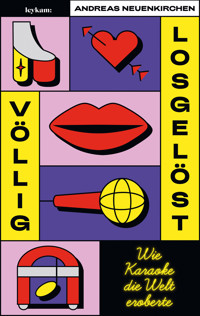
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hier kommt die mitreißende Popkultur-Story über das globale Mitsingen Karaoke ist mehr als nur ein Partyspaß – es ist ein weltweites Phänomen, das seit über fünf Jahrzehnten Menschen überall verbindet: ob in Kneipen, Wohnzimmern oder auf großen Bühnen. Aber wie konnte es zu der Mitsing-Manie kommen, die uns verleitet, auf musikalische oder oft sehr unmusikalische Weise unser Innerstes nach außen zu kehren? Andreas Neuenkirchen, Popkulturkenner und Japan-Experte, erzählt, wie ein musikbegeisterter (wenngleich nur durchschnittlich sangesbegabter) Ingenieur in seiner Werkstatt den Grundstein für die internationale Erfolgsgeschichte legte, wie seine Idee sich weltweit ausbreitete und warum wir Karaoke auch in Zukunft nicht loswerden. Mit Witz und Tiefe geht es dabei auch um die gesellschaftlichen Folgen – von handgreiflichen Auseinandersetzungen mit Todesfolge bis zur heilenden Kraft des Singens. Ein Muss für alle, die Popkultur lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Karaoke – Früher oder später erwischt es jeden
Hier kommt die mitreißende Popkultur-Story über das gemeinsame Singen. Karaoke ist mehr als nur ein Partyspaß – es ist ein Phänomen, das seit über fünf Jahrzehnten Menschen überall auf der Welt verbindet: ob in Kneipen, Wohnzimmern oder auf großen Bühnen.
Aber wie konnte es zu der Mitsing-Manie kommen, die uns verleitet, auf mehr oder weniger musikalische Weise unser Innerstes nach außen zu kehren? Andreas Neuenkirchen, Popkulturkenner und Japan-Experte, erzählt, wie ein musikbegeisterter und eher (durchschnittlich sangesbegabter) Ingenieur in seiner Werkstatt den Grundstein für die internationale Erfolgsgeschichte legte, wie seine Idee sich weltweit ausbreitete und warum wir Karaoke auch in Zukunft nicht loswerden. Mit Witz und Tiefe geht es dabei auch um die sozialen Folgen – von handgreiflichen Auseinandersetzungen mit Todesfolge bis zur heilenden Kraft des Singens.
Dieses Buch ist ein Muss für alle, die Popkultur lieben.
Über Andreas Neuenkirchen
Andreas Neuenkirchen, geboren in Bremen, arbeitet seit den frühen 90ern als Journalist, zunächst frei im Feuilleton Bremer Tageszeitungen und Stadtmagazine, später als Redakteur in München. Er ist der Autor mehrerer Sachbücher und Romane mit Japan-Bezug, darunter der Bestseller »Gebrauchsanweisung für Tokio und Japan« (Piper). Über japanische Pop- und Gegenwartskultur schrieb er unter anderem für Merian, The Japan Times und Tokyo Weekender. Andreas Neuenkirchen lebt mit seiner Familie in Tokio.
Bleiben wir im Gespräch:
In unserem Newsletter informieren wir über aktuelle Veranstaltungen unserer Autor*innen, neue Bücher und aktuelle Angebote. Hier geht es zur Anmeldung:https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter
leykam:seit1585
ANDREAS NEUENKIRCHEN
VÖLLIG LOSGELÖST
Wie Karaoke die Welt eroberte
Im Gedenken an Shigeichi Negishi (1923 – 2024).Thank you for the music.
Inhalt
Eines Nachts in Kobe, vor vielen Hundert Jahren in Wales
Herr Negishi singt bei der Arbeit
Draußen in den Lichtspielhäusern und daheim an den Empfangsgeräten
Kobe Beat
Der patente Herr Rosario
Beyond DiscoVision
Glory Days
Japan ist nicht genug
Karaoke, Mord & Todschlag
Singing in a Box
Warum singen?
Karaoke, Glaube, Volk und Nation
Karaoke-Storys
Zurück in den Äther
Gesang und Spiele und der Rest des Lebens
Hast du etwas Zeit für mich?
Danksagungen
Quellen
Biografie
Intro
Eines Nachts in Kobe, vor vielen Hundert Jahren in Wales
Einige erzählen sich, dass eines Nachts in der Stadt Kobe, es muss in den 1960ern gewesen sein, ein bereits engagierter Musiker einen Kneipier sitzen gelassen hatte und nicht zum vereinbarten Liederabend erschienen war. Aber der Wirt verzweifelte nicht. Er spielte populäre Gassenhauer von Tonbändern ab und animierte seine Kundschaft, selbst mitzusingen. Das gefiel allen Beteiligten so gut, dass sie es Nacht für Nacht wiederholten. Schließlich wollten die Gäste und Wirtsleute anderer Betriebe nicht außen vor bleiben und organisierten ähnliche Veranstaltungen. Karaoke war geboren.
Es gibt etliche solcher Legenden. Einige davon sind wahr. Diese ist es nicht. Etwas komplexer, technisch aufwendiger und gesellschaftlich widerstandsreicher war es dann schon. Doch ein Fünkchen Wahrheit steckt durchaus darin. Die Zeit kommt hin, der Ort ist nicht ganz verkehrt, und die Stimmung stimmt. In den 1960ern lag etwas in der japanischen Luft, und zwar Musik. Die ganz schweren Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg waren vorbei. Die Menschen hatten wieder ein wenig Geld, das sie in alkoholische Getränke investieren und in die Münzeinwürfe von Maschinen werfen konnten. Ihnen war wieder nach singen zumute, so, wie es in der japanischen Kultur und im japanischen Alltag eine jahrhundertealte Tradition war.
Das trifft natürlich nicht nur auf Japan zu. In Wales zum Beispiel wird schon so lange so inbrünstig gesungen, dass eine Tourismus-Website, die inzwischen leider vom Netz gegangen ist, Anfang des 21. Jahrhunderts behauptete, die Waliser*innen hätten in Wirklichkeit Karaoke erfunden: „Vor Hunderten und Hunderten von Jahren!“ Japan hätte lediglich die Technik modernisiert. Außerdem wurde kolportiert, die Menschen in Wales bräuchten im Gegensatz zu denen in Japan keinen Alkohol, um den Mut zum Singen zu finden.
Ob die Trinkgewohnheiten in Japan und Wales sich stark unterscheiden, sei dahingestellt. Richtig ist jedenfalls, dass die Geschichte von Karaoke eng mit der des öffentlichen Singens verknüpft ist. Und da muss sich Japan hinter keinem Land verstecken: Jede Firma und jede Schule hat ihre Hymne, jede Region ihre Regionalfeste mit Tanz und Gesang, und das Amateursingen zu professioneller Musikbegleitung hatte schon Tradition, lange bevor die technischen Rahmenbedingungen geschaffen waren, unter denen wir es heute Karaoke nennen.
Zwar gab es auch im ganz alten Europa bereits saisonale Feste, in denen fröhliche Lieder gesungen wurden, etwa zum Wechsel der Jahreszeiten. Diese wurden aber circa 130 n. Chr. durch christliche Lieder ersetzt, die meist auf Lateinisch waren und vom Großteil der Bevölkerung nicht verstanden wurden, weshalb sie jenen auch nur mäßig interessierten. Erst nach dem Jahr 1223, als in Italien die ersten Krippenspiele aufgeführt wurden, kamen volksnahe Weihnachtslieder auf. Rund 400 Jahre später wurden sie unter puritanischem Einfluss vielerorts wieder verboten, genau wie alle anderen Kirchenlieder. Oder Lieder im Allgemeinen.
Weltliche Gesangsvereine und -veranstaltungen blieben England und anderen Ländern derweil erhalten. So wurde das Singen zeitweise ein klar säkularer Akt. Es wurde oft an Orten praktiziert, an denen dem Alkohol und anderen weltlichen Freuden gefrönt wurde. Das war der Reputation des Gesangs nicht gerade zuträglich. Musik war in Europa über Jahrhunderte ein moralisches Problemthema. In Japan war das nie der Fall. Selbst wenn nicht gesungen wird, durchdringt die Musik den Alltag. Bahnhöfe haben Erkennungsmelodien, Blindenampeln pfeifen Lieder, und hätte der Rest der Welt sich ein Herz gefasst und bewusst von der Erfindung des Werbe-Jingles abgesehen, Japan hätte sich nicht zurückhalten können. Die akustischen Erkennungsmerkmale bekannter Marken sind dort genauso unverkennbar wie ihre optisch zu erfassenden Logos.
Wenn die Wales-Werbung auf die walisische Alleinstellung bei der Sangeslust hinweist, hat sie allerdings auch nicht unrecht. Zumindest mit einem eurozentrischen Blick. In Wales wurde bereits beim Gottesdienst gesungen, als in England und anderen Teilen Europas noch das Dogma galt, Kirchenlieder hätten in der Kirche nichts verloren. (Die ersten sogenannten Kirchenlieder, die mehr als sprechgesangliche Bearbeitungen von Psalmen waren, waren tatsächlich nur für den Privatgebrauch gedacht.)
Die Erfindung von Karaoke brauchte eine Gesellschaft, in der das Singen nie als etwas Frivoles galt, sondern stets einen festen, selbstverständlichen Platz im Alltagsleben hatte. Da hielt sich Wales in Europa, als Einäugiger unter den Blinden, nicht schlecht, doch war Japan wohl der bessere Nährboden. Hier hatten nie auch nur Diskussionen darüber stattgefunden, ob Gott der Gesang der Menschen gefalle oder er ihm ein Frevel sei. In den religiösen Erzählungen Japans spielen Musik und Gesang meist positive Rollen, und selbst als es unter gewissen Regimen verboten war, über bestimmte Themen zu sprechen, blieb den Mitteilungsfreudigen der Gesang als legales Schlupfloch.
Karaoke an sich ist weder religiös noch politisch (obwohl es mitunter von religiösen und politischen Organisationen für ihre Zwecke eingesetzt wird, im Osten wie im Westen). Genau deshalb konnte es nur in einem Land entstehen, in dem weder Religion noch Politik Probleme mit dem Singen aus reiner Freude hatten. Begünstigt war der Prozess von einer Zeit, in der die Menschen ohnehin gerade die Freude am Leben wiederentdeckten und sich erst mal mit angenehmeren Themen als Politik und Religion auseinandersetzen wollten, zumal sie mit beidem in jüngerer Vergangenheit keine allzu angenehmen Erfahrungen gemacht hatten.
Der Rest der Welt brauchte etwas länger, um Karaoke zu verstehen, kam ab den 1980ern aber auch dahinter. Anstatt den japanischen Brauch eins zu eins zu adaptieren, bildeten sich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Karaoke-Gepflogenheiten und -Sichtweisen. An manchen Orten wurde es reine Trash-Unterhaltung oder lebensnotwendiger Eskapismus, anderswo ein streng organisierter sportlicher Wettbewerb, hier und da auch ein ernsthaftes Karrieresprungbrett für die nächsten Generationen von Popstars. Aber eins ist fast überall gleich: Karaoke ist aus Alltag, Kunst und Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Seine über fünfzigjährige Geschichte ist eine Geschichte von genialen Außenseitern und skrupellosen Großkonzernen, von organisierten und unorganisierten Verbrechern, von Möchtegern- und Weltstars, alles zu einem Soundtrack von Sinatra bis Springsteen, mit K-Pop und J-Pop, Schlager und Punk. Und sie beginnt weder in Kobe noch in Wales, sondern in einem Vorort, der 1967 gerade noch zu Tokio gehörte.
Track 1
Herr Negishi singt bei der Arbeit
Shigeichi Negishi mochte zwei Dinge: Elektroteile und den Klang seiner Stimme. Mit letzterem gehörte er in seinem sozialen Umfeld einer Minderheit an. Die Angestellten seiner Firma meinten, ihr ständig singender Chef müsste sich selbst nur einmal so hören, wie sie ihn hörten, um zur Besinnung zu kommen. Auf den Gedanken folgten Taten. Und der Rest ist Karaoke.
ITABASHI, TOKIO, 1967
Mit 44 Jahren führte Shigeichi Negishi einen gut gehenden, selbst gegründeten Betrieb, der Elektronikteile für größere Unternehmen aus der Branche der Unterhaltungselektronik herstellte. Sein Weg dahin war kein geradliniger gewesen. Als junger Mann befand er sich mitten im Wirtschaftsstudium an der Hosei-Universität in Tokio, als er im Zweiten Weltkrieg an die Front berufen wurde. Der Krieg endete für ihn in einer zweijährigen Gefangenschaft in Singapur. Als er nach Japan zurückkehrte, verkaufte er zunächst Kameras für den namhaften Hersteller Olympus und versuchte sich, die Zeichen der Zeit erkennend, an Manga- und Anime-Merchandising. Einmal besuchte er das Mushi-Studio von Osamu Tezuka, dem Erfinder des modernen japanischen Comics, dessen Einfluss auf die japanische Gegenwartskultur mit dem von Walt Disney auf die amerikanische vergleichbar ist. Er wollte der Marketing-Abteilung die Rechte abluchsen, tragbare Radios mit der Tezuka-Figur Astro Boy zu verzieren, einer atombetriebenen Roboter-Version von Pinocchio. Die Verhandlungen verliefen anscheinend nicht zu Negishis Zufriedenheit. Dennoch war er fasziniert von dem, was er im Studio sah. Der mächtige Tezuka arbeitete auf einer Empore über allen anderen und ließ gelegentlich über ein komplexes Seilwindensystem Entwürfe zu seinen Assistenten herab, damit sie diese vervollständigten. Negishi war beeindruckt davon, wie der Künstler, der schon zu Lebzeiten der „Gott des Mangas“ genannt wurde, seinen Schaffensprozess organisiert und automatisiert hatte. Womöglich gab ihm das Ideen für seine eigene Firma, die er bald gründen sollte.
WAFFEN ZU RADIOTEILEN
Shigeichi Negishi wurde am 29. November 1923 in Itabashi geboren. Sein Vater war als Beamter in der Lokalpolitik involviert, seine Mutter führte einen Tabakladen. Als Kind war er eher den schönen Künsten und dem Kunsthandwerk zugetan. Er war bekannt für die Miniaturstädte, die er aus Papier baute. Mit elf hatte er einen landesweiten Kalligrafie-Wettbewerb gewonnen. Doch trotz dieser künstlerischen Ader schien ihm in seiner zweiten Lebenshälfte das Leben als Elektronikbastler und Aufseher von Elektronikbastlern zu genügen. Er war wieder an seinen Geburtsort zurückgekehrt, einem nördlichen Stadtteil Tokios. Der nahe gelegene Fluss Arakawa war für die fulminanten Feuerwerke bekannt, die im Sommer über ihm abgefeuert wurden, wie es in Japan Sitte ist (über Neujahr bleibt es eher ruhig und dunkel). Ansonsten war Itabashi für nicht viel bekannt. In den 1960ern war es von der pulsierenden Großstadt, zu der es offiziell gehörte, verkehrstechnisch noch abgetrennt. Es hatte womöglich mehr Ähnlichkeit mit der als verschlafen geltenden Präfektur Saitama, die gleich am anderen Ufer des Flusses begann und über die die vermeintlich mondäneren Tokioter so gerne Witze machten. Ein nennenswertes Nachtleben gab es in Itabashi nicht, hier wurde lediglich gewohnt und gearbeitet. Im 19. Jahrhundert war die Gegend noch landwirtschaftlich geprägt gewesen, im 20. siedelte sich die Industrie an. Vor allem die Rüstungsindustrie. Die Zerstörung der dortigen Waffen- und Munitionsfabrik durch amerikanische Bomberangriffe wurde als militärischer Meilenstein im Zweiten Weltkrieg angesehen. Nach der Kapitulation gründeten viele der ehemaligen Waffeningenieure Betriebe zur Fertigung von Radioteilen. So wurde Itabashi so etwas wie die industrielle Version von Akihabara, Tokios Hauptumschlagplatz von Elektronikgeräten seit den 1930ern, damals vor allem wegen seines lebhaften Schwarzmarkts.
Eine angemessene Menge an Amüsierbetrieben würde in Itabashi noch ein paar Jahrzehnte auf sich warten lassen, aber die Verschlafenheit des Ortes machte Negishi offenbar nichts aus. Er hatte womöglich im Krieg und in der Gefangenschaft genügend Aufregung gehabt. Zu seinen kleinen Freuden gehörte das Mitsingen populärer Melodien, die in der Radiosendung Popsongs ohne Gesang gespielt wurden. Dieses Rundfunk-Konzept war nicht allein in Japan bekannt, und natürlich hat es seinen ganz eigenen Platz in der (Vor-)Geschichte des Karaoke.
Negishis Firma, Nichiden Kogyo, war eine von vielen vor Ort, die Komponenten herstellte, die dann in den Geräten größerer Unternehmen verbaut wurden. Sie war in erster Linie auf die Herstellung von 8-Spur-Tonbandgeräten für Autoradios spezialisiert. Eine Technologie, die in der Entwicklung des Karaoke eine entscheidende Rolle spielen sollte. In Autoradios lösten die Geräte damals die Plattenspieler ab. Richtig gelesen: Vor dem kompakten 8-Spur-Tonband wurde in besonders nobel ausgestatteten Straßenkreuzern tatsächlich Musik vom Plattenteller gehört. Man durfte nur nicht über Hubbel fahren, scharf bremsen oder mit Schwung in die Kurve gehen. Da sich aber das eine oder andere im Straßenverkehr kaum vermeiden ließ, setzte sich Vinyl im Kraftfahrzeug nie im ganz großen Stil durch.
Negishi hatte mit den Tonbandgeräten auf das richtige Pferd gesetzt. Seine Geschäfte liefen gut. Er beschäftigte rund achtzig Techniker und Ingenieure. Bei seinen Mitarbeitern war er beliebt. Wenn er nicht gerade sang. Als er seinem Hobby eines Morgens wieder in Hörweite anderer nachging, zog er den Spott des obersten Ingenieurs auf sich. Negishi fragte sich, warum seine eigene Wahrnehmung seines süßen Gesangs sich von der anderer so sehr unterschied. Den Ingenieur fragte er: „Wäre es möglich, ein Mikrofon an ein Tonbandgerät anzuschließen, damit ich mich beim Singen der Nummern von Popsongs ohne Gesang aufnehmen kann?“
Damit rannte er bei ihm offene Türen ein. Drei Tage später stand das Ergebnis auf Negishis Schreibtisch. Der Ingenieur hatte einen Mikrofonverstärker über einen Mischerkreis mit einem 8-Spur-Tonbandgerät verbunden. Der Kasten war offen, offenbarte ein rechtes Kabelgewirr. Negishi schaltete ihn an und fütterte ihn mit einer Aufnahme des Schlagers „Mujo no Yume“ (Der herzlose Traum), einem Evergreens aus den 1930ern. Die Melodie setzte ein … Negishis Gesang setzte ein … es war in seinen Ohren nach wie vor eine perfekte Harmonie! Und es war die erste echte Karaoke-Darbietung in der Geschichte der Menschheit.
„Es funktioniert!“, war Negishis erster Gedanke. „Das macht Spaß!“, war sein zweiter. Sein dritter könnte gewesen sein: „Damit lässt sich bestimmt Geld machen.“ Also bat er seinen Ingenieur, den Kabelwust mit einem geschlossenen Gehäuse zu kaschieren und das Ganze mit einem Münzeinwurf zu versehen, der in der Werkstatt gerade ohne Bestimmung herumlag.
AM ANFANG WAR DIE SPARKO BOX
Der Ingenieur machte sich erneut an die Arbeit und kam schließlich mit einem würfelförmigen Kasten zurück, der auf jeder Seite knapp einen halben Meter maß, an den Rändern Chromleisten hatte und auf den meisten Flächen mit beigem Laminat verkleidet war. Es gab ein rechteckiges Fach für Tonbänder, einen Mikrofonanschluss und neben dem wichtigen Münzeinwurf Knöpfe, mit denen sich Lautstärke, Balance und Tonhöhe regeln ließen. Die Front verzierte eine durchsichtige, geriffelte Plastikscheibe, hinter der dekorative Glühbirnchen in verschiedenen Farben im Takt der Musik blinkten.
Negishi sah, dass es gut war, und taufte den Kasten auf den Namen Sparko Box, nach dem Englischen to sparkle (funkeln). Diese Idee kam ihm von der Plastikscheiben/Glühbirnen-Applikation an der Front, einer seiner früheren Erfindungen, für die er nun endlich, integriert in eine andere Erfindung, eine Verwendung gefunden hatte.
Begeistert brachte Negishi die Sparko Box am Abend nach Hause, um sie an seiner Frau und seinen drei Kindern auszuprobieren. Seine Tochter, damals im popmusikanfälligen Teenager-Alter, war geradezu schockiert von der Erfahrung, ihre eigene Stimme über Lautsprecher und zu musikalischer Begleitung zu hören. Aber sie konnte nicht genug davon bekommen.
Obgleich Shigeichi Negishi die historische Tragweite seiner Erfindung nicht absehen konnte, war er sich durchaus bewusst, dass da etwas in seiner Küche stand, das zu schade für seinen Küchentisch allein war. Als Leiter einer Firma, die mit Führenden der Unterhaltungselektronik-Branche gemeinsame Sache machte, war er in geschäftlichen Dingen nicht völlig unbeleckt. Dennoch fehlte es ihm an Erfahrung, Artikel selbst an Endkunden zu vertreiben. Sein Unternehmen stellte Produkte her, die von anderen Unternehmen als Teile ihrer Produkte vertrieben wurden.
Er versuchte trotzdem sein Bestes. Er druckte Text- und Notenblätter und band sie zu Büchlein, um den neuen Zeitvertreib zugänglich zu machen. Wichtiger als die Textsicherheit seiner potenziellen Kund*innen war allerdings, dass er überhaupt Musik hatte, die er mit der Sparko Box verkaufen konnte. Er wandte sich an einen Bekannten, der als Toningenieur bei der Japanischen Rundfunkgesellschaft NHK (Nippon Hōsō Kyōkai) arbeitete. Der raunte ihm zu: „Was du brauchst, sind Karaoke-Bänder.“ Dieses Wort hörte er zum ersten Mal.
ALS KARAOKE NOCH PROFI-SACHE WAR
Der Begriff „Karaoke“ war ein Fachterminus aus der Rundfunkwelt. Wenn Fernseh- oder Radiosender ihre Stars zu Auftritten auf das Land schickten, war es normalerweise zu aufwendig, eine ganze Band oder gar ein Orchester einzupacken. Also wurden die Instrumentalparts der Lieder vorab eingespielt. Keine japanische Besonderheit. „Halb-Playback“ nannte Dieter Thomas Heck das Prinzip kurze Zeit später bei der Erstausstrahlung der ZDF-Hitparade im Jahr 1969.
Wörtlich bedeutet Karaoke „leeres Orchesterr“, vom japanischen kara (leer) und einer Abkürzung des Lehnworts okesutora (einer Japanifizierung des englischen orchestra). Das kara ist dasselbe wie in Karate (leere Hand), einem weiteren japanischen Exportschlager, obwohl dort das kara üblicherweise mit dem properen Schriftzeichen 空 geschrieben wird, während für Karaoke die Silbenschrift Katakana verwendet wird, die unter anderem Lehnwörtern vorbehalten ist: カラ (ka ra) オケ (o ke). Das Wort gefiel Negishi so sehr, dass er überlegte, seine Erfindung umzutaufen. Doch als er einen Vertriebspartner für sein Gerät fand, intervenierte dieser. Das klänge zu sehr nach Sarg (kan’oke), fand er. „Sparko Box“ andererseits war dem gemeinen Volk womöglich schwer vermittelbar. So machte der Prototyp zunächst unter unterschiedlichen Bezeichnungen wie „Music Box“, „Night Stereo“ oder „Mini Jukebox“ die Runde.
Neben dem Namen stellte die Beschaffung des musikalischen Materials weiterhin eine gewisse Schwierigkeit dar. Negishi hatte einige Bänder von seinem Kontakt bei NHK erhalten, doch die Musik gehörte der Rundfunkanstalt. Die konnte er nicht verwenden, sollte er seine Musikbox wirklich im größeren Stil vermarkten.
Glücklicherweise war der Musikmarkt damals noch nicht so streng reglementiert wie heute. Negishi wandte sich an einen Freund, dessen Betrieb Tonbänder vervielfältigte. Darunter waren viele Instrumentalaufnahmen bekannter Lieder, die an Tanzlokale verkauft wurden, wo professionelle Sänger*innen live vor Ort den Gesang beisteuerten. Außerdem waren sie beliebt bei Privatkund*innen, die einfach zu Hause gerne sangen. Menschen also, die bereits Karaoke praktizierten, bevor es Karaoke gab. Negishi war mit seiner Marotte nicht allein. Sein Tonbänder bespielender Freund hatte nichts dagegen, dass er die Aufnahmen für seine Box verwendete. Das reichte dem Sparko-Erfinder als rechtliche Absicherung. Streng genommen hätte er selbstverständlich auch damals schon die Urheber*innen der Songs um Erlaubnis fragen müssen, doch das wurde da noch nicht ganz so verbissen gesehen.
Negishi tingelte mit seinem Konzept durch die Kneipen. Es kam hervorragend an. Wer bislang in der Öffentlichkeit zu musikalischer Begleitung singen wollte, musste sich an professionelle Musiker*innen wenden, die in jenen Jahren zu diesem Zweck tatsächlich durch die Gastronomie streiften. Sie rührten ihre Finger allerdings erst ab einer Gage von mindestens 1.000 Yen und spielten dafür eine Handvoll Lieder. Die neue Maschine hingegen wollte nur 100 Yen (zu jener Zeit immerhin der Preis von drei bis vier Getränken) für „ungefähr 10 Minuten“, wie es die Beschriftung über dem Münzeinwurf versprach, und nahm an der Theke weniger Platz weg als ein*e Musikant*in aus Fleisch und Blut.
Die Kund*innen waren begeistert. Die Wirt*innen waren begeistert. Die Musiker*innen waren nicht begeistert. Sie übten Druck auf die Wirt*innen aus, und so hörte Negishi häufig als Rückmeldung nach seinen Veranstaltungen: „Unsere Kundschaft konnte gar nicht genug davon bekommen, bitte kommen Sie nie wieder.“
Diese spezielle Art von Musiker*innen, auf die Negishi noch spät im Leben nicht gut zu sprechen sein würde, wurden als Nagashi (Herumtreiber) bezeichnet. Laut Negishi waren sie organisiert wie Verbrecherbanden und traten ähnlich resolut auf. Überall, wo der Erfinder aus Tokio seine Box aufstellte, tauchten Nagashi auf und übten Druck auf die Betreiber*innen aus, die Boxen wieder einzupacken. Das war nicht nur in Tokio der Fall, sondern auch in Orten wie Osaka oder dem nördlichen Akita, wo der Erfinder mit der Sparko Box ebenfalls sein Glück versuchte. Shigeichi Negishis Musiktruhe konnte sich trotz aller Begeisterung beim singfreudigen Volk nirgends etablieren. Zumindest nicht in dem Sinne, in dem sie gedacht war.
KEINE CHANCE FÜR DIE LIEBE?
Willige und dauerhafte Abnehmer*innen fand sie lediglich in der Hotelbranche. Genauer in der Love-Hotel-Branche. In Japan lebten meist mehrere Generationen unter einem Dach, und die Wände bestanden häufig noch aus Papier. Daher waren die Stundenhotels nahezu alternativlos, wenn liebenden oder bloß lüsternen Paaren der Sinn nach ein bisschen intimer Zweisamkeit stand. Dass sie einander vor dem Akt etwas vorsängen, wäre nun allerdings eine allzu romantische Vorstellung. Was die Sparko Box für Love-Hotel-Zimmer prädestinierte, waren ihre hübschen, bunt blinkenden Lichter. Die Häuser versuchten sich mit überkandidelten Einrichtungsideen zu übertrumpfen, und Negishis Glitzerkasten passte da gut rein.
So hatte sich der Erfinder das nicht vorgestellt. Er nahm die Einnahmen aus dem Love-Hotel-Gewerbe gerne mit, doch sein Enthusiasmus für die Sache schwand. Laut eigenen Aussagen diskutierte er mit seinem Vertriebspartner eine Patentierung der Box, aber man entschied sich gemeinsam dagegen. Erstens war der Prozess langwierig und kostenintensiv. Zweitens waren die Erfolgsaussichten angesichts des heftigen Widerstands der Nagashi auch auf lange Sicht äußerst gering. Und drittens: Wozu überhaupt ein Patent? Es war nicht so, dass sie irgendwelche Konkurrenten hätten. Das meinten sie zumindest …
Negishi kam zu der Erkenntnis, dass seine Erfindung vielleicht doch nicht die Massen derart bewegen würde, wie sie seine Familie daheim am Küchentisch bewegt hatte. 1975 gab er die Sache auf und wandte sich wieder seinem Kerngeschäft zu, nachdem sein Geschäftspartner bereits zwei Jahre zuvor das Handtuch geworfen hatte. Bis dahin hatte er 8.000 Sparko Boxen verkauft. Wie viele davon in Love-Hotels stumm nackte Pobacken beleuchteten, ist nicht aufgeschlüsselt.
Sein Rückzug aus dem Karaoke-Geschäft bedeutete nicht, dass er sich nicht hin und wieder von neuen, innovativen Ideen zu nebenerwerblichen Ausflügen hinreißen ließ. Unter anderem ging er mit einem elektronisch sprechenden buddhistischen Gebetsbuch hausieren. Es ist nicht bekannt, ob er das Unterfangen auf Druck zorniger buddhistischer Priester wieder einstellte. (Zuzutrauen wäre es ihnen. Der Buddhismus geriert sich in Asien oft ruppiger, als Buddhist*innen im Westen es hören mögen.)
Dass Negishi seine Sparko Box nicht zum Patent anmeldete, ist trotz der nachvollziehbaren Begründung ungewöhnlich. Er war diesem Vorgang gegenüber keineswegs grundsätzlich abgeneigt. Diverse Patente liefen bereits unter seinem Namen. Fast möchte man meinen, dass keine Idee unpatentiert seine Werkstatt verließ. Zu seinen Erfindungen gehört unter anderem ein Farbball, mit dem Angestellte von Banken und Geschäften Räuber und Diebe bewerfen können, um sie für den leichteren Polizeizugriff farblich zu markieren. Diese Kugeln sind noch heute im Einsatz.