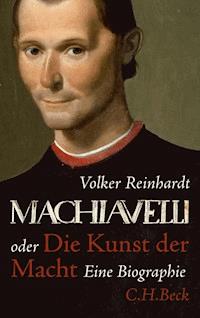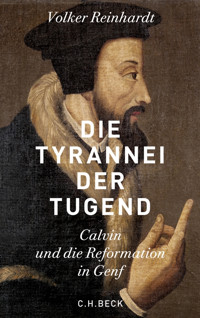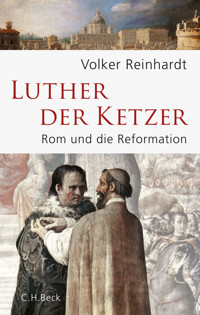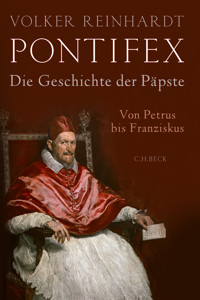24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Philosoph, Aufklärer und Spötter Voltaire (1694 – 1778) hat unzählige Briefe, Dramen, sarkastische Gedichte, philosophische Erzählungen und weltgeschichtliche Abhandlungen hinterlassen und ist doch ein großer Unbekannter. Volker Reinhardt erzählt fesselnd von einem Literaten, der sich an einer staatlichen Lotterie bereicherte, über die Mächtigen und Etablierten spottete, die Hofgesellschaften in Versailles und Potsdam provozierte, sich virtuos zu tarnen verstand und schließlich in Ferney sein eigenes Reich schuf. Voltaires abenteuerliches Leben ist, wie seine Werke, ein eindrucksvolles Manifest für die Freiheit in einer autoritätsgläubigen Welt. Voltaire ist ein Monument der Aufklärung, verewigt im Panthéon, verhasst als Zerstörer aller etablierten Ordnung. Sein «Traktat über die Toleranz» war nach den Anschlägen auf «Charlie Hebdo» 2015 eines der meistverkauften Bücher Frankreichs. Und doch ist der große Philosoph ein Unbekannter. Volker Reinhardt hat das riesige Oeuvre und die Quellen neu gelesen und entdeckt einen Lebenskünstler, der seine Fluchtwege immer im Blick hatte. Voltaire wurde reich, weil er eine Lotterie austrickste, erforschte zusammen mit einer Physikerin die Natur, düpierte die Versailler Hofgesellschaft, verärgerte Friedrich den Großen, kämpfte gegen die verlogene Kirche, deckte Justizskandale auf, warb der Stadt Genf für sein eigenes kleines Reich die Uhrmacher ab und verfolgte Rousseau mit grenzenlosem Sarkasmus. Volker Reinhardt erzählt von einem Abenteurer der Freiheit, der in einer Welt voller Krisen mit scharfem Verstand, beißendem Spott und menschenfreundlicher Toleranz seinen Garten bestellte und unserer eigenen Zeit den Spiegel vorhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Volker Reinhardt
VOLTAIRE
Die Abenteuer der Freiheit
Eine Biographie
C.H.Beck
Voltaire im Alter von etwa vierundzwanzig Jahren, Gemälde von Nicolas de Largillière.
Zum Buch
Der Philosoph, Aufklärer und Spötter Voltaire (1694–1778) hat unzählige Briefe, Dramen, sarkastische Gedichte, philosophische Erzählungen und weltgeschichtliche Abhandlungen hinterlassen und ist doch ein großer Unbekannter. Volker Reinhardt hat das riesige Oeuvre und die Quellen neu gelesen und entdeckt einen Lebenskünstler, der seine Fluchtwege immer im Blick hatte. Voltaire wurde reich, weil er eine Lotterie austrickste, erforschte zusammen mit einer Physikerin die Natur, düpierte die Versailler Hofgesellschaft, verärgerte Friedrich den Großen, kämpfte gegen die verlogene Kirche, deckte Justizskandale auf, warb der Stadt Genf für sein eigenes kleines Reich die Uhrmacher ab und verfolgte Rousseau mit grenzenlosem Sarkasmus. Das glänzend geschriebene Buch erzählt von einem Abenteurer der Freiheit, der in einer Welt voller Krisen mit scharfem Verstand, beißendem Spott und menschenfreundlicher Toleranz seinen Garten bestellte und unserer eigenen Zeit den Spiegel vorhält.
Über den Autor
Volker Reinhardt ist Professor für Geschichte an der Universität Fribourg. Bei C.H.Beck erschienen von ihm zuletzt der Bestseller «Die Macht der Seuche» (3. Aufl. 2021) sowie das viel gerühmte Buch «Die Macht der Schönheit. Kulturgeschichte Italiens» (3. Aufl. 2020). Für sein Lebenswerk wurde er 2020 mit dem Preis der Kythera-Kulturstiftung ausgezeichnet.
Inhalt
EINLEITUNG: Warum Voltaire?
ERSTES KAPITEL: AUF DEM WEGZUM EIGENEN NAMEN – 1694–1718
Das Spiel mit Geburt und Herkunft
Der fromme große Bruder und die freigeistige «Lebedame»
Auf dem Jesuitenkolleg Louis-le-Grand: Früher Ruhm und subversiver Spott
Lehrjahre bei Juristen und Libertins
«Ödipus»: Ein sehr persönliches Drama mit politischer Botschaft
Auf Konfrontationskurs mit dem Regenten: Verbannung in die Provinz und Bastille
ZWEITES KAPITEL: AM HOF UND IM EXIL – 1718–1728
Von Arouet zu Voltaire und die Entstehung der «Henriade»
Das Epos vom guten König
Viel Theater, ein nobles Leben und ein krachender Misserfolg
Ein diskriminierendes Testament, erfolglose Spitzeldienste, schmachvolle Stockschläge
Mit Madame de Rupelmonde in den Niederlanden: Erste Ketzereien
Skandale, Erfolge, Demütigungen – auf der Bühne und hinter der Bühne
Ein Überfall, erneut die Bastille und das Exil in England
Börse, Shakespeare, Newton: Von England lernen heißt Fortschritt lernen
Briefe aus England I: Religion und Kirche
Briefe aus England II: Politik und Kultur
DRITTES KAPITEL: AUF DER SUCHE NACH REICHTUM UND RUHM – 1728–1734
Rückkehr nach Frankreich: Neue Gesundheit, neues Geld, neue Kämpfe
Ein Drama über Brutus, eine Biographie Karls XII. von Schweden und erneute Reflexionen über das Theater
Zwei Dramen im Banne Shakespeares
Große Gefühle in Zaïre, ätzende Satire über Kollegen
Lob für Newton, Kritik an Descartes, Widerlegung Pascals und ein zweites Rührstück
Der Kampf um die «Philosophischen Briefe»
VIERTES KAPITEL: DER HOMME DE LETTRES UND DIE MATHEMATIKERIN – 1734–1749
Flucht nach Cirey, ein Ausflug an den Rhein und eine Verbeugung vor Thron und Altar
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit Emilie du Châtelet und ein Rührstück für die Frommen
Lob des Luxus und metaphysische Fragen
Der preußische Kronprinz, der homme de lettres und die Mathematikerin
Newtons Physik, ein allmächtiger Gott und literarische Querelen
Ein Drama voller Rosenwasser und die Publikation von Friedrichs Anti-Machiavel
Ernüchternde Erfahrungen in Preußen und Rückkehr zu Emilie
«Mahomet», das Drama des Fanatismus, und neue Schmeicheleien für den preußischen König
Kniefälle vor der Académie française, Spaßmacher in Potsdam
Hofdichter und Hofnarr im Bündnis mit Madame de Pompadour
Die Aufnahme in die Akademie und der Streit mit Friedrich II. von Preußen über den Krieg
Eine Auszeit in Lothringen und Emilies letzte Liebe
Zwei Erzählungen voller Ironie und Optimismus
Tod im Kindbett
FÜNFTES KAPITEL: AM HOF DES KRIEGERKÖNIGS – 1750–1752
Trauer um Emilie, erfolglose Dramen und der Weg nach Potsdam
Im Haifischbecken der Hofgesellschaft, auf dem Glatteis der Hirschel-Affäre
Spott über Maupertuis und die Berliner Akademie
Nur für Eingeweihte: Was wirklich von der Religion zu halten ist
Die neue Geschichtsschreibung I: Die List der Vernunft im Zeitalter Ludwigs XIV.
Die neue Geschichtsschreibung II: «Le siècle de Louis XIV» als politisches Manifest
Die Deutschlandreise und ihr jähes Ende
SECHSTES KAPITEL: ZWISCHENSPIEL IM ELSASS UND IN GENF – 1753–1758
Die Misere der deutschen Geschichte und die Heilkraft der Bäder
Ein Herrenhaus vor den Toren Genfs
Ein entzückender Garten und ein unerwarteter Rivale
Das Erdbeben von Lissabon, ein Lehrgedicht über die Katastrophe und eine Debatte mit Rousseau
Entfremdung von Genf und philosophische Dialoge
Ein universalgeschichtliches Sittengemälde: Die Nationen der Welt und die Besonderheit der Juden
Im Siebenjährigen Krieg zwischen allen Stühlen
Diderot, Genf und die Encyclopédie
«Candide»: Ein charmanter Blick in den Abgrund
SIEBTES KAPITEL: DER PATRIARCH VON FERNEY – 1759–1766
Zwei Landgüter für die Freiheit und die Polemik
Gefällige Schriften, gutsherrliche Wohltaten
Gegen den «verrückten Jean-Jacques» und andere Unvernunft
Die Affäre Calas oder Die Aufdeckung eines Justizmordes
Der Traktat über die Toleranz und das Bekenntnis des atheistischen Dorfpfarrers Jean Meslier
«Die Jungfrau von Orléans»: Spott über die «Infame»
Das «Dictionnaire philosophique»: Wut und Empörung der alten Eliten
Leben und Schreiben auf Schloss Ferney
Der Fall Sirven: Die Öffentlichkeit als mächtige Richterin
ACHTES KAPITEL: LETZTE KÄMPFE FÜR EHRE, VERNUNFT UND FREIHEIT – 1767–1778
Spott über Genf, Hass auf Rousseau, Satiren auf das Ancien Régime
Subversive Novellen und Schulnoten für die europäischen Länder
Kurze Trennung von Madame Denis und eine fromme Inszenierung in Ferney
Ein literarisches Trommelfeuer mit Pamphleten, Tragödien, Satiren
Neue Attacken gegen alte Feinde und ein Dorf der Toleranz
Die Maupeou-Revolution, ihr Scheitern und die Uhrmacher von Ferney
Die großen alten Fragen zu Gott, den Menschen und zur Politik
Die Tribute des Alters und ein Totengebet in eigener Sache
Für die Reformen Turgots
Eine letzte Bilanz und ein ausbleibender Kaiser
SCHLUSS: DAS ENDE IN PARIS UND DER ANFANG DER UNSTERBLICHKEIT
Anhang
Zeittafel
Anmerkungen
ERSTES KAPITELAuf dem Weg zum eigenen Namen
ZWEITES KAPITELAm Hof und im Exil
DRITTES KAPITELAuf der Suche nach Reichtum und Ruhm
VIERTES KAPITELDer homme de lettres und die Mathematikerin
FÜNFTES KAPITELAm Hof des Kriegerkönigs
SECHSTES KAPITELZwischenspiel im Elsass und in Genf
SIEBTES KAPITELDer Patriarch von Ferney
ACHTES KAPITELLetzte Kämpfe für Ehre, Vernunft und Freiheit
SCHLUSSDas Ende in Paris und der Anfang der Unsterblichkeit
Literatur
1. Quellen
2. Biographische Literatur (Auswahl)
Bildnachweis
Personenregister
«Die Natur hat den Menschen Mitgefühl und Neigung zu ihresgleichen mitgegeben. Wenn diese guten Anlagen von einem aufgeklärten Verstand angeführt werden, werden wir die Laster und die Verbrechen überwinden können. Uns kann es egal sein, ob alles gut ist, vorausgesetzt, wir wirken dafür, dass alles besser wird, als es vorher war.»
Voltaire, Avertissement zum
«Gedicht über das Erdbeben von Lissabon»
EINLEITUNG
Warum Voltaire?
Nach dem islamistischen Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 hielten Demonstranten Schilder hoch, auf denen nur ein Name stand: Voltaire. Dieser Name war ein Programm mit konkreten Forderungen: uneingeschränkte Denk-, Meinungs- und Publizierfreiheit und damit das Recht, alle Ideologien und Glaubenssysteme öffentlich zu hinterfragen, zu widerlegen und gegebenenfalls zu verspotten. Allerdings ist zweifelhaft, ob diese Botschaft, die durch Fernsehbilder um die Welt ging, bei denen ankam, an die sie gerichtet war. Die meisten Zuschauer dürften sich stattdessen gefragt haben: Wer war Voltaire, und was hatte er mit dem blutigen Attentat zu tun? Wer um dieselbe Zeit im Souvenirshop des Pariser Panthéon, wo Voltaire im Juli 1791 von den französischen Revolutionären eine pompöse Ehrengrabstätte erhielt, eine Gipsbüste von ihm verlangte, wurde enttäuscht: Produktion mangels Nachfrage eingestellt. Der Aufruf und das Desinteresse zeigen eine Diskrepanz: Voltaire steht für eine Weltsicht und ein Wertesystem, ja sogar für eine ganze Epoche – das achtzehnte Jahrhundert wird in Frankreich auch le siècle de Voltaire, «das Jahrhundert Voltaires», genannt. Trotzdem ist er heute nicht mehr wirklich präsent. Damit ist das Anliegen dieser Biographie umrissen: Sie will den historischen Voltaire, das heißt Voltaire in seiner Zeit und in der Auseinandersetzung mit seiner Zeit hinter allen plakativen Vereinnahmungen und Entstellungen vor Augen führen und ihn so für die Gegenwart zurückgewinnen. Zu entdecken ist ein lebenslanger Provokateur, der mit Spott und Scharfsinn alle scheinbaren Gewissheiten infrage stellt, dem man deshalb Zersetzung vorgeworfen hat, der aber stets auf konstruktive Weise verneint.
Ein weiterer Vorwurf gegen Voltaire, speziell aus dem theorieverliebten Deutschland, lautet seit jeher: Er hat alle philosophischen Systeme zerstört, aber kein eigenes System begründet. Gerade darin aber liegt die Größe Voltaires und seine Aktualität für die Gegenwart: Er fragt nicht, welches der beste Staat ist, sondern hinterfragt Entwürfe und Träume von «besten Staaten». Wem nützt diese Staatsform und warum, für welche Gesellschaft und welche Kulturstufe ist sie tauglich, und wie lange wird sie voraussichtlich Bestand haben? Für Voltaire ist alles Bestehende ein Provisorium, das stets mit seiner Abschaffung im Namen der Vernunft zu rechnen hat. Allein die absolute Freiheit, alles, auch das angeblich Undenkbare, zu denken und zu sagen, muss von Dauer sein.
In diesem Zeichen steht Voltaires Textproduktion, die an Menge, Vielfalt der Genres, Breite der Themen, Virtuosität der Stilformen und Vehemenz der Polemik ihresgleichen sucht. Fast fünfzig Theaterstücke decken die ganze Bandbreite vom blutrünstigen Drama bis zur leichtgeschürzten, sketchartigen Komödie ab. Von den beiden umfangreichen Versepen ist das eine von hohem Pathos beseelt, während das andere von ätzendem Hohn durchtränkt ist. Unter den fünf monumentalen Geschichtswerken findet sich eine Gesamtdarstellung der menschlichen Zivilisationsgeschichte von den Uranfängen bis zum siebzehnten Jahrhundert. Die zahlreichen «philosophischen» Novellen decken unter einer oft märchenhaften Einkleidung die Widersprüche der menschlichen Lebensbedingungen erbarmungslos auf. Hunderte von Kampfschriften fordern im Namen der Aufklärung Toleranz und radikale Veränderungen in allen Lebensbereichen. Und schließlich sind weit mehr als 20.000 Briefe erhalten, die nicht nur das eigene Leben, oft ironisch gebrochen, reflektieren, sondern auch das Zeitgeschehen perspektivenreich kommentieren.
Von diesem gigantischen Œuvre ist heute nur noch ein einziger Satz im kollektiven Gedächtnis abgespeichert: «Wir müssen unseren Garten bestellen», verkündet Candide, der Protagonist der gleichnamigen Novelle, als Fazit einer bewegten Lebensfahrt. Doch das ist nicht als platte Lebensweisheit gemeint, die uns alle zu selbstzufriedenen Kleingärtnern machen soll. Es ist vielmehr ein Schlussstrich unter eine nachtschwarze Weltdiagnose, nach der der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Das gilt auch für die wenigen Überlebenden, die sich, seelisch und körperlich schwer beschädigt, auf ihre kleine Insel im Bosporus gerettet haben. Die Fähigkeit zum reinen Glück ist dem Menschen nicht gegeben, umso mehr muss er danach streben, seine Lebensumstände Schritt für Schritt zu verbessern. Voltaire hat im letzten Drittel seines Lebens selbst große Gärten gepflegt und dort sogar Blumenzwiebeln gepflanzt. Doch auch seine Gärten waren von Idylle weit entfernt. Was an seinen Wohnstätten für ihn am meisten zählte, waren die Fluchtwege. Für seine Bewunderer in der aufgeklärten Öffentlichkeit Europas war Voltaire vieles: der mutige Kämpfer gegen den Glaubensterror einer mächtigen Monopolkirche, der unermüdliche Aufdecker mörderischer Justizskandale, der unerbittliche Hinterfrager aller Ideologien und somit die Stimme der Vernunft gegen religiöse Hirngespinste aller Art. Für seine Feinde vom katholisch-konservativen Lager war er der diabolische Leugner ewiger Wahrheiten, der Untergraber der sozialen und moralischen Ordnung, der Zersetzer aller Werte. Nach seinem Tod ließ sich selbst dieses düstere Bild noch weiter verdunkeln. Für die Generationen seiner Enkel und Urenkel, die sich einer gefühlsbetonten Romantik zuwandten, war Voltaire, der radikalste und unerbittlichste aller Aufklärer, die unheimliche Verkörperung des reinen Rationalismus ohne jede Spur von Gefühl oder gar Mitgefühl, ja geradezu ein Dämon, der sein sarkastisches Lachen über eine leidende Menschheit ausschüttete, der er selbst mangels Empathie nicht angehörte. Bis heute spaltet sein Name sein Land in zwei Lager, für oder gegen die Aufklärung und die Prinzipien von 1789, die aus ihr hervorgingen. Einen posthumen Triumph feierte er 1905, als Frankreich die konsequente Trennung von Kirche und Staat vollzog und die Religion damit zu dem machte, was sie laut Voltaire immer hätte sein sollen: reine Privatsache.
Wer war Voltaire wirklich? Diese Frage wurde Voltaire selbst im letzten Vierteljahrhundert seines langen Lebens immer wieder gestellt. Als Antwort darauf hat er sich mit ausgeklügelten literarischen Kunstgriffen in Dutzende von Facetten aufgelöst und damit allen eindimensionalen und eingängigen Deutungen entzogen. Die irritierend vielfältigen Selbstbilder zeichnete er vor allem in Tausenden von Briefen an Freunde und Feinde, die meist in breiteren Kreisen zirkulierten. Darin stellte er sich in einer Vielzahl von Posen, Rollen und Seelenverfassungen dar: als chronisch krank, friedliebend und milde spöttisch; als kämpferisch, polemisch und unerbittlich; als verfolgt, verletzt und verloren; als souverän, distanziert beobachtend und kühl sezierend; als menschenfreundlich, Anteil nehmend und zur Mäßigung mahnend; als hochfahrend, apodiktisch und verdammend; als gelassen, verständnisvoll und ironisch in eigener Sache. All diese Ego-Splitter bilden jeweils einen Aspekt und Ausschnitt einer Persönlichkeit, die sich tarnen musste, weil sie früh im Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit stand.
Die literarische und höfische Öffentlichkeit, die Voltaire erreichte, war weder offen noch frei, sondern ihre Akteure wurden observiert, kontrolliert, zensiert und gegebenenfalls bestraft. In Frankreich (und in den meisten anderen Ländern Europas) musste zu Lebzeiten Voltaires jedes Druckerzeugnis den zuständigen Behörden zur Genehmigung vorgelegt werden. Wenn eine solche Approbation nicht zu erwarten war, erschien es im Untergrund, das heißt mit falscher (oder gänzlich ohne) Autoren- und Verlagsangabe. Gedruckt wurde dann oft jenseits der Landesgrenze. Ein solches Versteckspiel der einen oder anderen Art war bei fast allen Werken Voltaires unverzichtbar. Täuschen ließen sich Zensoren und Leser von diesen Verschleierungsaktionen allerdings selten, so unverwechselbar waren Stil, Haltung und Aussage seiner Schriften. Obwohl die Beweise für seine Verfasserschaft oft über jeden Zweifel erhaben waren, hat Voltaire die Vertuschungs- und Irreführungsstrategien virtuos auf die Spitze getrieben: mit ausdrücklichen Verleugnungen oder erfundenen Autorennamen zum Schutz gegen Verfolgung, aus Lust am Spiel mit der Verkleidung und Verfremdung, aber auch mit der Botschaft: Es geht nicht um Personen und erst recht nicht um ihre Profilierungsbedürfnisse und Eitelkeiten, sondern um die Sache, und dieser ist Anonymität häufig förderlicher.
Die meisten Abhandlungen Voltaires zu Gott und Welt, Mensch und Geschichte, Unsterblichkeit oder Vergänglichkeit sind in der Form von erfundenen Gesprächen zwischen Vertretern unvereinbarer Positionen und Weltanschauungen gestaltet. Mit solchen literarischen Rollenspielen konnte er radikale Positionen beziehen, ohne sich selbst zu exponieren. Darüber hinaus entsprechen sie seiner Grundüberzeugung, dass alles Philosophieren über die beste Welt-, Staats- und Gesellschaftsordnung subjektiv, interessengebunden, voreingenommen und daher bestreitbar ist. Die einzige unbestreitbare Wahrheit ist, dass es sie nicht gibt. Auf die existentiell bedeutsamen Fragen, woher der Mensch komme, wozu er da sei und wohin er gehe, gab es für ihn keine sichere Antwort, sondern nur mehr oder weniger plausible Hypothesen. Deshalb musste seiner Überzeugung nach die Toleranz im Denken und Schreiben und damit die Freiheit der öffentlichen Auseinandersetzung unbegrenzt sein. Die beste Methode, diese umfassende Offenheit und Öffentlichkeit zu erreichen, war für ihn das Gespräch. Das bedeutete keineswegs, die Meinung des Andersdenkenden achselzuckend als gleichwertig zu akzeptieren, wohl aber, ihr das Recht auf Anhörung einzuräumen. Nur dadurch, dass alles, auch das Widersinnigste, sagbar ist, lassen sich Irrtümer und Irreführungen wirkungsvoll widerlegen, nicht durch Verbote und befohlenes Verschweigen. Mit diesen Erkenntnissen ist Voltaire für das einundzwanzigste Jahrhundert höchst aktuell, wie auch immer man zu seinen Positionen im Einzelnen stehen mag.
Die Suche nach dem echten Voltaire, der sich hinter den kunstvoll konstruierten Kulissen verbirgt, hat viele Forscher beschäftigt. Die Verlockung, seine Werke zu psychologisieren und ihn selbst auf die Analyse-Couch zu legen, ist groß. Warum treten so viele tragische Helden seiner Theaterstücke als Vatermörder oder zumindest mit Vatermord-Gelüsten auf? Warum werden in seinen zahlreichen Dramen und Komödien so viele nach ihrer Geburt vertauschte Kinder beiderlei Geschlechts im Laufe der Handlung mit ihrer tatsächlichen Abstammung und wahren Identität konfrontiert, manchmal zu ihrem Leidwesen, häufiger zu ihrer ruhmvollen Selbstentfaltung? Ist Voltaire also ein bekennender Ödipus, der seinen verhassten Erzeuger mit der Feder statt mit dem Dolch tötet? Eine solche Antwort im Sinne Freuds liegt verführerisch nahe, zumal der früh erfolgreiche Literat durch seinen Namenswechsel vom ererbten Arouet zum selbst erfundenen Voltaire einen symbolischen Vatermord begangen hat. Trotzdem ist bei der Deutung dieser Motivhäufungen Vorsicht geboten. Zumindest das Thema der durch kriminelle Machenschaften verschleierten Herkunft war in der Literatur des achtzehnten Jahrhunderts verbreitet, weil es an eine Hauptfrage der Aufklärung rührte: Was macht den Menschen aus, Abstammung oder Prägung durch Milieu und Erziehung?
Dennoch bleibt die Suche nach dem «Menschen» Voltaire nicht völlig ergebnislos. Wer in seinem Leben nach Öffnungen sucht, die Blicke auf seine seelische Befindlichkeit hinter allen literarischen Verkleidungen zulassen, wird vor allem in extremen Krisensituationen fündig, zum Beispiel nach dem Tod einer Lebensgefährtin sowie in den nicht seltenen Augenblicken der akuten Verfolgung und Bedrängnis. Solche «Fenster» tun sich häufiger durch Berichte von dritter Seite auf, weniger in Selbstzeugnissen. Beobachter berichten immer wieder von tiefster Erschütterung Voltaires, grenzenloser Verzweiflung und hilflosem Versinken in Angst und Panik. Allerdings waren diese Phasen des Orientierungsverlusts und der scheinbaren Selbstaufgabe nie von längerer Dauer. Sobald Voltaire zur Feder griff oder, in späteren Lebensphasen, seinem Sekretär diktierte, stellten sich Souveränität, Selbstbeherrschung und Selbstironie wie von selbst wieder ein, oft nur wenige Stunden nach dem Ordnungs- und Kontrollverlust. Der Mechanismus ist stets derselbe: Virtuos beherrschte Sprache sublimiert potentiell zerstörerische Emotionen zu kühl abwägender Rationalität. Voltaire lebte durch die Sprache, in der Sprache, mit der Sprache; sie war sein Instrument der Selbstfindung, der Erkenntnis sowie der Herrschaft über sich selbst und die Öffentlichkeit.
Die Filterung und Läuterung von diffuser Empfindung in gelassen ausgewogene Analyse steht im Mittelpunkt der Voltaire’schen Philosophie, die konsequent alle Systembildung verweigert. Für Voltaire ist der Mensch durch seine Unbehaustheit in einer Welt, die ihm gleichgültig bis feindlich gegenübersteht, stets extremen Gefühlen und Leidenschaften ausgesetzt, die ihn zu abenteuerlichen Einbildungen verleiten, zum Beispiel zum Aberglauben der Religionen. Aber er besitzt die Kraft der Vernunft, um diese Ängste und dadurch auch die Vorspiegelungen seiner irrlichternden Phantasie zurückzudrängen und zu durchschauen. Für Voltaire waren die umfassenden Welterklärungen und Heilsversprechen der Religionen irrationale Einbildungen einer überhitzten und verängstigten Phantasie, mit denen der Mensch sein Dasein zum Tod in einer zerstörerischen Welt für sinnhaltig zu erklären versucht. Dass er dieser Absurdität der Existenz nicht wie andere Philosophen, gerade auch der Aufklärung, einen «vernünftigen» Ordnungsentwurf entgegengesetzt hat, sondern allen Systementwürfen gegenüber skeptisch blieb, macht seine Größe und bleibende Aktualität aus.
Schreiben war für Voltaire Krisenbewältigung und damit eine erste Antwort auf die Frage, wie derjenige leben soll, der die Hohlheit, Ungerechtigkeit und Unhaltbarkeit der in seiner Zeit herrschenden Zustände erfahren und erkannt hat: Er hat aufzudecken und anzuklagen. Doch das konnte nicht alles sein. Voltaires literarischer und weltanschaulicher Hauptgegner, Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), der sich mit demselben Problem konfrontiert sah, fand für sich einen radikalen Ausweg: Er zog sich aus der fehlgeleiteten Zivilisation, die den Menschen von sich selbst entfremdete, in selbstgewählte Einsamkeit, Armut und Isolation zurück. Dem lag die Überzeugung zugrunde, dass der Wahrheitsfinder nur mit einer solchen Totalverweigerung für die irregehende Welt ein Vorbild zur Nachahmung sein konnte. Ein solches Leben als Prediger in der Wüste kam für Voltaire nicht infrage, dazu schätzte er die Annehmlichkeiten des Lebens, die ihm die korrupte Gesellschaft des Hofes, des Adels und der reichen Financiers zu bieten hatte, viel zu sehr. Für diese Haltung, gleichzeitig zu genießen, zu verspotten und radikal infrage zu stellen, fehlte es ihm nicht an Rechtfertigungen. Die wichtigste lautete, dass die ebenso verkommene wie verlockende, hinter verschlossenen Türen freizügige und lästerliche, aber nach außen fromme und staatstragende, also zutiefst widersprüchliche und bigotte Gesellschaft aus einer Position der Stärke bekämpft werden muss. Diese sichere Bastion ließ sich für ihn aber nur gewinnen, wenn man in die Kreise dieser ebenso glänzenden wie korrupten Elite Eingang fand.
In verschiedenen Lebensphasen hat Voltaire diese nach außen feine, im Inneren dekadente und morsche Gesellschaft in unterschiedlichen Rollen kennengelernt: Als eleganter Verseschmied saß er an den Tafeln der Reichen und Mächtigen und konnte sich durch deren Fürsprache manche Ketzerei erlauben. Als honoriger Hofhistoriograph dichtete er in Versailles heroische Hymnen zum höheren Ruhme eines faulen und genusssüchtigen Monarchen. Seine Lebensgefährtin Emilie du Châtelet, eine aristokratische Physikerin und Mathematikerin, erklärte Frankreich und ihm selbst die Physik Newtons und verschaffte ihm durch ihre Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten die notwendige Rückendeckung für seine beißende Kritik an den herrschenden Zuständen. Als führendes Mitglied einer königlichen Tafelrunde in Potsdam, die sich den Fortschritt der Aufklärung auf die Fahnen geschrieben hatte, genoss er die Protektion des preußischen Königs. Allerdings erwiesen sich alle diese scheinbar prestigeträchtigen Rollen schnell als Illusionen: Der leichtfüßige Literat schrumpfte zum austauschbaren Spaßmacher, der bedenkenlos fallengelassen wurde, wenn es ernst wurde. Der Höfling sank zum jederzeit abstoßbaren Fremdkörper ab. Die intellektuelle Symbiose mit der großen Naturwissenschaftlerin war stets vom Menschlich-Allzumenschlichen überschattet. Und der Hofphilosoph mutierte unversehens zum Hofnarren.
Für ein komfortables Leben in der Zeit und zugleich gegen die Zeit waren also wirksamere Vorkehrungen nötig. In einer Gesellschaft, in der adelige Abstammung und Reichtum über Lebenschancen und Lebensgenuss entschieden, musste derjenige, der wie Voltaire diese Voraussetzungen qua Geburt nur sehr eingeschränkt mitbrachte, sich schleunigst beides zulegen. Zum «Kammeredelmann» konnte ihn nur der König ernennen, dem er dafür Dienstleistungen wie rühmende Verse schuldete. Bereichern aber musste sich jeder selbst, zum Beispiel dadurch, dass man eine Lotterie knackte oder durch Insiderinformationen ein Vermögen mit Aktienspekulationen machte. All diese Chancen und manch andere mehr hat Voltaire früh und mit durchschlagendem Erfolg ergriffen. Der Intellektuelle war ein mit allen Wassern gewaschener Unternehmer und Geldscheffler – eine seltene Kombination. Alle moralischen Vorhaltungen, die ihm wegen seines oft skrupellosen Geschäftsgebarens gemacht wurden, ließ er an dieser Verteidigungsmauer abprallen: Um eine zutiefst ungerechte und unmoralische Zeit aus den Angeln zu heben, müsse man starke Stellungen beziehen. In einer Welt der Willkür, in der alles käuflich sei, schützten nur Reichtum und gute Beziehungen zu den Nutznießern des Systems vor Verfolgung und Unterdrückung. Für Moralisten aller Couleurs ist das bis heute ein rotes Tuch.
Im letzten Viertel seines Lebens gründete Voltaire am Kreuzungspunkt von Frankreich, der Republik Genf und der Schweizerischen Eidgenossenschaft einen eigenen Hof, der zum Ausstrahlungszentrum des geistigen Europa wurde. Ungefährdet war er allerdings auch dort nicht, ungeachtet aller kurzen Fluchtwege. So wurde das Leben Voltaires zu einer dauernden Gratwanderung, bei der mancherlei Abstürze, auch moralischer Art, unvermeidlich waren, wie er selbstkritisch einräumte.
Dazuzugehören, um Machtverhältnisse umzukehren, oben zu stehen, um Hierarchien einzureißen, zu prüfen, um zu verwerfen – diese Leitmotive machen das Leben Voltaires, wie es hier erzählt und gedeutet werden soll, zu einem Musterfall für alle Zeit. So wie Voltaire seine Zeit nur schwer aushielt, hatte es seine Zeit schwer, ihn auszuhalten. Das gilt auch für heute, denn keine Zeit liebt es, ihre scheinbar unerschütterlichen Gewissheiten und heiligsten Überzeugungen systematisch hinterfragt, in Zweifel gezogen, widerlegt oder gar verspottet zu sehen. Für Voltaire aber war dieses Alles-Infragestellen der einzige Weg zur Toleranz, weil hinter jedem festgefügten Glaubenssystem die Fratze des Fanatismus lauere. Bei dieser Generalüberprüfung aller Philosophien, Gesellschaften und Staaten wurde keineswegs alles als untauglich abgetan. Doch auch das, was ihr standhielt oder besser: standzuhalten schien, wie zum Beispiel die aufgeklärte Monarchie als beste Staatsform für das kontinentale Europa, bekam von Voltaire nur eine befristete Existenzberechtigung zugesprochen. Die Zeit war für ihn in permanenter Bewegung begriffen, nicht hin zur Seligkeit auf Erden, wohl aber seit etwa 1500 zu allmählich vernünftigeren und humaneren Lebensverhältnissen. Daher war für Voltaire das Gute immer nur bis auf Widerruf gut – mit Ausnahme des Prinzips, dass alles sagbar, diskutierbar und damit auch verwerfbar sein musste.
Mit seiner schonungslosen Analyse der Welt und des Menschen zwingt Voltaire bis heute dazu, Stellung zu beziehen und selbst nach Sinn zu suchen. Zugleich liefert er die Argumente und Methoden, die es erlauben, die eben gefundenen Lösungen in Zweifel zu ziehen. So gibt er auf die drängenden Fragen, woher das Böse in der Welt kommt, wie die allgegenwärtige Grausamkeit des Menschen zu erklären ist und wie einem endlichen und hinfälligen Leben Sinn abgewonnen werden kann, Antworten, die auf staunendes Nicht-Wissen hinauslaufen. Auch diese zutiefst humane Skepsis macht Voltaires fortdauernde Aktualität aus.
ERSTES KAPITEL
AUF DEM WEGZUM EIGENEN NAMEN
1694–1718
Das Spiel mit Geburt und Herkunft
Der große Spötter Voltaire spottete sogar über seine eigene Herkunft. Nach dem 1871 verbrannten, doch in Kopien erhaltenen Geburtsregister der zuständigen Pariser Pfarrei wurde François-Marie Arouet, der sich vierundzwanzig Jahre später selbst in Voltaire umbenannte, am 21. November 1694 in Paris geboren und am Tag darauf in der Kirche St. André des Arcs auf dem linken Seine-Ufer getauft, und zwar als Sohn des ehemaligen Notars François Arouet und seiner Ehefrau Marie Marguerite, geborene Daumard. Zwei der in diesem Personenstandsverzeichnis enthaltenen Angaben hat der darin erstmals Bezeugte lebenslang bestritten. Zum einen machte er sich neun Monate und einen Tag älter, wäre demnach also bereits am 20. Februar 1694 geboren. Die Vorverlegung der Geburt steht in direkter Beziehung zur zweiten «Korrektur», mit der sich Voltaire einen anderen Erzeuger und dadurch eine uneheliche Abkunft zuschrieb. Die Aufstockung des Lebensalters könnte eine Spielerei mit den Fakten und somit ein Stück Camouflage gewesen sein, wie sie Voltaire bei der Frage nach der Verfasserschaft seiner Schriften so meisterlich beherrschte. Doch dagegen spricht, dass er es mit der alternativen Abstammung väterlicherseits offensichtlich ernst meinte. So schrieb er im Februar 1729 nach eben überstandener schwerer Krankheit: «Ich stamme übrigens von nie gesunden und früh verstorbenen Eltern ab.»[1] Das traf auf die Mutter zu, nicht jedoch auf den standesamtlich eingetragenen Vater. Dieser erreichte mit zweiundsiebzig Jahren ein für die Zeit respektables Alter, kann hier also nicht gemeint sein. Doch wer war dann sein biologischer Erzeuger?
In einem Jugendgedicht Voltaires auf eine schöne junge Frau, die von ihrem ältlichen Ehegatten gegen die Begierden jugendlicher Liebhaber abgeschirmt werden soll, wird einer von diesen heißblütigen Bewunderern mit Namen genannt: Rochebrune. Derselbe Name taucht 1744 in einem Vers auf, in dem sich Voltaire als «Bastard Rochebrunes» bezeichnet. Und im gestandenen Alter von zweiundsechzig Jahren soll er nach einem Bericht von dritter Seite diesen Rochebrune (oder auch Roquebrune), seines Zeichens Offizier, Mann von Ehre und Schriftsteller, als seinen Vater bezeichnet und die Begründung gleich mitgeliefert haben: Dieser Allround-Gentleman sei doch um einiges interessanter als sein mittelmäßiger und langweiliger offizieller Erzeuger. Als dieser Liebhaber von Madame Arouet wird meistens ein gewisser Guérin de Rochebrune identifiziert, der mit dem Notar Arouet Anfang der 1690er-Jahre geschäftliche Beziehungen pflegte, einen echten aristokratischen Stammbaum vorweisen konnte und sich als Verfasser volkstümlicher, meist anzüglicher Liedchen vorübergehend einen Namen machte. Da die Spur zu Rochebrune von Voltaire selbst gelegt worden ist, kann man sich fragen, ob er hier Legendenbildung in eigener Sache betrieb, um sich zugleich von einem verachteten Herkunftsmilieu zu distanzieren, oder ob er hier tatsächlich ein Familiengeheimnis aufdeckte, mit dem die moralische Respektabilität gewahrt werden sollte. Mangels DNA-Analysen muss die Frage offenbleiben. Jedenfalls leitete Voltaire aus der Gewissheit, in Wahrheit ein «Bastard Rochebrunes» zu sein, sein Selbstverständnis als Edelmann und Literat ab.
Gesichert ist also nur der Schluss, dass Voltaire lieber einen aristokratischen Filou zum Vater haben wollte als einen ehrbaren Rechtsgelehrten. Dieser befand sich 1694 – wie die Bezeichnung als «ehemaliger Notar» in der Geburtsanzeige andeutet – auf einer Übergangsetappe eines langsam, aber stetig nach oben führenden Karriereweges. Allerdings entwickelten sich Laufbahnen in Verwaltung und Justiz damals anders als heute; seit mehr als anderthalb Jahrhunderten war es in Frankreich Brauch, dass man solche Ämter zu kaufen hatte, die höheren für viel Geld. So erwarb François Arouet im September 1696 den Posten eines Einziehers der Sporteln, also Gebühren für Amtshandlungen, am Obersten Rechnungshof Frankreichs für die Summe von 240.000 Livres. Zum Vergleich: Ein tüchtiger Handwerker verdiente damals zwischen 300 und 400 Livres jährlich. Dass der Ex-Notar die Summe bar auf den Tisch legen konnte, zeugt von beträchtlichem Wohlstand. Allerdings hatte er sich fünf Jahre lang mit einer Position im Wartestand zu begnügen, da sein Vorgänger, dem er währenddessen zur Hand gehen musste, seinen Platz erst 1701 räumte. Daraufhin zog die Familie in eine geräumige Zehn-Zimmer-Wohnung des Pariser Justizpalastes um. Mit dieser Position ihres Oberhaupts war sie in einer Grauzone zwischen gehobenem Bürgertum und niederem Amtsadel angekommen. Letzterem entstammte auch die angeblich so flatterhafte Gattin des angeblich so trockenen Juristen.
François Arouet setzte einen für das Frankreich des siebzehnten Jahrhunderts typischen Familienaufstieg fort: Als Enkel eines wohlhabenden Gerbers aus der Gegend von Poitiers und Sohn eines erfolgreichen Textilhändlers vollzog er den Übergang vom Kommerz in die prestigeträchtigere Ämterlaufbahn mit ihren materiellen Sicherheiten und Chancen zur Vernetzung mit den Mächtigen geradezu modellhaft. Die Familie Arouet hatte damit in der Privilegiengesellschaft des Ancien Régime einen komfortablen Nischenplatz erobert, zwar immer noch weit unterhalb des Hochadels, der die einflussreichsten Positionen am Hofe und in der katholischen Staatskirche besetzte, doch geschützt vor aufdringlichen Steuerforderungen und Zumutungen der öffentlichen Hand wie Militärdienst und anderen Fronarbeiten.
Aus Inventarlisten, die nach dem Tod von Voltaires «offiziellem» Vater im Jahr 1722 erstellt wurden, lässt sich der Lebensstil der Arouets zur Zeit von Voltaires Kindheit und Jugend erschließen. Der Verblichene hinterließ nach Abzug aller Schulden nicht nur ein Barvermögen, das dem Tausendfachen eines Handwerker-Jahresverdienstes entsprach, sondern auch zwei Häuser in Paris und zwei in der Umgebung, darunter eine Villa mit vierzehn Zimmern, außerdem kostbares Mobiliar und jede Menge schweres Tafelsilber. Auch wenn manches von diesen Besitztümern erst später erworben sein dürfte, stehen die komfortablen Lebensumstände des Neugeborenen bei seinem angeblichen Kuckucksvater außer Frage. Den sozialen Rang, den dieser durch seine Dienste für die Mächtigen erklommen hatte, spiegeln die Paten wider, die den erstgeborenen Sohn Armand, Voltaires älteren Bruder, im März 1685 aus der Taufe hoben. Mit der Herzogin von Saint-Simon und dem Herzog von Richelieu gehörten sie zu den einflussreichsten Kreisen des französischen Adels und zum Kern der Versailler Hofgesellschaft. Mit dem Sohn dieses Paten, dem dritten Herzog von Richelieu (1696–1788), der sich als Liebhaber, Lebemann und modischer Trendsetter, aber auch als unerschrockener Feldherr und kluger Zeitbeobachter einen Namen machte, sollte nicht der später überaus fromme Täufling, sondern dessen Bruder Voltaire lebenslang enge Beziehungen unterhalten, und zwar in verschiedenen Rollen: als Gläubiger und Heiratsvermittler, aber auch als Verhandlungspartner und Schutzbefohlener. Ende Dezember 1686 wurde dem Ehepaar François und Marie Marguerite Arouet eine Tochter geboren, die auf den Namen Marguerite-Catherine getauft und Catherine genannt wurde. Eine ihrer Töchter, Marie-Louise, sollte später eine Hauptrolle im Leben ihres Onkels Voltaire spielen.
Für dessen Taufe wurde eine weitaus weniger vornehme Gesellschaft aufgeboten. Patin des kleinen François-Marie wurde eine Schwägerin der Mutter, Pate war der Abbé François de Châteauneuf, ein Freund des Hauses, von Beruf Kleriker, Diplomat und Schöngeist. Die Mittel für seinen komfortablen Lebensstil bezog er aus einer lukrativen kirchlichen Pfründe, die ursprünglich einem Kloster gehört hatte und ihm kaum kirchliche Verpflichtungen und keine lästigen Einschränkungen im Verkehr mit dem anderen Geschlecht auferlegte. Als Prototyp des geistreichen und unterhaltsamen «Weltgeistlichen» war er ein gern gesehener Gast bei mondänen Festlichkeiten aller Art. Unterschiedlich fielen auch die Schulen aus, auf die Vater Arouet seine beiden einzigen überlebenden Söhne schickte. Für seinen älteren, Armand, hatte er das Seminar der Oratorianer auserkoren. Diese Ordensgemeinschaft war aus einer innerkirchlichen Reformbewegung des späten sechzehnten Jahrhunderts hervorgegangen und stand mit ihrer rigorosen Morallehre der Strömung des Jansenismus nahe. Für François-Marie wählte das ehrgeizige Familienoberhaupt das nach dem Sonnenkönig benannte Collège Louis-le-Grand aus, das bis heute prestigeträchtigste Gymnasium Frankreichs, Elite-Pflanzstätte und Ausbildungsort künftiger Staatspräsidenten. Geleitet wurde das Collège von Jesuiten-Patres, den geschworenen Gegnern der Jansenisten. Das erlaubt den Schluss, dass der karrierebewusste Jurist bei der Erziehung seiner Söhne seine Gunst auf beide Seiten verteilte, also doppelgleisig fuhr und sich damit in einem Konflikt neutral positionierte, der die französische Geisteslandschaft und Kulturszene ein Jahrhundert lang polarisierte. Seine persönliche Neigung galt der strengen Richtung der Jansenisten und damit auch dem älteren, fügsamen Sohn.
Der fromme große Bruder und die freigeistige «Lebedame»
Die Kontroverse zwischen Jesuiten und Jansenisten war mit politischen Motiven und Intrigen und den Rivalitäten einflussreicher Institutionen verbunden, etwa zwischen dem Parlement de Paris, dem Obersten Gerichtshof des Königreichs, dem François Arouet beruflich eng verbunden war und das dem Jansenismus zuneigte, und dem königlichen Hof, der lange Zeit die Jesuiten begünstigte. Hinzu kamen Grabenkämpfe zwischen konservativen und aufgeklärten Intellektuellen, wobei die aufgeklärten die Jesuiten als repressive Zensurinstanz bekämpften und die konservativen in ihnen ein Bollwerk gegen den Verlust aller Werte sahen. Der grundsätzliche Konflikt hatte sich schon vor der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts an der Augustinus-Biographie Cornelius Jansens, seines Zeichens Bischof von Ypern, entzündet. Dieser hob in seiner Interpretation des afrikanischen Kirchenvaters dessen Prädestinationslehre hervor, wonach jeder Mensch von Gott vor seiner Geburt zu Erwählung oder Verdammnis vorherbestimmt sei. Damit bewegte sich der katholische Prälat hart an der Grenze zur Häresie, denn diese Doktrin war seit den 1540er-Jahren das Markenzeichen des Calvinismus, wenngleich unterdessen auch in der reformierten Kirche nicht unumstritten. In Abgrenzung zu den calvinistischen «Ketzern» lehrten die Anhänger und Nachfolger Jansens, die sich in der zweiten Hälfte um das Kloster Port-Royal in der Nähe von Paris scharten, dass die menschliche Willensfreiheit trotz dieses göttlichen Ratschlusses nicht völlig aufgehoben sei. So könne der Erwählte der ihm zugedachten göttlichen Gnade theoretisch widerstehen, doch sei das aufgrund der Anziehungskraft dieses unverdienten Geschenks de facto ausgeschlossen – was umgekehrt auch für die Attraktivität der Sünde bei den Verdammten galt. Mit der Lehre, dass Christus, der Erlöser, nicht für alle, sondern nur für die Minderheit der Erwählten gestorben sei, verbanden die Jansenisten eine kritische Haltung gegenüber der reichen und mächtigen Amtskirche. Dagegen setzten sie das Lob des einfachen, durch aufopferungsvolle Seelsorge geadelten Priestertums und eine kompromisslose Morallehre, die auch von den Mächtigen die Einhaltung der Zehn Gebote forderte. Bei einem König wie Ludwig XIV., dessen Mätressen Tagesgespräch waren, und den Päpsten, die intensive Verwandtenförderung betrieben, waren die Jansenisten daher alles andere als beliebt. So zogen sie in den jahrzehntelangen Kontroversen mit ihren Erzfeinden, den Jesuiten, an der Kurie und auch beim König stets den Kürzeren; sinnfälliger Ausdruck dafür war 1709 die Zerstörung des Klosters Port-Royal, das bis auf die Grundmauern abgetragen wurde.
In der Welt des Geistes aber hatten die Jesuiten 1656 eine Niederlage hinnehmen müssen, die sich nicht mehr wettmachen ließ. In diesem Jahr nämlich veröffentlichte der dreiunddreißigjährige Blaise Pascal, der sich als bahnbrechender Mathematiker und Physiker in ganz Europa einen Namen gemacht hatte, seine Lettres écrites à un Provincial: ein scharfsinniges theologisches Lehrbuch für gebildete Laien und eine grandiose Satire über dogmatische Spitzfindigkeiten, die sich am Ende zu einer vehementen Polemik gegen die Jesuiten steigert, die mit ihrer laxen Morallehre als rückgratlose Speichellecker der Mächtigen und Verderber des christlichen Glaubens angeprangert werden. Dieser Konflikt war Voltaire durch Familie und Erziehung also von Anfang an vertraut; mit den Ideen der verfeindeten Parteien, speziell mit Pascal, setzte er sich früh und intensiv auseinander, und zwar mit einem letztlich für beide Seiten vernichtenden Urteil.
Voltaires Mutter starb 1701, gerade einmal einundvierzig Jahre alt. Im Werk des Sohnes findet sie mit Ausnahme der anzüglichen Anspielungen auf ihren angeblichen Seitensprung kaum Erwähnung. Sein Vater kommt öfter vor, doch wird er durchgehend lieblos als großer Groller und Schmoller geschildert, später heißt es etwas versöhnlicher: Brummbär. Diese Abstempelung dürfte damit zusammenhängen, dass der geschäftstüchtige Jurist wie so viele seines Standes überwiegend herablassende Geringschätzung für die Poeten und Intellektuellen, mit denen er beruflich zu tun hatte, an den Tag legte. Den Dichterfürsten Pierre Corneille etwa – so wusste Voltaire noch im fortgeschrittenen Alter von fünfundsechzig Jahren indigniert zu berichten – bezeichnete er «als den langweiligsten Sterblichen, den ich jemals gesehen habe, und den mit der ödesten Unterhaltung».[2] Für den Sohn, der den großen Dramatiker lebenslang eifersüchtig bewunderte, war das eine peinliche Denkmalsschändung. Immerhin verkehrte sein Vater auch mit dem Freundeskreis Corneilles und einigen jüngeren Literaten, so dass sich die Abendgesellschaften in der Dienstwohnung des Justizpalastes kaum so trocken und geistlos abgespielt haben dürften, wie der Gastgeber behauptete.
Nachrichten aus erster Hand über das Familienleben der Arouets fehlen völlig, umso reichlicher fließen die Informationen mehr oder weniger zeitgenössischer Biographen. Einer der am besten unterrichteten von ihnen namens Théophile Duvernet, dessen Vie de Voltaire 1786 in Genf erschien, weiß viel von dessen poetischer Früherziehung zu berichten. Besonders der umtriebige Abbé de Châteauneuf habe sein begabtes Patenkind zeitig und mit durchschlagendem Erfolg in die Kunst des Verseschmiedens eingeführt. So habe der kleine François-Marie seinen immerhin neun Jahre älteren Bruder bei den innerfamiliären Wettbewerben, die der Vater bewusst gefördert habe, mühelos ausgestochen. Glaubwürdigkeit gewinnen diese Berichte durch einen Brief, den der greise Voltaire dreizehn Monate vor seinem Tod an seinen Neffen schrieb. Darin vergleicht er sich mit dem biblischen Brudermörder Kain:
Ich weiß nicht, wie es Kain schaffte, in der Zeit seines Umherirrens die Stadt Enos zu erbauen, als dritter Mensch auf Erden. Aber wenn er dabei so viel Ärger gehabt hat wie ich, war das eine harte Strafe dafür, dass er seinem Bruder den Kopf eingeschlagen hat. Ich habe meinen Bruder nicht getötet – den Jansenisten, Konvulsionisten (convulsionnaire) und Fanatiker, der sich in Taten und Worten für so mächtig hielt.[3]
Doch auch Worte können töten. Selbst im höchsten Alter zittert die Erregung des brüderlichen Kräftemessens noch heftig nach und zeigt damit Voltaires hervorstechenden Charakterzug: In Sachen Dichtung und Philosophie duldete er keinen neben sich. Alle Konkurrenten, die ihm den ersten Platz in diesen Disziplinen streitig zu machen wagten, verfolgte er mit unbarmherzigem Spott und, wenn das alles nichts nützte wie im Fall Rousseaus, auch mit ausgeprägtem Vernichtungswillen. Als convulsionnaires wurden übrigens die jansenistischen Extremisten bezeichnet, die ihre religiöse Verzückung und Entrückung durch öffentlich zelebrierte Zitter- und Krampfzustände bezeugten, vorzugsweise an ihnen heiligen Stätten wie dem auf Anweisung des Königs gleichfalls dem Erdboden gleichgemachten Friedhof von Port-Royal. Für Voltaire waren solche Verhaltensmuster und die ihnen zugrundeliegenden Denkweisen der Gipfel fehlgeleiteter Irrationalität, die es mit den Mitteln der Vernunft um jeden Preis zu bekämpfen galt. So ist die Vermutung erlaubt, dass seine Überzeugungen bereits in geschwisterlichen Grabenkämpfen erste Umrisse erhielten.
Für Voltaires aufgeklärte Denkweise kommen allerdings auch noch andere Einflüsse infrage. Glaubt man Duvernet, so soll der bekennende libertin – so wurden in Frankreich Freigeister mit lockerem Lebenswandel genannt – Châteauneuf dem kleinen Voltaire nicht nur das Reimen beigebracht, sondern diesem auch seine skeptische Haltung gegenüber den Mysterien der christlichen Religion vermittelt haben. Zu solchem vorschulischem Unterricht in Freidenkertum habe es gehört, sein dreijähriges Patenkind eine anonym zirkulierende Satire zum Leben des Moses aufsagen zu lassen, in der es unter anderem hieß:
Durch eitle Sophismen
Werden Sie meinen Verstand nicht überrumpeln.
Der menschliche Geist will klarere Beweise
Als die Gemeinplätze eines Gemeindepfarrers.[4]
Solche Berichte klingen allerdings verdächtig nach Legendenbildung. Der späte Voltaire wurde nicht müde, die Wunderberichte des Alten Testaments mit Hohn und Spott zu überziehen, und dabei geriet ihm Mose, der Befreier des Volkes Israel, besonders kritisch ins Visier. So lag es nahe, diese Haltung biographisch so weit wie möglich nach hinten zu verschieben:
Die raffinierte Lüge galt als Wahrheit
Und begründete die Autorität dieses Gesetzgebers
Und mündete in einen öffentlichen Glauben,
mit dem die Welt infiziert wurde.[5]
Das war Geist vom Geist des späteren Voltaire, allerdings hat er dazu elegantere Verse geschrieben als der unbekannte Satiriker aus seiner Kindheit.
Im Gegensatz zu solchen mehr oder weniger apokryphen Berichten ist sicher bezeugt, dass der kleine François-Marie Arouet 1704 Ninon de Lenclos und damit einer heftig umstrittenen lebenden Legende begegnete. Ninon de Lenclos wurde 1620 geboren, war von adliger Abkunft und in ihrer Jugend von großer Schönheit, machte sich als Schriftstellerin einen Namen und lebte ihren freigeistigen Überzeugungen gemäß nach damaligen Maßstäben äußerst freizügig, was ihr den Ruf einer Kurtisane einbrachte. Sie war eine der Ersten, die gleiche Rechte für Frauen und Männer forderte, und führte in ihren späteren Jahren einen der lebendigsten und subversivsten Salons von Paris, in dem sich kritische Intellektuelle und hoffnungsvolle Nachwuchspoeten ein Stelldichein gaben. Ihr Interesse an dem knapp zehnjährigen Sohn ihres Rechtsberaters dürfte auf die begeisterten Berichte Châteauneufs, ihres laut Voltaire letzten Liebhabers, zurückzuführen sein, dessen «Erzieherrolle» damit eine weitere Bestätigung findet.
Dieser schillernden Grande Dame, die so eindrucksvoll die Kultur des vergangenen Jahrhunderts repräsentierte, wurde der kleine François-Marie also jetzt vorgestellt, wegen einiger Verse, «die zwar nichts taugten, doch für sein Alter gut erschienen»[6] – so Voltaire im Abstand von siebenundvierzig Jahren zu diesem aufregenden und wohl auch prägenden Ereignis seiner Kindheit. Noch in höherem Alter wusste er Ninons Rolle als mutige Freidenkerin inmitten von Heuchlern zu würdigen: Als sich ein miserabler Verseschmied rühmte, von ihr angelernt worden zu sein, «antwortete sie, dass sie es damit wie Gott halte, der bereut hatte, den Menschen geschaffen zu haben».[7] Auch umgekehrt muss der Eindruck positiv gewesen sein, denn Ninon de Lenclos vermachte dem begabten Knaben in ihrem Testament eine hübsche Geldsumme für den Kauf von Büchern – was für Bücher das sein sollten, ist nicht schwer zu erraten: Der kleine Arouet sollte mit ihnen den Weg kritischen Selbstdenkens weitergehen, auf den ihn Châteauneuf geführt hatte. Doch dem stand der wachsame Vater im Wege; erst fünf Jahre nach dessen Tod, bei der Verteilung des Erbes, erhielt Voltaire die ihm von der 1705 verstorbenen Literatin zugedachte Summe.
Als Inhaber eines teuren Amtes am königlichen Rechnungshof wusste Voltaires Vater nur zu gut, warum er sich gegen solche «zersetzenden» Einflüsse sperrte: Kritik an den Glaubenslehren der Kirche war gefährlich. Was in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, der großen Zeit der Ninon de Lenclos, in den exklusivsten Salons noch denkbar und sagbar gewesen war, behielt man in den späten Regierungsjahren des immer stärker unter jesuitischem Einfluss frömmelnden Ludwig XIV. besser für sich. Die Kirche war Zensurinstanz und verbot in enger Kooperation mit staatlichen Behörden alle Publikationen, in denen sie Widerspruch zu ihren Dogmen oder gar eine feindselige Haltung zu Religion und Klerus witterte. Derartige Schriften mussten daher anonym und mit fingiertem Druckort erscheinen; daran sollte sich bis zum Beginn der Französischen Revolution nichts ändern. Doch durch solche Finten allein ließen sich die Rechtgläubigkeits- und Anstandswächter nicht irreführen. Um die Spuren der Verfasserschaft für die Aufsichtsorgane zu verwischen und zugleich für das eingeweihte Publikum offenzulegen, mussten die oppositionellen Autoren raffiniertere Strategien der Textentschärfung entwickeln. Sie reichten von subtiler Ironie, die das Publikum zum Lesen zwischen den Zeilen aufforderte, über fingierte Wohlanständigkeit bis hin zu geheuchelter Empörung über staatsgefährdende Meinungen. Auf diesem Gebiet der auktorialen Rollenspiele sollte es Voltaire zu unerreichter Meisterschaft bringen.
Besonders beunruhigend an der herrschenden Zensurpraxis war ihre Willkür, da dabei je nach politischer Lage Faktoren wie Protektion oder Missliebigkeit, Suche nach Sündenböcken, Bedarf an Schauprozessen, Demonstration von Härte oder ostentativer Liberalität ins Spiel kommen konnten. Das führte unter Autoren, Verlegern und Buchhändlern zu einem Klima absoluter Rechtsunsicherheit, zumal ein königlicher Haftbefehl gegen «skandalöse» Literaten und Freidenker schnell ausgestellt war. Eine solche lettre de cachet hatte zur Folge, dass die missliebige Person ohne Prozess auf unbestimmte Zeit hinter Gefängnismauern verschwand. Solche «Besserungsaufenthalte» waren zwar meistens auf einige Monate begrenzt, doch konnten sie im Extremfall auch lebenslang dauern. Der Abschreckungseffekt lag in dieser Ungewissheit, auch das sollte Voltaire am eigenen Leib erfahren. Zudem konnten Kirche und Staat, bei der Unterdrückung «schädlicher» Gesinnungen in trauter Union, schon aus weitaus geringerem Anlass, etwa bei «Delikten» wie der Missachtung religiöser Prozessionen, mit aller Härte zuschlagen. Grausame Hinrichtungen für solche «Blasphemien» waren im «aufgeklärten» achtzehnten Jahrhundert durchaus an der Tagesordnung.
Was als Gefährdung der guten Sitten oder der öffentlichen Ordnung eingestuft wurde, hing von stark schwankenden und sehr subjektiv eingefärbten Einschätzungen ab. Bei diesem Ausspähen und Denunzieren «subversiver» Literatur hatten die Jesuiten eine unangefochtene Führungsstellung inne. Texte, die in ihrem ab 1701 publizierten Journal de Trévoux als bedenklich oder schlimmer eingestuft wurden, zogen regelmäßig den öffentlichen Bannstrahl auf sich und wurden daraufhin vom Henker verbrannt. Nicht wenige von Voltaires Schriften fielen diesem Autodafé zum Opfer. Das musste für seine Verleger nicht unbedingt ein Nachteil sein, denn Verbote steigerten die Neugier des Publikums und damit die Verkaufszahlen der klandestin gedruckten Ware.
Auf dem Jesuitenkolleg Louis-le-Grand: Früher Ruhm und subversiver Spott
Im ersten Jahrzehnt des achtzehnten Jahrhunderts standen die Jesuiten in Frankreich auf dem Gipfel ihres Einflusses: als Beichtväter eines immer kirchenfrommeren Monarchen, als Kontrolleure der veröffentlichten Meinungen und vor allem als Erzieher der nachrückenden Eliten. Dass François Arouet, der gut etablierte Sporteleinnehmer am Obersten Rechnungshof des Königreichs, seinen zweiten Sohn, der früh aus der Art zu schlagen drohte, den Patres der mächtigen Sozietät Jesu zur Ausbildung und Charakterformung anvertraute, hatte also gute Gründe. Mit der Schule der Oratorianer für den älteren Sohn Armand hatte er seine jansenistische Einstellung ziemlich offen dokumentiert; nun nahm er diese Option 1704 mit der Wahl des Collège Louis-le-Grand ostentativ zurück und hängte sein Mäntelchen damit geschickt nach dem Wind, der den Anhängern von Port-Royal immer heftiger ins Gesicht blies.
Ein zweiter wichtiger Grund für die Wahl eines Jesuitenkollegs dürfte gewesen sein, dass «Louis-le-Grand» eine Netzwerk- und Kaderschmiede ersten Ranges war. Hier wurden die Sprösslinge des Hochadels mit der Dosis Bildung versehen, die man für ihre künftige Karriere in Militär und Diplomatie als zuträglich erachtete. Zudem sollte hier künftiges Führungspersonal für Verwaltung, Justiz und Kirche herangezogen, also nicht nur mit den dafür nötigen Kenntnissen versehen, sondern auch mental geprägt werden. Auf diese Weise spiegelte das Collège die komplexe Schichtung der höheren Klassen wider, auch im Alltag: Die Knaben aristokratischer Abkunft brachten ihre persönlichen Diener mit und waren komfortabel untergebracht. Solche Privilegien wurden «Bürgerlichen» wie François-Marie Arouet nicht zuteil. Ein dritter Grund, der für das Jesuitenkolleg sprach, könnten die Frühreife des Knaben, seine ungewöhnliche Begabung für Sprache – ein Schwerpunkt der Jesuitenschulen – sowie seine notorische Aufmüpfigkeit gewesen sein. Für solche Probleme spricht, dass Vater Arouet seinen zehnjährigen Filius nicht als Tagesschüler anmeldete, sondern ins Internat schickte. Damit war er zugleich jeder weiteren Verantwortung für dessen Entwicklung ledig, auch das wohl ein willkommener Effekt dieser räumlichen Abschiebung.
Wenn es Lehrer gab, die ihren Zöglingen solche Sperenzien austreiben konnten, dann waren es die Väter vom Orden des heiligen Ignatius. Ihr Erziehungssystem war darauf ausgelegt, die natürlichen, von der Erbsünde verdorbenen Anlagen der ihnen anvertrauten Zöglinge erst zu brechen und ihre Charaktere danach durch Frömmigkeit, Gehorsam und Disziplin wieder aufzubauen. Zu diesem Zweck wurden die Schüler in kleinsten Gruppen «betreut», also nicht nur unterrichtet, sondern durchgehend kontrolliert und regelrecht observiert, sogar nachts, und zwar durch einen meist jungen Pater cubicularius, den «Schlafsaalvater», dessen Hauptaufgabe darin bestand, unaussprechliche «Unzüchtigkeiten» zu verhindern. Ob das gelang, ist zumindest zweifelhaft. Für die Feinde der Jesuiten stand fest, dass es dort zu ungeheuerlichen Ausschweifungen «widernatürlicher» Art kam. Ganz in diesem Sinne hat Voltaire während seines englischen Exils nach glaubwürdigem Zeugnis von dritter Seite einer illustren Tischgesellschaft unter Vorsitz des hoch angesehenen – und zudem katholischen – Literaten Alexander Pope die bestürzende Mitteilung gemacht, dass er während seiner Internatszeit Opfer brutaler sexueller Übergriffe geworden sei und seine Gesundheit bis heute darunter leide.
Allerdings findet diese gravierende Anschuldigung in seinem Œuvre, das mit Vorwürfen an die Adresse der Societas Jesu wahrlich nicht spart, keine Entsprechung. So liegt die Vermutung nahe, dass er mit dieser Skandalgeschichte die steife Atmosphäre britischer Wohlanständigkeit aufsprengen wollte, was ihm denn auch mit durchschlagendem Erfolg gelang. Jahrzehnte später sollte Voltaire seiner Abneigung gegen die homoerotische Atmosphäre am Hofe König Friedrichs II. von Preußen beredten Ausdruck verleihen. Vielleicht wurden hier Erinnerungen an «Louis-le-Grand» wieder wach. Auf jeden Fall war für Voltaire jegliche Form von Gruppen- und Gemeinschaftsbildung ohne feminines Element unerträglich.
Die Hausordnung des Collège war streng: Geweckt wurde um fünf Uhr morgens, um neun Uhr abends gingen die Lichter aus. Unterrichtet wurde zwischen halb acht und zehn Uhr vormittags sowie von zwei bis sechs Uhr nachmittags. Nicht nur dieses strenge Reglement und seine Umsetzung, sondern auch die Art der Unterweisung und das dabei zugrunde gelegte Lehrprogramm waren ganz dem Geist des Konfessionellen Zeitalters verpflichtet. An erster Stelle stand die religiöse Indoktrination. Sie war darauf ausgerichtet, die Lehren der katholischen Kirche als unverrückbare Wahrheiten und Leitlinien in Kopf und Gemüt der Schüler zu verankern. Diesem Zweck dienten nicht nur die Unterrichtseinheiten, sondern auch eine tägliche Messe sowie abendliche Gebete und diverse geistliche Übungen.
Im Rückblick des Alters hat Voltaire das, was ihm auf dem Jesuiten-Collège in sieben Jahren vermittelt worden war, lakonisch zusammengefasst: Latein und Sottisen. Das hieß, negativ formuliert: kein Griechisch, was ihm vor allem in der deutschen Gelehrtenwelt Geringschätzung einbrachte, kaum Mathematik, sehr wenig Geographie und Geschichte und keine modernen Sprachen. Diese Auslassung erklärte sich daraus, dass die Patres Latein zur lebendigen Sprache zu machen suchten: Ihre Schüler sollten lateinisch denken, fühlen und dichten. Dazu wurden ihnen fromme Aufsatzthemen gestellt, zum Beispiel sollten sie die Christenverfolgungen unter Diokletian in rhetorisch reich verzierten und kunstvoll gegliederten Satzkonstruktionen beschreiben und beklagen. Die Defizite in lebenden Sprachen hat Voltaire durch Selbststudium reichlich kompensiert. Englisch und Italienisch beherrschte er nicht nur fließend, sondern sogar elegant, nur mit dem Deutschen konnte er sich lebenslang nicht anfreunden. Und für die modernsten Naturwissenschaften seiner Zeit gewann er im Alter von vierzig Jahren die beste Lehrerin, die Europa damals zu bieten hatte.
Gerecht wird die Bilanz «außer Latein nichts als Dummheiten» den Anregungen der Schulzeit trotz aller Einseitigkeiten und Verengungen des Lehrplans nicht. Der spätere Dramatiker Voltaire vergaß vor allem, das Theater zu erwähnen. Zum pädagogischen Konzept der Jesuitenkollegien in ganz Europa gehörten Aufführungen frommer lateinischer Stücke, vorzugsweise Märtyrerdramen. Im «mondänen» Louis-le-Grand gab es zusätzlich Ballett und Komödie, letztere auf Französisch. Dafür wurden sogar Profis von der Oper angeheuert, die den Eleven graziöse Schrittfolgen beizubringen hatten – ein Adliger musste schließlich nicht nur fechten, sondern auch tanzen können. Dementsprechend war das Publikum, das diesen Schauspielen beiwohnte, sehr «weltlich»: «Tout Paris», darunter Mütter und Schwestern der Schüler, strömte zu diesen Spektakeln. Ob François-Marie Arouet darin als Schauspieler mitwirkte, ist nicht bekannt. Die Eindrücke, die er aus diesen Darbietungen mitnahm, sollten sich jedoch für seine eigene Theaterproduktion als prägend erweisen: nicht durch die frommen Botschaften, wohl aber durch die dramatischen Schaueffekte und Schrecken erregenden Zuspitzungen, die den unermüdlichen Stückeschreiber Voltaire lebenslang zu Nachahmung und Parodie antrieben.
Zu den pädagogischen Rezepten der Jesuiten gehörte es, nach dem Frontalunterricht vor hundert und mehr Schülern kleinere Gruppen zu bilden, diese mit eigenen lateinischen Texten gegeneinander antreten zu lassen und für die Sieger Preise auszuloben. Die besten dieser Arbeiten wurden sogar in einem Goldenen Buch für die Nachwelt aufbewahrt; auf diese Weise spiegelte das Collège den Literaturbetrieb mit seinen Rivalitäten und Eifersüchteleien im Kleinen wider. Das kam dem Ehrgeiz des Zöglings Arouet und seinen ausgeprägten Profilierungsbestrebungen entgegen und hatte gleichfalls lebenslange Folgen. Als ihm Jahrzehnte später ein Papst mit väterlicher Herablassung vorhielt, in einem lateinischen Vers gegen die Gesetze der Metrik verstoßen zu haben, reagierte der so Getadelte äußerst ungnädig – auch das fraglos eine Erinnerung an die Schulzeit.
An weiteren Eindrücken ist die kosmopolitische Zusammensetzung der Schülerschaft zu nennen; dazu gehörten Stipendiaten aus Zypern, dem Nahen Osten und sogar aus China. Der junge Arouet empfand die Sprache seiner asiatischen Kommilitonen als eigentümlich ungegliedert, doch könnte der Kontakt mit ihnen sein später so markantes Interesse an der chinesischen Hochkultur geweckt haben, die von den moralischen und politischen Beschädigungen durch das Christentum und die Papstkirche verschont geblieben war.
So verwundert es nicht, dass der Sohn des Sporteleinnehmers am Rechnungshof schon bald in den Annalen der Eliteschule ehrenvolle Erwähnung fand. Für die französische Übersetzung eines lateinischen Gedichts an Genoveva, die Stadtheilige von Paris, die als Nothelferin in schwerer Zeit angerufen wurde, erwarb sich der Fünfzehnjährige nicht nur hohes Lob, sondern auch ein Stückchen Ewigkeit: Seine Verse wurden aufwendig gedruckt und sind der Nachwelt erhalten. Die so verheißungsvoll begonnene Schulkarriere setzte sich glanzvoll fort. Am Ende des Unterrichtsjahres 1709/10 trug François-Marie Arouet gleich zwei erste Preise davon: in lateinischer Prosa und in französischen Versen. Als Ehrengeschenk erhielt der Vorzeige-Eleve ein dickes Buch mit dem Titel Die Geschichte der Bürgerkriege in Frankreich. Natürlich stammte die Darstellung der Kriege zwischen Katholiken und Hugenotten im späten sechzehnten Jahrhundert aus der Feder eines Jesuiten, der darin die Rolle der ultrakatholischen Partei, des Papstes und Spaniens verherrlichte. Auch dieses Präsent erzielte andere Wirkungen, als es sich die stolzen Patres erhofften: Wenige Jahre später sollte ihr Musterschüler ein großes Versepos vorlegen, in dem er die Idee der Glaubens- und Gewissensfreiheit pries, die seine Lehrer für die Wurzel allen Übels hielten. Trotz aller ideologischen Divergenzen blieb Voltaire seinem Lieblingslehrer Pater Porée lebenslang verbunden; diese Anhänglichkeit zeigt, dass er menschliche Qualitäten unabhängig von religiösen und politischen Überzeugungen zu würdigen wusste.
Weiterer Ruhm kam hinzu, als der Sechzehnjährige für einen alten Soldaten Verse verfasste, die diesem eine längst verdiente Pension einbrachten; sie waren so virtuos gedrechselt, dass der Ruf ihres Verfassers über die Schulmauern hinaus bis an den Hof drang. Für seine Lehrer war das erfreulich und bedenklich zugleich. Zum einen mehrte es das Ansehen der Schule, zum anderen kamen seelsorgerliche Bedenken auf: «Er ist vom Durst nach Berühmtheit zerfressen»,[8] notierte der Beichtvater des jungen Arouet besorgt. Das war ein Satz, der als Motto über dessen ganzer erster Lebensphase hätte stehen können. Noch viel tiefer wären die Sorgenfalten der Patres gewesen, wenn sie von den Gelüsten ihres Starschülers außerhalb des Collège Kenntnis gehabt hätten. Schenkt man autobiographischen Angaben Glauben, die als Reminiszenzen in spätere Briefe eingestreut oder in literarischen Texten verarbeitet wurden, dann befand sich der sechzehnjährige Gymnasiast in permanenter Geldnot, die er durch Anleihen bei Wucherern beiderlei Geschlechts zu beheben suchte, nicht ohne bei diesen dilettantisch eingefädelten Operationen kräftig übers Ohr gehauen zu werden. Ob diese Episoden tatsächlich erlebt oder nur hübsch erfunden waren, der Drang, sich den aristokratischen Normen seiner privilegierten Mitschüler anzupassen, war offenbar unwiderstehlich. Für diese war Geld dazu da, prestigeträchtig für teure Kleidung, elegante Karossen und anspruchsvolle Mätressen ausgegeben zu werden. Ein solches Gehabe war zugleich eine Demonstration der Verachtung für das spießige Bürgertum und seine hausväterlichen Sittlichkeits- und Sparsamkeitsideale. Auch möglichst (melo)dramatisch ausgetragene Vater-Sohn-Konflikte standen weit oben auf der Renommee-Skala junger Adliger und solcher, die es ihnen gleichtun wollten.
Die glänzendsten Erfolge des Schülers Arouet datierten aus seinem vorletzten Jahr am Collège Louis-le-Grand, das ganz der «Rhetorik», also der Kunst der Rede, gewidmet war. Danach kam Theologie als Schwerpunktfach an die Reihe, womit für Voltaire zumindest im Rückblick die Zeit der Sottisen anbrach. Theologie, das hieß in den jesuitischen Lehrplänen des Schuljahres 1710/11: Scholastik nach Art des heiligen Thomas von Aquin (1225–1274). Schüchterne Versuche, die auch nicht mehr ganz taufrische rationalistische Philosophie René Descartes’ (1596–1650) – ebenfalls Absolvent eines Jesuitenkollegs – mit ihren «Gottesbeweisen» im Unterricht zuzulassen, waren von der Ordensleitung als gottlose Neuerung abgeschmettert worden. Mit der Mischung aus aristotelischer Philosophie und biblischen Glaubenssätzen aber konnte der brillante junge Verseschmied Arouet absolut nichts anfangen. So stürzte der Primus zum Klassenletzten ab. Eine erste Thesenverteidigung im Mai 1711 wurde als nicht bestanden bewertet. Die Vermutung liegt nahe, dass er passiv gegen einen Prüfungsstoff protestierte, den er später als abstruse Verirrung des menschlichen Geistes anprangerte. Seine Lehrer dürften den plötzlichen Leistungsabfall ähnlich erklärt haben, denn ein zweiter Versuch wurde ihm wegen «Migräne» erlassen. Der erfolglose Kandidat selbst führte sein Scheitern auf persönliche Gründe zurück:
Allzu sehr bemerke ich allenthalben, dass Ihr nicht mehr da seid; jedes Mal, wenn ich durchs Fenster schaue, sehe ich Euer Zimmer leer; ich höre Euch im Klassenzimmer nicht mehr lachen; ich spüre Euer Fehlen überall, und mir bleibt nur noch das Vergnügen, Euch zu schreiben… Eure Abreise hatte mich so durcheinandergebracht, dass ich weder Geistesgegenwart noch Kraft hatte, mit Euch zu sprechen, als Ihr kamt, um mir Adieu zu sagen; und als ich am Abend meine These verteidigen sollte, antwortete ich den Disputanten ebenso schlecht wie auf die Freundlichkeiten Eures Abschieds. Und wenn ich bald noch einmal antreten werde, brauche ich Euch dringend, um mich etwas zu erholen.[9]
Empfänger dieser Freundschaftsschwüre, die in den nachfolgenden vier Briefen noch glühender ausfielen, war Claude Philippe Fyot de la Marche, Sohn eines hohen Amtsadligen aus Dijon, der das Glück hatte, den theologischen Exerzitien des Collège einige Monate früher zu entrinnen.
Was wie rasende Verliebtheit anmutet, war empfindsamer Freundschaftskult – und damals unter jungen Leuten angesagt. Zugleich war sich der Briefschreiber bewusst, dass er an einen Höhergestellten schrieb, den er für sich einnehmen wollte. Das stellt die zweifellos vorhandene Sympathie für den ehemaligen Klassenkameraden nicht infrage, gibt dem Schreiben aber eine besondere Note, die sich durch die gesamte Korrespondenz Voltaires, die mit diesem Brief ihren Anfang nahm, hindurchzieht: Emotionale und nützliche Freundschaft konnten durchaus zusammenfallen, doch war der Ausdruck persönlicher Wertschätzung nicht selten reines Mittel zum Zweck. Darüber hinaus war der schriftliche Gedanken- und Gefühlsaustausch mit Fyot de la Marche – dessen Antworten leider nicht erhalten sind – auch eine Stilübung und ein Mittel der Selbstvergewisserung, wie die Reflexion über die eigene Sprache und die des Freundes belegt. In erster Linie aber dokumentieren die Briefe aus der späten Schulzeit Voltaires zunehmende Distanz gegenüber der Anstalt und ihren Lehrern – und seinen ausgeprägten Sinn für Komik:
Ein Trauerspiel des Paters Lejay ist wegen starker Regenfälle buchstäblich ins Wasser gefallen; zwei Mönche auf der Treppe sind so spektakulär gestürzt, dass die Erheiterung der Schüler keine Grenzen kannte; der Besuch des Nuntius seiner Heiligkeit hat erfreulicherweise acht Tage schulfrei mit sich gebracht; Pater Porée betete um schönes Wetter, woraufhin ein neuer Wolkenbruch einsetzte.[10]
Damit war ein ironischer Ton angeschlagen, der sich in den Briefen Voltaires nicht mehr verlieren sollte:
In der Freundschaft muss alles gleich sein, und um meine Schuld wettzumachen, werde ich mich nicht mehr [über ausbleibende Briefe des Freundes] beklagen. Und was Euch betrifft, so wird Eure Buße darin bestehen, mir zu schreiben, sobald Ihr meinen Brief erhalten habt. Mit welchem Vergnügen ich Euch diese Buße auferlege! Ich hoffe, dass Ihr sie genauso gern auf Euch nehmt. Und da wir gerade von Buße reden, fällt mir eine ziemlich komische Sache ein, die mir Herr Blanchard [wohl ein weiterer Schulkamerad] erzählte. Er teilte mir mit, dass Ihr mit mir zusammen dem Orden [der Jesuiten] beitreten wolltet. Ich antwortete ihm, dass ich nicht genügend Verdienste besäße, um mich zu dieser Seite zu wenden, und dass Ihr zu viel Geist hättet, um eine solche Dummheit (sottise) zu begehen.[11]
Die Passage zeigt schlaglichtartig, wie kritisch der knapp Siebzehnjährige dem Milieu gegenüberstand, das er bald verlassen sollte:
In der Tat, ich glaube nicht, dass wir große Lust haben, gewisse Schüler des Jesuitenkollegs nachzuahmen, die aus ebenso frommen wie albernen, ja geradezu lächerlichen Gesprächen und Reflexionen über die Gefahren dieser Welt, deren Zauber sie noch gar nicht kennen, und aus der Süße des Klosterlebens, dessen Ekel ihnen unbekannt ist, die Schlussfolgerung ziehen, dass man sich von dieser Welt abwenden soll.[12]
Das ist noch kein Manifest der Kirchen- oder auch nur Jesuitenfeindlichkeit, sondern schlicht Ausdruck eines unbändigen Freiheitsdranges, gewürzt mit Spott über die Lebensängstlichkeit der anderen. Den Zöglingen des Collège, die als Lehrer an dieses zurückkehren wollten, mangelte es offenbar an Mut: «Selbst wählen war zu schwer für sie.»[13] François-Marie Arouet aber war entschlossen, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Der Zauber der Welt außerhalb der Internatsmauern war unwiderstehlich, wie viel auch immer er davon schon gekostet haben mochte. Und außer Hemmungen und Vorurteilen gab es dort nichts zu verlieren.
Solchen Äußerungen bereits ein festgefügtes Weltbild zu unterstellen, würde bedeuten, intellektuelle Erkenntnisse nachfolgender Lebensphasen in diese «Uranfänge» zurückzuprojizieren, aber einige glaubwürdig überlieferte Episoden lassen doch zumindest Ansätze solcher Entwicklungen erkennen. So machte schon zu Lebzeiten Voltaires die Anekdote die Runde, dass ein erzürnter Jesuitenpater nach einer aufsässigen Replik des Schülers Arouet wütend und prophetisch zugleich ausgerufen habe, dieser werde einst der Herold des Deismus in Frankreich werden. Dazu ist zu bemerken, dass die Jesuiten bei der Brandmarkung ihrer Gegner sehr plakative Etikettierungen verwendeten und keinen großen Unterschied zwischen dem hier unterstellten Glauben an einen nichtchristlichen Schöpfergott und Atheismus oder anderen «Irrlehren» machten. Der Vorfall – wenn er sich denn so abgespielt hat – zeugt somit allenfalls von zunehmender Skepsis gegen Indoktrinierung und vom Streben nach Gedankenfreiheit.
Lehrjahre bei Juristen und Libertins
Die Zauber dieser Welt wollten genossen werden, doch das war leichter gesagt als getan. Konkret stellte sich jetzt die Frage, wie es beruflich weitergehen sollte. Sieben Jahre Lehrzeit im Louis-le-Grand waren eine respektable erste Etappe, doch mehr auch nicht. Für den besorgten Vater kam nur die sichere und profitable Juristenlaufbahn infrage, um den ebenso nutzlos wie gefährlich talentierten Sohn vor weiteren Verirrungen zu schützen. Das Berufsziel des Sohnes stand allerdings ebenfalls fest. Er wollte ein homme de lettres werden. Der unübersetzbare, im deutschen Kultur- und Gesellschaftsleben der Zeit eher verpönte Begriff bezeichnete den geistvollen Mann von Welt, der mit eleganten Dichtungen bezaubert, mit ebenso gedankenreichen wie fesselnden Essays die Welt erklärt, in den Salons der vornehmen Gesellschaft durch frivole Bonmots brilliert und im Idealfall sogar den Mächtigen mit philosophisch fundierten Maximen zur Seite steht. Für den Vater hingegen waren diese professionellen Schöngeister Schmarotzer und Hungerleider der schlimmsten Art. Und der Vater saß am längeren Hebel, so dass der Möchtegern-Literat ab 1711 die harte Bank der Rechtsschule drücken musste, mit dem deprimierenden Ziel vor Augen, als Rechtsanwalt in der ödesten aller beruflichen Welten zu enden. «Was mich betrifft, so hat mich am Advokaten-Beruf am meisten die Menge unnützer Dinge abgestoßen, mit denen man mein Gehirn belasten wollte»[14] – so der Fünfundvierzigjährige im schaudernden Rückblick auf seine fremdbestimmten Anfänge. Damit gewinnt ein weiteres Feindbild Konturen: das französische Rechtssystem, das jeglichem natürlichem Rechtsempfinden Hohn sprach und in Voltaire seinen eloquentesten Gegner finden sollte.