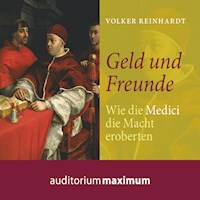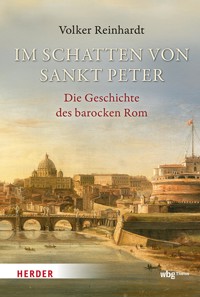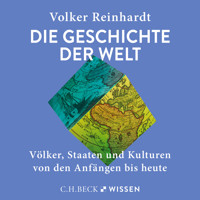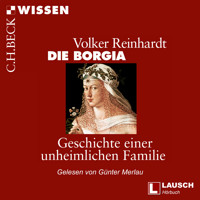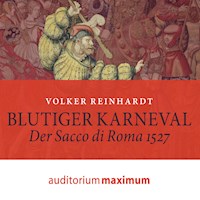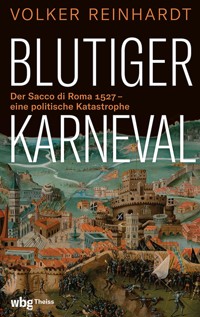
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rom befindet sich auf dem Gipfel der Hochrenaissance, als am 6. Mai 1527 ein Heer des allerkatholischsten Kaisers Karl V. die Ewige Stadt stürmt und in der Folgezeit ein regelrechtes Terrorregiment am Tiber errichtet – sacco di roma. Papst Clemens VII. muss nach der Einnahme Roms monatelang in der Engelsburg als Gefangener in seiner eigenen Hauptstadt ausharren. Eine besondere Zuspitzung erfährt das Geschehen dadurch, dass ein großer Teil der kaiserlichen Söldner lutherisch gesinnte Landsknechte sind, die glauben, den Antichrist in Person zu bekämpfen. Volker Reinhardt, Bestseller-Autor, Stilist von Rang und einer der besten Kenner der italienischen Renaissance, macht aus diesem Stoff ein Meisterstück der historischen Rekonstruktion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Abbildungsnachweis: bpk Berlin: S. 61; picture-alliance: S. 25, 27, 59, 77, 80, 98, 120; WBG-Archiv: S. 16, 19, 21, 31, 34, 41, 52, 64, 68, 97, 115, 127, 134/135
wbg Theiss ist ein Imprint der Verlag Herder GmbH
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
2., bibliographisch aktualisierte Auflage
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Martin Veicht, Arnstorf
Umschlagmotiv: „Roma Capta Anno 1527“.
Flämisches Gemälde, 16. Jhr.
© wikimedia.commons
Satz: schreiberVIS, Seeheim
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print: 978-3-534-61026-6
ISBN E-Book (E-Pub): 978-3-534-61043-3
ISBN E-Book (PDF): 978-3-534-61044-0
Inhaltsverzeichnis
I. Präsentation. Der Sacco di Roma oder: Von der Unwirklichkeit der Geschichte
II. Wege in die Katastrophe. Der Sacco di Roma aus der Sicht des 21. Jahrhunderts
Der lange Kampf
Das lange Schwanken
Die lange Angst
Der lange Marsch
Der längste Tag
Die längste Nacht
III. Bilder einer Plünderung
Die Verkörperung des Bösen. Der Sacco der Römer
Ins Herz des Bösen. Der Sacco der Söldner
Das Böse in der Kirche. Der Sacco der Reformer
Das Böse in der Kultur? Die Debatte der Humanisten über den Sacco
Das Böse in der Geschichte. Die Historiker und der Sacco
Kommentierte Bibliographie
Personenregister
I. Präsentation.Der Sacco di Roma oder: Von der Unwirklichkeit der Geschichte
Nach allerlei diplomatischen und militärischen Irrungen und Wirrungen wird im Mai 1527 eine Stadt von gut 50 000 Einwohnern geplündert, findet danach aber ziemlich rasch wieder zur politischen und wirtschaftlichen Normalität zurück. Tiefere Spuren bleiben im Stadtbild wie auch in den Bildern, die in dieser Stadt gemalt wurden, nicht zurück. Der Herr dieser Stadt, dem Verderben selbst nur um Haaresbreite entronnen, trifft sich knapp drei Jahre später mit dem Auftraggeber der Truppen, welche die Stadt geplündert haben, und zwar so feierlich und einträchtig, als wäre nichts gewesen. Ja, er setzt dem Herrn seiner Peiniger in Bologna sogar die Kaiserkrone aufs Haupt. An beider Politik und Herrschaftsstil ändert sich gleichfalls nicht das Geringste: keine Reue und erst recht keine Umkehr, weder in Taten noch in Worten oder in Bildern. Auch die weniger hoch gestellten Überlebenden haben an dem, was man nach 1945 „Bewältigung der Vergangenheit“ nennt, nicht das geringste Interesse. Einige der Geschundenen schreiben immerhin auf, was sie erlebt haben – oder vorsichtiger ausgedrückt: was sie gesehen zu haben glauben. Fast immer greifen sie spät zur Feder. Und nichts ist so wetterwendisch und formbar wie das menschliche Gedächtnis. Zudem legen die Opfer ihre Eindrücke nieder, um Sinn im scheinbar Sinnlosen zu finden. Diesen Sinn aber stiften Schuldzuweisungen und Feindbilder. An ihnen kann man sich orientieren, ja festhalten, ja sie sind praktische Lebenshilfe. Dasselbe gilt für die Beschwörung, die bis heute auf alle Katastrophen folgt: nie wieder, wehret den Anfängen. Mit diesen beruhigenden Versicherungen aber ist auch für die Opfer der Fall abgeschlossen. Am Ende steht für sie die tröstlichste Banalität überhaupt: Das Leben geht weiter.
Die Opfer, die zu Tätern werden müssen, um zu überleben, sind nicht die Einzigen, die geschrieben haben. Zur Plünderung der Stadt und zur Gefangennahme ihres Oberhaupts äußert sich, wer Europa seine Meinung schuldig zu sein glaubt. Und das sind schon damals nicht wenige. So wird der 6. Mai 1527 zum Medienereignis schlechthin. Mit einer weiteren Analogie zur Gegenwart: Nichts welkt so schnell wie die Sensationsnachricht von gestern. Man findet in der unerhörten Begebenheit die vorgefassten Meinungen bestätigt und geht gestärkt an sein Alltagswerk zurück. Auch wenn die meisten Augenzeugen erst mit beträchtlichem Abstand zum erlebten Schrecken zur Feder greifen, gilt für die Öffentlichkeit: Der Fall ist gelöst, die Akten schließen sich von selbst.
Warum soll man sie dann – ein knappes halbes Jahrtausend später, doch ohne jede Jubiläums-Rechtfertigung – wieder öffnen? Um durch Furcht und Schrecken Einkehr und Einsicht zu erzeugen? Da kann der Moralist des 21. Jahrhunderts nur bittere Tränen lachen. Durch Drogen zu Mordmaschinen mutierte Kindersoldaten in der Hauptausgabe der Tagesschau, zerquetschte Verkehrstote in den Regionalnachrichten, öffentlich-rechtlich ausgestrahlte Privatvideos von abstürzenden Flugzeugen und Attentaten aus nächster Nähe: Der Fernseh-DVD-Video-Internet-Mensch, durch die Macht der Technologien zum Voyeur des seriellen Todes verformt, konsumiert Horror in einer täglichen Überdosis, die abstumpft oder, schlimmer noch, süchtig macht.
Warum dann also von der Katastrophe des Jahres 1527 erzählen? Weitere Argumente scheinen sich anzubieten. Verwüstet wird schließlich nicht eine Allerwelts-Stadt, sondern Rom, die vermeintlich Ewige Stadt, einst Herrin eines Imperiums, jetzt Sitz des Papstes, der sich als Herr der Christenheit, und zwar in geistlicher, kirchlicher und politischer Hinsicht, versteht. Ja, er glaubt sogar daran, an einem sakrosankten, d. h. unantastbaren Ort zu leben. In dieser Überzeugung bestärken ihn so viele Meisterfresken in seiner Residenz, dem Vatikan. Sie zeigen Rom als vom Himmel geschütztes Refugium inmitten einer heillosen Welt, als sicheren, da von Engeln und Aposteln verteidigten Hort unwandelbarer Wahrheit im unruhigen Meer der Geschichte. Vieles spricht dafür, dass die Päpste der Zeit daraus den Schluss zogen, sich gefahrlos in die wild bewegten Gewässer der europäischen Machtpolitik stürzen zu können. Hinterher, als sie es besser wussten, lautete ihre Anklage daher: Blasphemie, Schändung des Heiligen. Doch auch solche Profanierungen hat Europa in seiner Geschichte sehr viel erinnerungsmächtiger erlebt. Die Söldner des Jahres 1527 raubten römische Kirchen leer, die Sansculotten des Jahres 1794 rissen ganze Kathedralen ab; die Plünderer des Sacco di Roma verhöhnten Priester in Spottprozessionen, die Jakobiner ertränkten sie zu Tausenden in der Loire.
Kann man, wenn sonst nichts zählt, wenigstens aus der Geschichte der großen Plünderung für das Leben und die Zukunft lernen? Schon bei den scharfsinnigsten Zeitgenossen stellt sich Kopfschütteln, wenn nicht Hohngelächter ein. Hat die Katastrophe von 1527 doch ein gutes halbes Jahr zuvor ihr Vorspiel, oder besser: ihre Generalprobe, ja ihre Voraus-Äffung. Dem großen Sacco geht nämlich im September 1526 die kleine Plünderung durch die mit Papst Clemens VII. verfeindete Adelsfamilie Colonna voraus, und zwar so, als werde hier für den Ernstfall geübt. Und dennoch wird der Papst, als es im März und April 1527 ernst wird, auf eine mehr als unverbindliche Friedensnachricht hin seine – ohnehin schon schwachen – städtischen Schutztruppen entlassen. Man kann gar nicht aus der Geschichte lernen, weil diese sich nicht wiederholt.
Das ist ein unerhörter Satz, damals wie heute. Die Entdeckung der Wahrheit, die in ihm beschlossen ist, geht unmittelbar auf den Sacco von 1527 zurück. Damit ist endlich eine erste ernst zu nehmende Rechtfertigung gefunden, seine Geschichte erneut aufzurollen. Einer der Akteure auf der militärischen und diplomatischen Bühne nämlich, Francesco Guicciardini, gibt sich mit den gängigen Erklärungen für das Unheil nicht zufrieden. Das liegt daran, dass er persönlich involviert ist. Während der Ereignisse selbst kann er nicht so handeln, wie er möchte, denn sein Herr folgt seinen Ratschlägen nicht; nach der Katastrophe aber wird er für diese haftbar gemacht. Es geht ihm also darum, auf Gewissen und Ehre abzuklären, wie es dazu kommen konnte: durch die Prüfung seines Gewissens und zur Rettung seiner Ehre. Doch das ist nicht alles. Eine noch peinigendere und peinlichere Frage steht im Raum. Den Herrscher, der das Unheil in die Wege leitete, beriet ein braintrust von seltener Exzellenz. Neben Guicciardini konnte man die Meinungen von Niccolò Machiavelli, dem exzentrischen politischen Meisterdenker der Neuzeit schlechthin, einholen. Und auch, was Francesco Vettori, der sich in seinem Briefwechsel mit Machiavelli diesem mindestens ebenbürtig erweist, darüber dachte, war bekannt. Ganz zu schweigen davon, dass der Nuntius des Papstes bei Karl V., dem Dienstherrn der Plünderer, Baldassare Castiglione hieß, seines Zeichens Autor des Buchs vom Hofmann. Das war ein Bestseller, der den Höfling das feine Leben bei Hofe zu lehren versprach, in Wirklichkeit aber mindestens ebenso gründlich die Abgründe höfischer Unmoral aufdeckte und die Kunst des schönen Scheins vermittelte.
So viel Ahnung des Kommenden, so viel geballte Intelligenz im unmittelbaren Umkreis der Macht, die das Heil verspricht und das Unheil anzieht. Warum vermag so viel Klugheit die Katastrophe nicht zu vermeiden, warum bleibt der Geist ohnmächtig gegenüber der Macht? Machiavelli kann darüber nicht mehr lange nachdenken, er stirbt 46 Tage nach der Erstürmung der Ewigen Stadt. Seine Antwort lässt sich dennoch beschwören; aller Wahrscheinlichkeit nach hätte sie gelautet: Man hätte den alten Römern folgen und sich nicht mit leeren Versprechen begnügen sollen. Guicciardini und Vettori aber fühlen sich gedrängt, bohrender und unerbittlicher nachzuforschen; am Ende stoßen sie auf eine neue Vorstellung von der Geschichte, deren Entwicklung aller menschlichen Planung Hohn spricht. Der Sacco di Roma macht, so betrachtet, bis heute jede Versöhnung mit der Geschichte unmöglich.
Doch seine Darstellung hat noch mehr zu bieten. Launen der Fortuna, ehernen Gang des Schicksals, Blindheit, mit der Gott die Akteure schlägt, Strafe des Himmels, Zerstörungswillen des Bösen, das sich in einzelnen Mächtigen oder im Pöbel manifestiert, Bestialität des Krieges, Gefahren der Anarchie, die unvermeidlichen Folgen der Volksherrschaft, die Schwäche der italienischen Staatenlandschaft und speziell den Niedergang ihres Militärwesens, den Aufstieg neuer Nationen, die Polemik der Reformation, die Verweltlichung des Papsttums, den Verlust von traditionellen Werten, die Verwilderungen einer Übergangszeit bzw. den ruchlosen Geist einer neuen Epoche, der Renaissance – das alles (und einiges mehr) haben Zeitgenossen und Historiker bis heute als Hauptursachen des Sacco namhaft gemacht. Doch auch das alles ist nicht alles. Europa findet in der jeder Wahrscheinlichkeit spottenden Verkettung von Ursachen und Wirkungen seine Ängste in einer Verdichtung ohnegleichen wieder. Auf einen einzigen gemeinsamen Nenner gebracht, ist es die Angst vor der Entgrenzung, vor der Ausuferung der Gewalt und der Geschichte insgesamt. 1527 brechen, so scheint es den Beobachtern, alle Dämme. Und eine Sturmflut dieser Art kann niemand gewollt oder gar verursacht haben. Karl V., erwählter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und König von Spanien, wusch schon gleich danach die Hände in Unschuld. Gewiss – so seine Rechtfertigung –, er musste sich wehren: gegen die aggressiven Umtriebe des Papstes als Verbündeter seiner Feinde, doch die Plünderung, nein, die hatte an seinem Hofe niemand auch nur zu denken gewagt. Wie sie trotzdem zustande kommen konnte? Dann musste eben Gott seine Hände im Spiel haben – Grund zur Strafe mochte Er in Rom wohl reichlich gefunden haben. Selbst der Anführer der Landsknechte, die zusammen mit den Spaniern den Großteil der Beute einheimsen, beteuert, dergleichen nie geplant zu haben. Wie sollte er auch, liegt er doch in Ferrara auf dem Krankenbett. Seine Truppen sind ohne ihn weitergezogen und haben ohne seine Billigung geplündert. Der Feldherr, der sie schließlich befehligte, kann sich nicht mehr äußern, denn er ist am Tag der Erstürmung an einer Verwundung gestorben. Dafür redeten und schrieben seine Offiziere. Speziell die Zeugenaussage der spanischen Hauptleute klingt ganz ähnlich: Eigentlich haben wir es nicht gewollt. Als wir mit unseren halb verhungerten Truppen vor den riesenhaften Aurelianischen Mauern Roms standen, warteten wir und harrten der Sendboten. Sie sollten endlich das bieten, was die Söldner wollen, aber seit mehr als einem halben Jahr nicht bekommen: Sold, Sold und noch einmal Sold. Wenn man uns dieses Geld geboten hätte, so ihre Schlussfolgerung, wären wir friedlich wieder abgezogen. Aber die Maultiere mit den Goldstücken bleiben im Stall. Dabei hätte Clemens VII. die verlangten Summen ohne Frage beschaffen können, z. B. wenn der römische Stadtrat einverstanden gewesen wäre. Und der Klerus. In der Stadt residieren immerhin mehr als zwei Dutzend Kardinäle, und die wohnen, so scheint es kurz danach den Plünderern, wie Götter auf Erden. Die römischen Adeligen und Kaufleute stehen ihnen an Luxus kaum nach. Die 300 000 Dukaten, die man zur Abfindung der Söldner benötigt hätte, wären eine Kleinigkeit gewesen – nicht nur im Verhältnis zu den Millionen, die diese kurz danach erbeuten. Doch niemand ist zu zahlen bereit. So lautet die Rechtfertigung von Offizieren und Mannschaften vor den Mauern: dann mussten wir eben kämpfen. Und uns holen, was uns zustand, mit Zins und Zinseszins. Wer nicht zahlen will, muss sich plündern lassen.
Irritierend an all diesen Beteuerungen, nicht aus freien Stücken gehandelt zu haben, ist, dass sie subjektiv vollkommen aufrichtig sind. Aus eben diesem Grund entspringen die Urängste: Wer bringt hervor, was offensichtlich niemand beabsichtigt hat? Gott oder der Teufel – der Geist der Zeit lässt hier wenig Alternativen. Die wenigen, die an beide nicht glauben, zitieren die Unvernunft der Mächtigen und die unheimlichste aller Mächte, den Zufall.
In beidem gibt ihnen die historische Forschung des 21. Jahrhunderts recht. Die Zufälle, die sich da aneinanderreihen, sind in der Tat äußerst ungewöhnlich. Dass der bis dato verehrte Vater der Landsknechte, Georg von Frundsberg, in so vielen Gefechten gestählt, just im entscheidenden Augenblick einen Schlaganfall erleidet und nicht mehr sprechen kann – wo es doch auf jedes Wort ankommt. Dass Charles de Bourbon, der Kommandant, der an seine Stelle tritt, von seinem König aufgrund von Streitigkeiten über Besitz und Rang abgefallen, in den Augen nicht weniger Standesgenossen damit seine Ehre verlor und daher nichts mehr zu verlieren hat. Dass die einzige Gesandtschaft, die wirklich das heiß ersehnte Geld zu den Söldnern bringen will, von marodierenden Bauern überfallen wird und daraufhin das feindliche Heer nicht mehr findet. Dass ausgerechnet am Morgen des 6. Mai 1527 vor und hinter den römischen Mauern ein so dichter Nebel aufsteigt, dass die mächtigen Geschütze der Engelsburg nicht auf die Angreifer feuern können. Dazu kommen abgefangene Briefe, Verschwörungen, Ablenkungsmanöver und Finten, die man einem Alexandre Dumas in bester Fabulierlaune nicht abnehmen würde. Europa zeigt sich zwischen Februar 1525 und Mai 1527, so scheint es, von seiner absurdesten Seite: Geschichte wie aus dem Tollhaus, die Welt ist aus den Fugen geraten, ja ein Narrenschiff – so die Moralisten unter den Kommentatoren.
So betrachtet, lehrt der Weg in den Sacco bis heute das Staunen – und das soll er auch: Er zeigt die Unplanbarkeit, ja Unvorstellbarkeit des Wirklichen, ganz im Sinne der großen Geschichtspessimisten Guicciardini und Vettori. Doch auch das kann vom Anspruch der Geschichte her nicht alles sein. Der Sacco di Roma spiegelt, einem Geschichtsbeben gleich, die Umbrüche und Bruchstellen der Zeit: die Kluft zwischen der Weltsicht der Elite und den Mentalitäten des Volkes, die die kaiserliche Armee unlenkbar machte; die Labilität des politischen Gefüges in Italien, die fremde Mächte anziehen musste; die Probleme frühmoderner Staaten, die durch erhöhte Steuern zur Rebellion der Untertanen und durch Beschneidung von Mitregierungsansprüchen zum Abfall der Großen führen, aber trotzdem nie die benötigten Geldmittel gewinnen; die Entwicklung des Renaissancepapsttums, das Politik und vor allem Nepotismus zur Hauptsache macht; den Beginn des Konfessionellen Zeitalters, in dem jede Kirche zur Vernichtung der anderen aufruft; die Allgegenwart eines Krieges, den man weder bezahlen noch eingrenzen kann; den Widerspruch zwischen den Beschwörungen christlicher Einheit und des Friedens, die mit nackter Staatsräson und vehementem Nationalismus kontrastieren. Damit aber tritt der Widerspruch zwischen den Rechtfertigungen der Herrschaft und ihrer faktischen Ausübung, ja der Riss zwischen traditioneller Legitimation und selbst herbeigeführter Delegitimation der Macht hervor. Und eine weitere, abgrundtiefe Kluft tut sich auf, die zwischen dem maßlosen Geiz eines Papstes, der das rettende Lösegeld nicht hergibt, und den Folgen der vermeintlichen Einsparung. Geiz macht arm – auch hier kommen die Moralisten auf ihre Kosten. An weiteren, unüberbrückbar scheinenden Gegensätzen herrscht kein Mangel: Aufhetzung des Volkes und Urangst vor dessen ureigenen Regungen, virtuose Instrumentalisierung des Scheins und naiver Glauben an die eigenen und die fremden Lügen, Skrupellosigkeit und Endzeitangst vermischen sich zu einem die Vorstellungskraft sprengenden Handlungsgefüge.
So betrachtet, wird der Sacco di Roma zum Epochendrama in einem Welttheater – zeitgebunden im Einzelnen, zeitlos im Großen. Doch auch das ist nicht alles. Es gibt den Sacco, wie ihn die historische Forschung unter Aufbietung aller ihrer Disziplinen ganzheitlich zu rekonstruieren bemüht ist: überblickter, geordneter, vollständiger, ja totaler, als ihn irgendein Zeitgenosse jemals wahrzunehmen vermochte. Diese Zusammenstellung im Abstand eines knappen halben Jahrtausends aber ist ein Kunstprodukt, bei aller Faktengenauigkeit letztlich unhistorisch, da so von niemandem in der Zeit selbst gesehen. Geschichtsmächtig sind allein die Bilder des Sacco, die sich die Zeitzeugen selbst gemacht haben; sie allein sind im produktiven Sinne anstößig, bringen neue Schlüsse und Entwicklungen hervor. Wirklichkeit, Unwirklichkeit, Überwirklichkeit durchdringen und verschränken sich in irritierender Entgrenzung. Der Sacco in den Köpfen aber ist, verglichen mit dem Sacco der Forschung, ähnlich und anders zugleich. Er ist verkürzter, einseitiger und vor allem emotionaler. Er ist lebendig, da er als Argument und Beweisführung in Gegenwart und Zukunft dient; er ist Beleg, Einspruch, Forderung oder Anklage.
Am Anfang dieses Buches steht der deutende Ereignisbericht. Was ist aus der Sicht des Historikers, der unbehindert von mühseligen Verkehrswegen, klimatischer Unbill, Geldknappheit und Angst die oft genug verschlungen anmutenden Abfolgen der Begebenheiten, die großen Pläne der Mächtigen sowie die unvorhergesehenen Abweichungen von diesen, die Routen der Heere wie die Ströme der Nachrichten zu überblicken und zu ordnen versucht, eigentlich geschehen – und warum? Von restfreier Ausleuchtung ist auch das so zustande kommende Bild weit entfernt; Vermutungen und Hypothesen bleiben unverzichtbar, Lücken tun sich weiterhin auf, Rätsel bleiben ungelöst. Und natürlich begeht jeder Interpret des 21. Jahrhunderts, auch wenn er sie noch so scheut, die Ursünden der Geschichtswissenschaft: Er operiert mit der Zeit fremden Denkmustern und Begrifflichkeiten, vermengt den Geist seiner Zeit mit dem der Vergangenheit. Sein Bild ist damit zeitgebunden wie das der Zeitgenossen, das den zweiten Teil des Buches ausmacht. Deren Wahrnehmung vermag die Metapher des Prismas am besten zu verdeutlichen. Denn sie stellt sich als eine Abfolge von optischen Brechungen, als eine Auffächerung von Sichtweisen dar, die sich allesamt ähnlich und doch unverwechselbar sind: der Sacco der Römer, der Sacco der Söldner, der Sacco der kirchlichen Reformer bzw. Reformatoren, der Sacco der Humanisten und schließlich der Sacco der zeitgenössischen Historiker.
II. Wege in die Katastrophe. Der Sacco di Roma aus der Sicht des 21. Jahrhunderts
Der lange Kampf
Schon für die Zeitgenossen war der Weg ins Unheil alles andere als eine Einbahnstraße. Bar aller zwingenden Notwendigkeit, offen bis zum letzten Akt, setzte die Entwicklung, die in die große Plünderung mündet, zweieinhalb Jahre zuvor, im Dezember 1524, ein. In diesem Monat nämlich schloss Papst Clemens VII., geboren 1478 als Giulio de’ Medici aus der mächtigsten Familie von Florenz, ein Bündnis mit dem französischen König Franz I. und nimmt damit offen Partei im Krieg um Mailand.
Die lombardische Metropole war zu diesem Zeitpunkt seit einem Vierteljahrhundert umkämpft; wegen keines anderen Platzes im damaligen Europa wurde so viel Blut vergossen. Drei Dynastien traten als Konkurrenten auf, und zwar mit Erbansprüchen und mit Waffengewalt. An der Macht war seit einem halben Jahrhundert, zumindest offiziell, die Familie Sforza, die die legitime Nachfolge der Visconti beanspruchte. Die seit 1447 in der Hauptlinie ausgestorbenen Visconti waren in diesen endlosen Konflikten das Maß aller Dinge, Ausgangs- und Endpunkt aller Rechtfertigungsdebatten: Wer hatte das Recht, diese mächtigsten Stadtherren (signori) des 14. und 15. Jahrhunderts zu beerben? Die Sforza beriefen sich darauf, dass ihr Machtbegründer Francesco I. 1450 mit Zustimmung des mailändischen Adels und als Gatte einer Tochter des letzten Visconti-Herzogs zum rechtmäßigen Herrn von Mailand erhoben wurde. Ihre Rivalen bestritten diese Legitimität mit der Begründung, dass seine Gemahlin den Makel unehelicher Abkunft aufweise. Mit starken Argumenten forderte der französische König Ludwig XII. Mailand als Erbe seines Hauses ein – er stammte von einer legitimen Tochter des mächtigen Herzogs Gian Galeazzo Visconti ab, deren Nachkommen bei der Eheschließung die Nachfolge zugesagt worden sei. Der Anspruch des spanischen Königs und römischen Kaisers Karl V. aus dem Hause Habsburg hingegen gründete sich auf die Lehenshoheit des Reiches, wonach dessen Oberhaupt zur Einsetzung des legitimen Herzogs allein befugt sei. Zwischen den Machtblöcken Frankreichs und Spaniens schrumpften die Sforza rasch zu einer nachgeordneten Größe, ja zu einem Spielball. 1512 trat dann mit den regierenden Orten der Eidgenossenschaft unerwartet ein vierter Prätendent auf den Plan, der durch seine überragende militärische Schlagkraft drei Jahre lang, zwischen 1512 und 1515, sogar die Oberhand gewann und mit einem Sforza-Herzog als Marionette die faktische Hoheit über die Stadt ausübte. 1524 aber waren die Schweizer nicht mehr Akteure in eigener Sache, sondern nur noch heiß umworbene und hoch bezahlte Söldner im Dienst der übrig gebliebenen Konkurrenten.