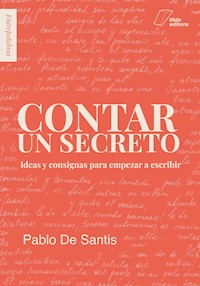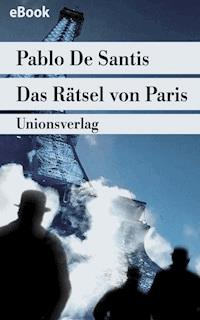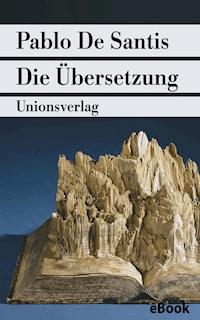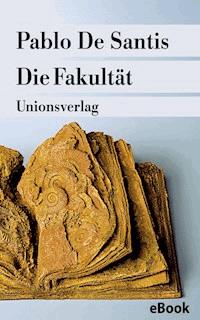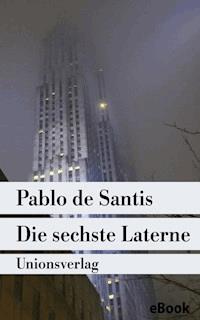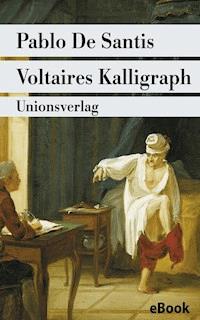
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Staunend folgen wir dem Kalligraphen Dalessius durch die Wunder des 18. Jahrhunderts: Automaten, erfinderische Henker, sonderliche Bordelle, frühe Computer, Hinrichtungsmaschinen, Teiche voller giftiger Fische, düstere Schlösser und die Linienkutschen für Leichen sind alle in den Kampf der Aufklärung gegen die finsteren Mächte des untergehenden Ancien Régime verstrickt. Voltaire und Dalessius decken einen ungeheuren Coup des Klerus auf, aber können sie ihn auch verhindern? Pablo De Santis erzählt uns die Zeit vor der Französischen Revolution so, wie wir sie garantiert noch nie gesehen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Aufklärung kämpft im 18. Jahrhundert gegen die die finsteren Mächte des untergehenden Ancien Régime. Voltaire und sein Kaligraph Dalessius decken einen ungeheuren Coup des Klerus auf, aber können sie ihn auch verhindern? Pablo De Santis erzählt uns die Zeit vor der Französischen Revolution so, wie wir sie garantiert noch nie gesehen haben.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Pablo De Santis (*1963) wurde in seiner Heimat Argentinien mit Jugendbüchern bekannt. Den internationalen Durchbruch schaffte er mit den Romanen Die Fakultät und Die Übersetzung.
Zur Webseite von Pablo De Santis.
Claudia Wuttke (*1966) studierte Soziologie, Philosophie und Komparatistik in Hamburg, Madrid und Berlin. Nach vielen Jahren als Lektorin ist sie als freiberufliche Literaturagentin und Übersetzerin tätig.
Zur Webseite von Claudia Wuttke.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Pablo De Santis
Voltaires Kalligraph
Roman
Aus dem Spanischen von Claudia Wuttke
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel El calígrafo de Voltaire bei Ediciones Destino, Barcelona.
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Pro Helvetia.
Originaltitel: El calígrafo de Voltaire (2001)
© by Pablo De Santis 2001
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Jean Huber, Le Lever de Voltaire (1765); Foto: AKG / Erich Lessing
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30616-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.05.2024, 19:00h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
VOLTAIRES KALLIGRAPH
Erster Teil — Der GehängteDie ReliquieErste BuchstabenFerneyDie KorrespondenzDie MitreisendeToulouseDer Ort des VerbrechensDie mechanische HandDie AufführungDie PrüfungDie BronzeglockeDie HinrichtungZweiter Teil — Der BischofDie Hand des AbtesEin Freund von V.Siccards HausVon Kneppers SpurenDas Schweigen des BischofsKolms StockClarissaDie GefangeneDas GrabSchläge gegen das FensterFabres’ SchülerMathildes FußDie FluchtDas Ende der ReiseDritter Teil — Der MeisterkalligraphWartenEin anonymes PamphletDie menschliche MaschineDie HalifaxDas Leben der StatuenEin weißes Blatt PapierHammer und MeißelDie verschlossene TürSilas DarelHieroglyphenBestandsaufnahmeDer Kopf aus MarmorMehr über dieses Buch
Thomas Wörtche: Voltaires Kalligraph: mehr als eine klassische Gothic novel
Über Pablo De Santis
Pablo De Santis: »Literatur ist ein Spiel«
Juan Manuel de Prada: Das Glück der Lektüre
Über Claudia Wuttke
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Pablo De Santis
Zum Thema Argentinien
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Lateinamerika
Erster Teil
Der Gehängte
Die Reliquie
Ich erreichte diesen Hafen mit wenig Gepäck: vier Hemden, mein Schreibwerkzeug und ein Herz in einem Glasbehälter. Die Hemden waren fleckig und mit Tintenklecksen übersät, und die Meerluft hatte meine Federn ruiniert. Das Herz hingegen hatte die Reise – den Unwettern und der Feuchtigkeit in meiner Koje zum Trotz – gänzlich unbeschadet überstanden. Herzen verausgaben sich im Leben. Danach kann ihnen nichts mehr Schaden zufügen.
Heutzutage kursieren unzählige philosophische Reliquien in Europa, die meisten von ihnen sind allerdings so falsch wie die Gebeine der Heiligen in den Kirchen. Früher waren sie die großen Helden dieses Aberglaubens. Doch wer risse sich heute noch um eine Rippe, einen Finger oder um das Herz eines Heiligen? Die Knochen und Schädel von Philosophen hingegen sind ein Vermögen wert.
Sobald irgendein Sammler in Paris einem Antiquar gegenüber vertrauensselig den Namen Voltaire fallen lässt, wird er sofort in ein Hinterzimmer geführt, wo man ihm unter dem Mantel der Verschwiegenheit ein Herz zeigt, das eher einem Stein gleicht und in einem goldenen Kasten oder einer Urne aus Marmor ruht. Die Summe, die sie dafür im Namen der Philosophie fordern, ist horrend. Ein düsterer, trügerischer Glanz umgibt diese falschen Herzen, während das echte hier bei mir liegt, auf dem Tisch, an dem ich schreibe. Der einzige Reichtum, den ich ihm anbieten kann, ist das Licht des Nachmittags.
Ich lebe in einem winzigen Zimmer, dessen Wände von Tag zu Tag brüchiger werden. Die Holzbretter auf dem Fußboden sind lose, und einige von ihnen kann man mühelos herausnehmen. Bevor ich morgens zur Arbeit gehe, deponiere ich das in ein abgeschabtes rotes Samttuch eingewickelte Gefäß in dem Hohlraum darunter.
Auf der Flucht aus all den Häfen, in denen man unsere Zunft als das letzte verbliebene Übel der alten Regierung betrachtete, gelangte ich schließlich zu diesem.
Im Nationalkonvent konnte man sich nur mit lauter Stimme durchsetzen, wir aber, die Kalligraphen, hatten lediglich gelernt, uns schreibend zu verteidigen. Und obwohl es sogar jemanden gab, der vorschlug, uns bloß die rechte Hand abzuschlagen, siegte am Ende die einmütige Überzeugung, es solle doch besser gleich der Kopf sein.
Meine Kollegen hoben weder den Blick von ihren Schreibtischen, noch machten sie sich die Mühe zu verstehen, was diese Rufe eigentlich besagten, die sie von Ferne hörten. Geduldig transkribierten sie weiter die Texte, die ihnen längst enthauptete Funktionäre zur Abschrift gegeben hatten. Manchmal, sei es als Warnung oder als Drohung gemeint, schob man ihnen eine verschmierte Liste der Verurteilten unter der Tür durch, und meine Kollegen übertrugen sie, ohne zu bemerken, dass ihr eigener, verlorener Name darauf stand.
Ich konnte entkommen, weil man mich vor Jahren gelehrt hatte, meine Augen vom Papier zu lösen. Ich hatte mir einen neuen Namen und einen weniger gefährlichen Beruf gegeben, hatte die Dokumente gefälscht, mit denen es mir gelang, die Wachposten zwischen dem einen und dem anderen Bezirk, zwischen der einen und der anderen Stadt zu passieren. Ich floh nach Spanien, aber mein Drang, möglichst weit weg zu kommen, hielt mich dort nicht lange. Ich heuerte auf dem einzigen Schiff an, das mich zerlumpt und mit dem wenigen Geld, das ich bei mir hatte, überhaupt aufnahm. Noch nie zuvor hatte ich – vielleicht in Erinnerung an meine Eltern, die bei einem Schiffbruch ums Leben gekommen waren meinen Fuß auf eine Planke gesetzt. In der Kajüte des Kapitäns wurden mir die zusätzlichen Leistungen diktiert, die ich für meine Überfahrt zu erbringen hatte, und ich bereitete mich auf eine gehörige Portion Korrespondenz mit Gläubigern und der Damenwelt vor. Im Nachhinein kann ich dankbar sein, dass meine Briefe noch einmal durchgesehen und die Fehler korrigiert wurden, denn so beherrschte ich bald die spanische Sprache.
Die Reise dauerte lange, das Schiff lief Hafen um Hafen an, und doch konnte ich mich nicht dazu entscheiden, in einem von ihnen von Bord zu gehen. Ich studierte die Formationen der Küsten und hoffte auf ein Zeichen, das mir meinen zukünftigen Platz bedeuten würde. Aber es gab nur ein Signal, das ich letztlich verstand, jenes nämlich, das besagte: Die Reise ist zu Ende. Im letzten Hafen vor der Rückkehr ging ich an Land.
Diese Stadt sucht sich niemand freiwillig aus. Wer hier landet, der flieht vor einer Regierung oder einer anderen Gefahr und kehrt schließlich der Welt selbst den Rücken. Als mich die Boote zum Ufer brachten, glaubte ich, dass mein Leben als Kalligraph ein Ende gefunden hatte, dass ich nie wieder einen Tropfen Tinte finden würde. Wer sollte in diesen dunklen, schlammigen Gassen schon nach einem Schreiber verlangen? Doch auch darin habe ich mich geirrt, denn bald schon entdeckte ich, dass das geschriebene Wort an diesem Ort zutiefst verehrt wurde, mehr noch als in den Städten Europas. Die Menschen hier lieben die gestempelten und unterschriebenen Anweisungen, die Papiere, die von Hand zu Hand gereicht werden und nach weiteren Papieren verlangen, die minutiösen Bestellungen, die nach Europa geschickt werden, die Liste mit den auf der Überfahrt beschädigten Waren. Alles hier wird gestempelt und in großen, von Arabesken geschmückten Lettern unterschrieben, bevor es in den ihnen gebührenden Schränken archiviert wird, die in ihrer Unordnung die Dokumente für immer schlucken.
Jeden Morgen setze ich in einem eiskalten Büro des Gemeindehauses offizielle Schreiben oder Gerichtsurteile auf. Die Angestellten erwähnen Voltaires Namen häufig, wenn ich ihnen aber sagen würde, dass ich für ihn gearbeitet habe, würden sie es mir nicht glauben. Für sie steht fest, dass alles, was sich jenseits ihrer Ufer ereignet, nicht wahr ist oder keine Bedeutung hat.
Der Wind dringt in mein Zimmer und fährt durch meine Papiere. Damit sie nicht wegfliegen, stelle ich das Herz darauf.
Erste Buchstaben
Nachdem meine Eltern bei dem Untergang der Retz ums Leben gekommen waren, kam ich zu meinem Onkel, dem Marschall de Dalessius. Er fragte mich nach meinen Fähigkeiten, und ich zeigte ihm ein paar Blätter, auf denen ich so getan hatte, als würde ich ein neues Alphabet erfinden. Auf einer Seite glichen die Buchstaben den Ästen eines Baumes, mit angedeuteten Blättern und zarten Verzweigungen. Eine andere Pappe zeigte orientalische Gebäude und Paläste, und auf der kunstvollsten, der dritten, weigerten sich die Buchstaben, Buchstaben zu sein. Mein Onkel wartete nur auf ein Zeichen, das ihm ermöglichte, mich loszuwerden, und so kamen ihm die Alphabete gerade recht. Er schickte mich in Monsieur de Vidors Schule für Kalligraphie, in der unter anderem schon der sagenumwitterte Silas Darel gelernt hatte.
Es dauerte jedoch nicht lange, und ich bekam Schwierigkeiten mit den Lehrern, weil es mir bald nicht mehr reichte zu schreiben. Ich wollte Federn und Tinte erfinden, wollte unsere Zunft neu begründen. Gestraft durch das Fehlen wahrer Meister, siechte die Kalligraphie dahin, umstellt von den Druckereien, reduziert auf isolierte Grüppchen oder einzelne Schreiber. Ich suchte in den Geschichtsbüchern nach Helden, die ich als Kalligraphen betrachten konnte, aber ich fand nur solche, die nie ein Wort schrieben.
Die Unermüdlichsten von uns, die, die den Weg von Silas Darel zu verfolgen suchten, stöberten nach Spuren, wo immer sie konnten, angefangen bei alten Schulhandbüchern bis hin zu den anonymen Abhandlungen der Kryptographie. So tot war dieser Berufsstand, dass wir uns als Archäologen unserer eigenen Zunft verstanden.
In dem Raum, in dem die Dokumente ausgestellt wurden, herrschte eine Ruhe, die lediglich vom Kratzen der Federn auf dem Papier unterbrochen wurde, und dieses Geräusch war die Metapher der Stille selbst. Der Saal war lang und an beiden Seiten mit Fenstern versehen, die auf Geheiß der Verantwortlichen stets geöffnet sein mussten, sogar im Winter, denn man meinte, dass ein gut gelüfteter Raum die beste Voraussetzung für einen gelungenen Buchstaben war. Durch die Öffnungen drangen Staub, kleine Zweige und Pinienblätter, die meine Kollegen ungehalten zur Seite wischten, die ich aber auf dem Blatt liegen ließ, weil ich der Meinung war, dass man die zufälligen Einflüsse, die den Prozess der Abschrift begleiteten, respektieren müsse. Mit Ausnahme einiger weniger beschieden sich die meisten mit dem Arbeitsmaterial, das die Schule alle sechs Monate von ihrem Lieferanten, einem portugiesischen Seemann, bezog: schwarze Tinte, die nach kurzer Zeit die Farbe verlor, rote Tinte, die schnell verklumpte, so grob geschöpftes Papier, dass die Buchstaben über die Dellen hüpften, als spielten sie Seilspringen, und blindlings aus dem Lager gegriffene Gänsefedern.
Nach dem Abendessen und den Gebeten übte ich mich in meiner Unterkunft oder im Garten neben dem Brunnen, dessen fauliggrünes Wasser mir ebenfalls zum Schreiben diente, an meinen eigenen Entwürfen. Meine bevorzugte Tinte mischte ich mir aus Schweineblut, Alkohol und rotem Safran. Auf dem Markt hatte ich den linken Flügel einer schwarzen Gans erstanden. Ich riss Feder für Feder prüfend aus, und jede fünfzehnte hob ich auf. Hatte ich die richtigen erst zusammen, erhitzte ich in einem Kupferbehälter etwas Sand, den ich in eine Holzkiste schüttete, dann legte ich die Federn hinein und wartete, bis die Wärme sie gehärtet hatte.
Mein Werkzeug bewahrte ich in einem Nähkästchen auf, das einst meiner Mutter gehört hatte und das noch immer ihren bronzenen Fingerhut sowie den Duft nach Lavendel in sich barg.
Als ich die Schule de Vidors verließ, beschaffte mein Onkel mir eine Anstellung bei Gericht. Für uns, die wir einen Abschluss hatten, war das der übliche Weg. Die anderen kamen in Bibliotheken oder als Privatsekretäre bei den letzten betuchten Familien unter. Ich begann, mit meinem Nähkästchen zu Verurteilten und in die Büros von Regierungsbeamten zu ziehen und einer Tätigkeit nachzugehen, die sich durch ihre Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit auszeichnete. Etwas ähnlich Stupides werde ich wohl kaum wieder erleben.
Einmal wurde einem zum Tode Verurteilten, dessen Urteilsspruch ich zu Papier gebracht hatte, das Blatt mit all den Schnörkeln und Lacksiegeln kurz vor Betreten des Schafotts gezeigt, worauf er sagte: Richten Sie dem Schreiber meinen Dank dafür aus, dass er meine Verbrechen in etwas derart Schönes verwandelt hat. Ich würde noch zehn Männer umbringen, wenn ich dafür wieder eine solche Zeichnung bekäme.
Ein größeres Kompliment hatte ich nie zuvor in meinem Leben bekommen.
Mein Zimmer füllte sich mit Behältern unterschiedlichsten Inhalts: der Tinte des Tintenfisches, dem Gift des Skorpions, einer Zinklösung mit Eichenblättern und Eidechsenköpfen. Ich hatte es auch bereits mit unsichtbarer Tinte versucht, auf die ein Exemplar der De occulta calligraphia verwies, das ich bei einem Buchhändler in der Rue Admont erstanden hatte und das in der Schule de Vidors verboten war. Das Buch sprach von wasserloser Tinte, die erst sichtbar wurde, wenn sie mit Blut in Kontakt kam, man Schnee dagegen rieb oder das Blatt mehrere Stunden lang ins wolkenlose Mondlicht hielt. Andersherum gab es Tinte, die ihre schwarze Farbe verlor, erst grau wurde, bis sie gar nicht mehr zu sehen war.
Meine Karriere als Gerichtsschreiber endete mit der Niederschrift des Todesurteils von Catherine de Béza, die des Mordes an ihrem Mann, General Béza, überführt worden war und ihn auch gestanden hatte. Der General war krank geworden, und seine Frau ließ nach dem alten Hausarzt rufen, der die Familie schon seit Jahrzehnten behandelte und der, selbst beinahe blind, dem General für gewöhnlich Medikamente verschrieb, die gar nicht mehr im Umlauf waren, und ihm, ohne ihn zu untersuchen oder nach den Beschwerden zu fragen diverse Gebrechen attestierte. An eben jenem Morgen aber wachte der alte Arzt mit Fieber auf und schickte als Vertretung einen jungen Mediziner, dessen Mentor er war. Als der Doktor kam, war der General schon tot. Ihm genügten wenige Minuten, um eine natürliche Todesursache auszuschließen: Mit einer Lupe untersuchte er die Fingernägel des Verstorbenen und entdeckte Reste von Arsen.
Madame de Béza wurde angeklagt und verurteilt. Man führte sie zum Schafott, aber der Henker konnte die Exekution nicht vornehmen, weil das Papier mit dem Urteil, das noch vor wenigen Stunden bis an die Ränder voll mit Verfügungen gestanden hatte, jetzt nur ein weißes Blatt war, auf dem lediglich der rote Siegellack hervorstach.
Sie wollten mich der Mittäterschaft anklagen, und ich bemühte mich, meinen Fehler zu entschuldigen, indem ich einen gewissen Zusammenhang zwischen Wissenschaft und schicksalhafter Fügung herzustellen versuchte. So oder so aber musste ich für drei Monate hinter Gitter. Da einige der Anwesenden das Verschwinden der Tinte als göttliches Zeichen deuteten und sie es eher der Tugendhaftigkeit der Beschuldigten als der Dummheit des Kalligraphen zuschrieben, wandelte das Gericht das Todesurteil in eine Gefängnisstrafe um.
Nachdem ich wieder auf freiem Fuß war, ging ich zu meinem Onkel. Ich hoffte, bei ihm Tag und Nacht wieder in einem echten Bett schlafen zu können – ohne den Gestank des Kerkers, die Schreie, die Ratten. Mein Onkel hingegen hatte bereits meine Tasche gepackt, und die kühle Umarmung, mit der er mich empfing, war keine Geste der Begrüßung, sondern des Abschieds.
»Während du im Gefängnis warst, habe ich deine Dienste angeboten. Ich habe ein paar alten Bekannten eine knappe Liste mit deinen Fähigkeiten und eine ausführlichere mit deinen Fehlern geschickt. Man will ja nicht als Lügner dastehen.«
»Und, hast du eine Antwort bekommen?«
»Eine einzige, vom Schloss Ferney. Die bringen immer alles durcheinander und verstehen die Dinge verkehrt herum. Deine Fehler haben Sie mit deinen Tugenden verwechselt und deswegen sofort zugesagt.«
Ferney
Ich war zwanzig Jahre alt, und alles, was ich besaß, war ein Nähkästchen voll mit Federn und Tintenfässern. Stünde das Transportsystem, das man nächtliche Post nannte, nicht unter der Kuratel meines Onkels, dem Marschall de Dalessius, hätte ich die Reise nach Ferney niemals antreten können. Das Unternehmen sorgte einst für die Rückführung von Gefallenen. Zu Kriegszeiten gab es in Frankreich eine Menge Leichname, die wieder zurück in ihre Heimatstädte und Dörfer gebracht werden sollten. Am Anfang hatten noch die Postkuriere diesen Transport übernommen, aber Briefe und Handelsgüter waren in so üblem Zustand bei ihren Empfängern angekommen, dass die Leute sich weigerten, die Schriftstücke zu lesen. Kaum hatten sie ihr Ziel erreicht, wurden sie verbrannt. Die Toten hatten es geschafft, die Verständigung zwischen den entlegeneren Landstrichen unseres Königreiches einschlafen zu lassen.
Die nächtliche Post war ein reiner Totentransport. Mein Onkel erbte das Unternehmen von meinem Großvater, und sein Herzstück bestand aus einer alten Lagerhalle in der Nähe von Paris, die ein Jahrhundert früher eine Salzfleischfabrik beherbergt hatte. Dort wurden die Körper klassifiziert, in Särge gelegt – die gemäß der Tradition des Ortes häufig voller Salz waren – und in die unterschiedlichsten Regionen Frankreichs verschickt. Das Unternehmen verfügte über fünfundzwanzig Kutschen, und weil die Strecken zum Teil abenteuerlich, Verirrungen üblich waren, musste so manche Familie monatelang auf die Ankunft ihres Angehörigen warten. Zu Anfang, als der Krieg noch tobte, wurden die Gefallenen wie Helden erwartet, aber die Zeit verging, der Krieg fand ein Ende, und der Reisende kam wie ein Bote, der schlechte Nachrichten bringt, wie ein unbequemer Gast, der von einem Krieg erzählt, den die anderen zum Glück bereits vergessen hatten.
Mein Onkel hatte kleine Fenster mit Läden in die Särge eingebaut, um so die Passagiere sehen und Irrtümer vermeiden zu können. Eine weitere Neuerung bestand darin, jeden Soldaten mit einer eigenen kleinen Sammlung an Orden und Auszeichnungen nach Hause zu schicken, die er bei einem Knopffabrikanten prägen ließ. Auf diese Weise empfing jede Familie einen Helden. In diesem Geschäft, sagte mein Onkel, der Marschall de Dalessius, gibt es ganz klare Regeln: Man muss Schwarz tragen, nachts arbeiten und den Mund halten.
Als es weder Kriege noch Epidemien gab, wurde die Anzahl der Kutschen reduziert. Um an Kundschaft zu kommen, hatte mein Onkel sich die Mühe gemacht, die These eines benediktinischen Theologen zu verbreiten, der glaubte, dass ein Mensch, um ins Paradies zu kommen, an dem Ort begraben werden sollte, in dem er auch geboren wurde, keinesfalls aber weiter von ihm entfernt als die halbe Strecke, die zwischen Bethlehem und der Heiligen Grabstätte liegt. Dank dieser kleinen Kniffe und der Unterstützung des Staates, der ihn mit dem Transport der Hingerichteten und in Gefangenschaft Verstorbenen beauftragte, fehlte es meinem Onkel auch in den schlimmsten Friedenszeiten nie an Passagieren.
Die Reise dauerte lange, denn Ferney lag an der Grenze zur Schweiz. Vom König aus Paris fortgejagt, hatte Voltaire das Schloss gekauft, um von dort aus, wenn nötig, auf sein Gut in Genf flüchten zu können. Als wir unser Ziel erreichten, waren alle Aufträge erfolgreich ausgeführt worden, und der einzige Passagier, der noch übrig war, war ich. Ich verabschiedete mich von Servin, dem Kutscher, und blieb allein vor dem Portal des Schlosses zurück.
Ein Sekretär sah sich meine Papiere an und bat mich, Platz zu nehmen und zu warten. Schon bald dämmerte es, und ich saß allein in dem Halbdunkel des Raumes. Niemand kam, um die Lampen anzuzünden, und ich glaubte schon, man hätte mich vergessen. Die Reise war anstrengend gewesen, und ich wünschte nichts sehnlicher, als etwas zu essen und ein Bett zum Schlafen, stattdessen aber wurde ich von einem Diener abgeholt, der mich in den Ostflügel des Schlosses führte. Überall hingen unzählige Uhren, deren Lärm regelrecht ohrenbetäubend war. Später fiel mir auf, dass ihr gleichförmiges Tick-Tack sich selbst in die Träume einschlich, um mit ihren Räderwerken, Zeigern und romanischen Ziffern die nächtliche Ruhe der Bediensteten zu torpedieren.
Voltaire hatte so manche Schlacht geschlagen, er kannte die Gefangenschaft, das Exil. So nahm ich an, auf einen Giganten zu treffen, mit großem Kopf und wissenden Augen. Mir gegenüber aber stand ein alter Mann, der mir kaum wie ein realer Mensch, sondern eher wie eine Zeichnung in einem Buch vorkam (ein Buch, das man in einer regnerischen Nacht im Garten vergessen hat). Seine Zähne waren dem Skorbut zum Opfer gefallen, auf dem kahlen Kopf trug er eine Wollmütze, und seine Zunge war aufgrund seiner Angewohnheit, die eingetrocknete Tinte in seiner Feder mit ihr zu befeuchten, genau so blau wie die der Erhängten.
Er drehte sich nicht zu mir um, als ich eintrat; vielleicht war er außerdem noch taub. Versunken studierte er mit einer Lupe mit Goldrand weiter die vor ihm liegenden Unterlagen. »Dummkopf!«, sagte er.
»Es tut mir Leid, dass ich so spät komme.«
»Was für ein Dummkopf der Mensch doch sein muss, der diese Seite geschrieben hat.«
»Einer Ihrer Feinde?«
»Der schlimmste: ich selbst. Woher rührt bloß diese unsinnige Liebe zum Wörterbuch, können Sie mir das erklären? Das ist die Krankheit, die einen befällt, sobald man die Enzyklopädien angefasst hat.«
»Ich bin Kalligraph. Auch ich hege eine gewisse Leidenschaft für die Buchstaben.«
Ich erinnerte mich daran, dass wir in de Vidors Schule unsere Liebe zum Alphabet so weit trieben, dass selbst unsere Übungen im Sportunterricht daraus bestanden, den Körper in die Gestalt eines Buchstaben zu bringen. Das ›g‹ und das ›h‹ waren die schlimmsten. Und auf dem eiskalten Fußboden mussten wir einen ganzen Vormittag lang Fragmente der Äneis auf Latein gestalten. Dabei verlas unser Professor die Verse von einem Turm aus.
»Soll ich Ihnen mal was verraten? Vor geraumer Zeit hatte ich überlegt, ob ich meine Autobiographie schreibe und dabei streng nach dem Alphabet vorgehe. Sollten Sie jemals ein ähnliches Unternehmen planen, denken Sie daran, dass Sie jeden Buchstaben überspringen können außer dem A und dem Z, weil uns das nämlich das Gefühl gibt, den Kreis geschlossen zu haben, obwohl die anderen in der Mitte fehlen. Hätte Christus damals nicht gesagt ›Ich bin das Alpha und das Omega‹, sondern ›Ich bin das Beta und das Psi‹, wer weiß, was dann aus dem Christentum geworden wäre.«
Er reichte mir Papier und Feder. »Zeigen Sie Ihre Künste.«
»Ich würde lieber meine eigenen Federn benutzen, wenn es nichts ausmacht.«
»Dank Ihres Werkzeugs haben Sie Ihre letzte Anstellung verloren. Wer garantiert Ihnen, dass es Ihnen mit der nächsten nicht genauso ergeht?«
Ich ließ mich nicht einschüchtern. »Was soll ich schreiben?«
»Meine Hand zittert wie die eines Greises.«
Meine Hand zitterte in der Tat. Das war mir noch nie zuvor passiert. Das Ergebnis waren ein paar lausige Buchstaben.
»Es war nicht die richtige Feder.«
»Dann probieren Sie es mit einer anderen.«
Ich suchte mir die einer Blaugans heraus, meine Lieblingsfeder, und das Resultat war noch schlimmer.
»Diese Gans schlägt wohl noch mit den Flügeln. Trotzdem: Ich nehme Sie. Sie haben einen so unruhigen Puls, dass jeder glauben wird, ich selbst war es, der geschrieben hat. Ihr direkter Vorgesetzter wird Wagnière sein, mein Sekretär.«
»Was ist meine Aufgabe?«
»Die Korrespondenz erledigen. Sie arbeiten hier, in diesem Raum. Bei bestimmten Schriftstücken müssen Sie sich mit mir absprechen. Bei anderen entscheiden Sie allein.«
»Wer die Briefe liest, wird merken, dass sie nicht von Ihnen sind.«
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sie werden glauben: Wenn er seine Briefe nicht selbst schreibt, wird er an einem wichtigen Werk sitzen. Die Abwesenheit kann auch beeindruckende Wirkung haben.«
Plötzlich wurden wir von einem polternden Donnern zusammenstürzender Gegenstände überrascht. Voltaire ging Richtung Tür, und ich folgte ihm. Er machte große, aber sehr langsame Schritte, so dass ich mich bremsen musste, um ihn nicht zu überholen. Obwohl es eine Weile dauerte, bis wir zu der Einsturzstelle gelangten, schwebten die Papiere noch immer in der Luft und warteten auf ihren Meister.
Zusammen mit uns betrat auch ein ganz in Schwarz gekleideter, hoch gewachsener Mann mit traurigem Blick das Archiv. Er begann, die Papierberge zur Seite zu räumen, und ich bückte mich zu ihm hinunter, um ihm zu helfen. Unter dem Gewicht der vergilbten und mit Kordeln zusammengebundenen Briefe hustete und stöhnte jemand.
Ich zog ein Bündel der von Motten zerfressenen Schriftstücke hervor, die in meinen Händen beinahe zerfielen. Darunter kam ein derart von Papierstaub zugerieseltes Gesicht zum Vorschein, dass man den Eindruck gewinnen konnte, es wäre selbst Teil der Korrespondenz.
»Holen wir den armen Barras da schon raus«, sagte der große Mann. »Ziehen Sie an dem einen Arm, ich nehme den anderen.«
Zum Vorschein kam ein knorriger Kerl, der am Kopf und an der Oberlippe blutete. Sobald er befreit war, schüttelte er unsere Hände ab, um sich hastig von den Papierfetzen zu befreien, gerade so, als würde sich die pulverige Masse gleich in ein wildes Tier verwandeln. Darauf humpelte er eilig den Flur hinunter und rief: »Ich gehe zurück in die Küche. Ins Archiv, ich? Nie wieder!«
»Ich fürchte, wir müssen uns nach einem neuen Gehilfen für das Ordnen Ihrer Korrespondenz umsehen«, kommentierte der schwarz gekleidete Mann.
»Na, da haben wir ja die beiden Richtigen beieinander. Wagnière, darf ich Ihnen Dalessius vorstellen. Dalessius, räumen Sie hier auf. Von nun an werden Sie nicht bloß Briefe schreiben, sondern sich außerdem um das Archiv kümmern.«
»Ist das nicht etwas gefährlich für einen Lehrling?«, fragte Wagnière. »Es wird nicht lange dauern, und Barras stirbt, und der Student aus dem Elsass letzten Monat …«
»Wenn unser Monsieur Dalessius sich anstrengt, wird er es schon lernen. Und wenn nicht, fährt er nach Hause zurück … in derselben Kutsche, die ihn auch hergebracht hat.«
Die Korrespondenz
Weil Voltaire eine Menge Feinde hatte, war das Öffnen der Post nicht ungefährlich. Ihm wurden zwischen die Briefbögen gelegte vergiftete Nadeln geschickt, Ampullen, die tödliche Gase verströmten, Mörderspinnen.
Und in den Paketen, die er erhielt, befanden sich oft als Bücher getarnte Kisten, in denen Schlangen im Winterschlaf lagen oder die delikate Sprengkörper enthielten. In einem speziellen Raum, der wie zur Vermeidung weiterer Opfer weitab von den anderen lag, widmete ich mich mit pochendem Herzen den Umschlägen und Verpackungen. Dabei halfen mir eine Reihe von Instrumenten, die Voltaire in Genf gekauft hatte und mit denen sich Sprengsätze und andere bösartige Fallen entdecken ließen: Lupen aus Bergkristall, ein winziges Fernrohr, das man in den Umschlag schob, ohne ihn öffnen zu müssen, eine Lampe mit blauer Flamme, mit der man Papier durchleuchten konnte.
Aber meine Aufgabe war ja nicht nur, die Post zu öffnen, sondern sie im Namen Voltaires auch zu beantworten.
»Suchen Sie in meinen Büchern nach irgendeinem klugen alten Zitat und beantworten Sie damit diese Studentenprosa«, befahl er mir.