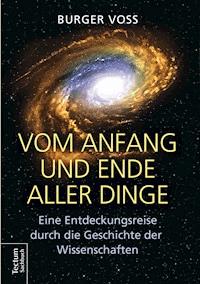
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie entsteht das faszinierende Farbenspiel bei einem Sonnenuntergang? Wie sieht ein romantischer Abendhimmel auf dem Mars aus? Wie lang dauert eigentlich ein Moment? Was passiert mit uns, wenn wir Schmerz empfinden? Kann es eine zweite Erde geben? Und wenn ja, gibt es dort Leben? Burger Voß lädt ein zu einem Streifzug durch die Geschichte der Forschung und macht Lust auf die Entdeckung der Geschichte unseres Planeten und des Universums. Von den ersten Biomolekülen bis zum Ende von Raum und Zeit - das Leben bietet viel Raum zum Staunen! Ein leidenschaftliches Plädoyer für ein naturwissenschaftliches Weltbild und ein kluges und lehrreiches Buch!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Burger Voss
VOM ANFANG UND ENDE ALLER DINGE
Burger Voss
Vom Anfang und Endealler Dinge
Eine Entdeckungsreise durch dieGeschichte der Wissenschaften
Tectum
Burger Voss
Vom Anfang und Ende aller Dinge.Eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Wissenschaften
© Tectum Verlag Marburg, 2015
ISBN 978-3-8288-6193-0
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter
der ISBN 978-3-8288-3455-2 im Tectum Verlag erschienen.)
Lektorat: Swen Wagner
Umschlaggestaltung: Jens Vogelsang
Abbildung Umschlag: fotolia.com, © eevl
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/tectum.verlag
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhalt
Einleitung
1.Phaneron – die Welt durch unsere Augen
2.Der Wirklichkeit auf der Spur
3.Nur auf der Erde?
4.Der Stoff, aus dem das Leben ist
5.Ein einfaches Leben
6.Nobody’s perfect
7.Ein hartes Leben
8.Eines fernen Tages
9.Schöpfer ade
10.Quellenangaben
»Eine gute wissenschaftliche Theorie sollte einer Bardame erklärbar sein.«
ERNEST RUTHERFORD
Einleitung
Warum dieses Buch?
Dieses Buch soll sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigen. Um den ungerechtfertigten Erwartungen gleich entgegenzukommen: Es wird kein Versuch sein, die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten. Wir wollen uns in diesem Buch eher damit beschäftigen, wie sinnvoll die Frage nach dem Sinn des Lebens heute überhaupt ist. Die Wissenschaft hat uns vieles in der Natur erklären und uns einige Illusionen nehmen können, die wir über uns selbst hatten, als wir unwissend waren. Über den Planeten, auf dem wir leben, zum Beispiel, oder über die Stellung des Menschen in der Vielfalt des Lebens. Und natürlich kann die Wissenschaft uns nicht alles erklären. Wir müssen aber in der Wissenschaft gelegentlich einen geistigen Kassensturz machen. Und wenn wir auf einem Sinn des Lebens bestehen wollen, dann müssen wir gelegentlich stehenbleiben auf unserem Weg und uns umsehen, um das Gesamtwerk zu betrachten. Denn die Wissenschaft erzählt uns nichts Geringeres als die Geschichte unserer Existenz mit maximaler Gewissheit.
Ich bin mir nicht sicher, ob es die neue Welle des Atheismus der letzten Jahre war, die die religiösen Hardliner der Welt aus dem Versteck geholt hat, oder ob das neue Aufkommen des Atheismus eine Reaktion auf die Intelligent-Design-Bewegung ist, die von Amerika ausging und sich wie eine Metastase durch die Köpfe der Welt frisst. Was daran läge, dass Wissenschaftler die Einzigen sind, die den Kreationismus in seine Schranken verweisen können, und Wissenschaftler sind weniger religiös als der Durchschnitt der Bevölkerung. Wie dem auch sei – die Fronten sind etabliert, die Fahnen gehisst und die Kanonen sind aufgestellt. Im Gegensatz zu früheren Konflikten werden die Kanonen diesmal nur auf einer Seite von Geistlichen geweiht.
Die schillerndsten Beispiele der religiös motivierten Erkenntnisleugner findet man – wie könnte es anders sein? – in den USA. Dort zweifeln sie die Gültigkeit der 14C-Methode an, mit der man den Tod eines Organismus datieren kann. Sie weisen die Verlässlichkeit der Kalium-Argon-Datierung zurück, mit der man messen kann, wann eine Probe Gestein das letzte Mal geschmolzen war. Sie lehnen die Evolutionslehre ab, da ihnen das heutige Leben auf der Erde zu komplex erscheint, um durch Mutation und Selektion entstanden zu sein.
In Wirklichkeit aber lehnen sie diese Dinge ab, weil diese ihre Heilige Schrift widerlegen. Nie hat ein Kreationist öffentlich an Newtons Gravitationsgesetz gezweifelt, die Kirchhoffschen Gesetze der Elektrizitätslehre madig gemacht oder die Gültigkeit des Snelliusschen Brechungsgesetzes infrage gestellt. Die Thesen der Kreationisten beschränken sich auf die Evolutionslehre, die Erkenntnisse der Geologie und Paläontologie sowie einige philosophische Aspekte der Kosmologie. Eben die Dinge, die die Entstehung der Arten aus anderen Arten erklären, das Alter der Erde zu viereinhalb Milliarden Jahren berechnen und die Möglichkeit beschreiben, dass das ganze Universum im Urknall aus nichts entstanden ist. Die natürliche Reaktion des Menschen und besonders des Frömmlers besteht in einer solchen Situation nicht darin, sich überzeugen zu lassen, sondern sie besteht in einem Anzweifeln der Rahmenbedingungen, der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft, der gefühlt religionsfeindlichen Absichten des jeweils argumentierenden Wissenschaftlers oder einfach in Schweigen, das denselben Zweck hat wie sich die Finger in die Ohren zu stecken.
Dabei sind die Vertreter des Kreationismus keinesfalls ungebildete Menschen. Unter ihnen finden sich Akademiker, die sogar in den Fachgebieten promoviert haben, mit denen sie die Wissenschaft zu widerlegen behaupten. Und für den Fall, dass Sie das für ein rein amerikanisches Problem halten: Der deutsche Biologe Wolfgang Kuhn bevorzugte das Intelligent Design gegenüber der Evolutionslehre, akzeptierte aber immerhin das Alter der Erde, wie die Wissenschaft es ermittelt hat. Der deutsche Informatikprofessor Dr. Werner Gitt ist Junge-Erde-Kreationist, hält die Erde also für sechstausend Jahre alt und besteht darauf, dass jegliche Information, auch die in der DNA, nur von einem Geist geschaffen werden kann. Knapp vierzig Prozent der Deutschen glauben entweder an den Kreationismus oder an ein Intelligent Design. Sie sehen also, wie die Sache aussieht. Wir werden nicht mehr lange in der Lage sein, keine Position zu beziehen.
Wir werden in diesem Buch zur Erörterung der großen Frage nach dem Sinn eine wissenschaftliche Rundreise unternehmen, denn Reisen bildet. Und so wie man einige Zeit in einem anderen Kulturkreis verbringen muss, um das Deutsche an sich selbst zu erkennen, muss man auch durch die Welt der Wissenschaft reisen, um den Menschen als Wesen und Spezies in das rechte Licht zu rücken.
Sie müssen im Rahmen dieser Lektüre keine Formeln auswendig lernen und keine Diagramme erklären können. Ich werde mich aber auch nicht darauf beschränken, Ihnen nur die Ergebnisse der Wissenschaft zu präsentieren. Wenn Sie am Ende das Buch zuklappen und ein Gespür für das wissenschaftliche Denken entwickelt haben, dann habe ich mein Ziel erreicht.
In diesem Buch geht es mir hauptsächlich darum, die wissenschaftliche Methode zu erläutern und vor allem verständlich zu machen. Wenn sie das beste Werkzeug ist, das wir zum Verstehen der Welt benutzen können, dann verdient sie es auch, in ihrer ganzen Schönheit erklärt zu werden. Ich werde mich dabei bemühen, die Dinge allgemeinverständlich darzustellen, denn ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch grundsätzlich alles verstehen kann und dass die Schuld beim Erklärenden liegt, wenn das nicht gelingt.
Warum auf diese Weise?
Als ich im Jahre 2006 meine Diplomarbeit einreichte und dann einen Monat später meinen Diplomvortrag halten musste (ich hatte einen chemischen Syntheseweg für seltene Fettsäuren entwickelt), benutzte ich für das Herstellen einer chemischen Bindung zwischen zwei Molekülen die Formulierung: »der lipophile Rest muss an den Furanring herangebastelt werden.« Nach meinem Vortrag wurde ich von verschiedenen Stellen des Instituts darauf hingewiesen, eine solche Formulierung wäre unwissenschaftlich und sie würde einen unprofessionellen Eindruck erwecken. Ein guter Vortrag, ja, aber das müsse weniger werden.
Sicherlich ist diese Ansicht in Deutschland vorherrschend. Aber ich halte genau das für ein Defizit des deutschen Akademikertums. Gewisse Profanitäten haben im wissenschaftlichen Diskurs nach wie vor nichts zu suchen. Von der Vulgärsprache war ich mit dem Wort heranbasteln jedoch weit entfernt und Missverständlichkeit (eine der Todsünden in der Wissenschaft!) kann man mir auch nicht vorwerfen. Warum also die Kritik?
In der wissenschaftlichen Gemeinde in Deutschland muss eine Aussage nicht nur inhaltlich richtig sein, sondern scheint auch so formuliert werden zu müssen, dass Nichteingeweihte gefälligst nichteingeweiht bleiben oder selbst bei brennendem Interesse möglichst schnell die Lust an der Thematik verlieren. Dabei gibt kein Professor seinen Studenten eine Anweisung, Außenstehende mit einer Firewall aus Fachbegriffen abzuwehren. Jeder fühlt es so und jeder macht es so – warum auch immer.
In England ist das anders. Profilierte Wissenschaftler wie der Evolutionsbiologe Richard Dawkins, der Chemiker Peter Atkins oder der Biologe John Maynard Smith (der zur Erklärung von Homosexualität unter anderem den Begriff der Sneaky-Fucker-Hypothese einführte) büßen nicht ein Jota ihrer wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit ein, wenn sie auf die Amtssprache der Naturwissenschaften verzichten und sich mal klar ausdrücken. Im Gegenteil: Indem sie hochgestochene Formulierungen vermeiden, setzen sie sich selbst dem Druck aus, Beispiele und Gleichnisse zu finden, die den Sachverhalt umfassend, richtig und vor allem verständlich beschreiben. Denn eine Metapher, die genauso kompliziert ist wie das, was sie beschreiben will, ist komplett überflüssig.
Zugegeben: Im Englischen gibt es so etwas wie eine Amtssprache der Naturwissenschaften gar nicht, denn das Englische enthält von vorn herein mehr lateinische Wörter als das Deutsche. Das Vokabular ist – abgesehen von wenigen Fachausdrücken – durchaus alltäglich und es ist beeindruckend, wie sich Alltagsbegriffe oder Metaphern in den englischsprachigen Wissenschaften durchgesetzt haben. Funktionelle Teile von Molekülen, die im Verdacht stehen, die Entstehung von Krebs zu begünstigen oder anderweitig giftig sind, werden als dirty groups bezeichnet. Eiweißmoleküle, die bei der ordnungsgemäßen Faltung von neu hergestellten Eiweißmolekülen assistieren, heißen chaperons, Anstandsdamen. Wenn eine Zelle für sich den organisierten Zelltod herbeiführen muss und zu diesem Zweck Fresszellen anlocken will, setzt sie Signalproteine auf ihrer Oberfläche aus, die man eat-me-flags genannt hat, Friss-Mich-Fähnchen. Nach deutschem Verständnis ist das unprofessionell und irgendwie eine Herabwürdigung der Wissenschaft. Kommt ein solcher Begriff aber aus dem angelsächsischen Sprachraum, ist er plötzlich schmissig und leicht zu merken.
Nachdem der britische Molekularbiologe Edwin Southern 1975 ein Verfahren zur Identifizierung von DNA-Fragmenten entwickelt hatte (den nach ihm benannten Southern blot), war die Fachwelt so beeindruckt, dass andere Wissenschaftler umgehend ähnliche Verfahren hinzufügten, mit denen sich dann RNA beziehungsweise Proteine analysieren ließen. Man taufte diese Verfahren in northern blot und western blot. Und das aus einem einfachen Grund: Sie sind sich alle drei ähnlich und sollten daher auch ähnlich heißen. Ob Mr. Southern sich dabei veräppelt vorkam, weiß ich nicht. Ich möchte es aber bezweifeln.
Die Europäische Südsternwarte ESO baut und betreibt einige der größten Teleskope, die der Mensch jemals entworfen hat. Ihr bisheriges Flaggschiff ist das Very Large Telescope (VLT) in Chile. Als Nachfolgermodell war ursprünglich das Overwhelmingly Large Telescope (OWL) geplant, man hat sich aus Kostengründen aber auf das Extremely Large Telescope (ELT) herunterhandeln lassen. Diese schnörkellosen, grundehrlichen Benennungen für Milliardenprojekte sind sicherlich auch dadurch begünstigt, dass die Douglas-Adams-Fans der 80er Jahre sich zu den heutigen Entscheidungsträgern für solche Projekte gemausert haben und für augenzwinkernde Namensgebungen offen sind.
Die Astrophysik ist allgemein voll von einfachen, dynamischen und vor allem einprägsamen Wortschöpfungen. Die Fernsehserie Big Bang Theory nutzt einen der zentralen Begriffe der Kosmologie als Wortwitz für eine Gruppe von Wissenschaftlern, die gern mal wieder Sex hätten. String Theory hätte hier genauso gut gepasst, und auch der Begriff »Doppelspaltexperiment« hat etwas Gruppensextaugliches. Als der britische Biologe Richard Dawkins das Manuskript für sein Buch »The Greatest Show On Earth« bei seinem Verlag einreichte, hatte er ein kleines Osterei darin versteckt: Statt Large Hadron Collider (Großer Hadronen-Kollidierer) hatte er in einer Passage versehentlich Large Hardon Collider geschrieben, Kollidierer großer Erektionen. Aus Amüsement hatte er diesen Tippfehler in seinem Manuskript stehen lassen. Die Lektoren entdeckten den Fehler, und trotz Dawkins‘ Bitten wurde er für die fertige Ausgabe korrigiert.
Das ist Humor, wie er in Deutschland leider undenkbar ist. Das wäre viel zu salopp, zu alltäglich, nicht ernsthaft genug für so etwas Erhabenes wie Wissenschaft. Der Nachweis, dass die wissenschaftliche Erkenntnis unter solch »unseriösen« Namensgebungen gelitten hätte, steht noch aus. Eigentlich beschleunigt es den akademischen Prozess nur und macht ihn tauglicher dafür, der Allgemeinheit präsentiert zu werden.
Denn es ist doch eigentlich unwichtig, wie die Fachbegriffe genau lauten. Sie haben in erster Linie einen Zweck, und zwar einen sinnvollen. Sie sollen Platzhalter sein für komplizierte Konzepte, die man sich nicht jedes Mal vollständig durch den Kopf gehen lassen will, wenn man etwas erörtert. Vielmehr sollen Fachausdrücke diese Konzepte in geistige Schubladen sortieren, die erst bei Bedarf aufgehen. Richtige Fachleute reden unter-einander in Schubladen, ohne das noch zu merken, das geht irgendwann von selbst. Fachausdrücke machen dem Fachmann das Leben leichter.
Fachausdrücke im wissenschaftlichen Diskurs sind vergleichbar mit einer gut ausgerüsteten Küche. Wenn ich für meine Gäste etwas kochen will, muss ich nicht erst verschiedene Messer schmieden und schleifen und Kartoffeln und Paprika anbauen. Ich habe alles in verschiedenen Schubladen vorrätig, ich brauche nur die Schubladen mit Aufschriften wie »Schneidwerkzeug«, »Gemüse«, »Milchprodukte« oder »Geschirr« zu öffnen und schon kann ich kochen. Und selbstverständlich dürfen meine Gäste sich dazusetzen und mit mir plaudern – ich wünsche es mir sogar. Denn immerhin handelt es sich dabei um ein gesellschaftliches Ereignis. Und das sollten die Naturwissenschaften auch sein.
»A true thing badly expressed is a lie.«
STEPHEN FRY
»Wenn die Sinne versagen, muss der Verstand einsetzen.«
GALILEO GALILEI
1. Phaneron – die Welt durch unsere Augen
Der amerikanische Philosoph Charles Sanders Peirce prägte im Jahre 1905 den Begriff Phaneron. Er wählte ihn als Terminus für die Summe all dessen, was dem Verstand gegenwärtig ist, unabhängig davon, ob es etwas Realem entspricht oder nicht.
Die Welt durch unsere Sinne ist unser Phaneron. Phaneron ist nicht die Realität, sondern nur unser Eindruck davon. Wenn wir unseren Sinnen blind vertrauen, dann dreht sich die Sonne um die Erde; dann gibt es keine Bakterien; dann endet die Welt hinter dem Horizont. Phaneron, das bist Du, wie die anderen Dich sehen.
Phaneron ist die Überzeugung, dass die eigene Großmutter weltweit führend ist in der Zubereitung von…
… hier müssen sich unsere Wege bereits trennen. Wenn ich »Schweinekoteletts« schreibe, kann der islamische Teil unserer Gesellschaft schon nicht mehr mitreden. Wenn ich »Rindersteaks« schreibe, sind die Hindus raus. Wenn ich »Hähnchenkeule« meine, stellt sich für orthodoxe Juden die Frage, ob Milchprodukte in derselben Pfanne zubereitet wurden. Und wenn ich Lachs meine, ist für fundamentale Christen wichtig, ob es an einem Freitag geschieht.
Aus dem Phaneron kommt unsere Ergriffenheit beim Anblick eines griechischen Sonnenuntergangs, das Wundern über den Zufall, dass man die Liebe seines Lebens ausgerechnet in seiner Heimatstadt kennengelernt hat, und die Angewohnheit, sich das Buch für eine Prüfung unter das Kopfkissen zu legen, damit man sie besteht. Es ist die Vorstellung, dass am Roulettetisch jetzt endlich mal Rot kommen muss, weil schon so lange Schwarz kam. Es ist der Glaube, dass der Mensch und all die Tiere auf der Welt kein Zufall sind.
Unser Phaneron hilft uns durch die Welt, und aus dem Phaneron heraus haben wir ein Weltgefühl entwickelt. Mit Weltgefühl meine ich die Von-bis-Spannen sämtlicher physikalischer Werte von Länge, Geschwindigkeit, Temperatur, Größe und Gewicht, die unser Leben bestimmen. Unser Weltgefühl ermöglicht uns, Dinge zu tun, die unsere Sinne nicht mehr wahrnehmen können. Es ist eine Erweiterung unseres Phanerons und dürfte im evolutionären Wettrüsten entstanden sein. Es ermöglicht Intuition, reflexartiges Handeln und geringere Reaktionszeiten als die Sinne uns ermöglichen. Wer ein gutes Weltgefühl besitzt, kann mehr Beute schnappen oder seltener Beute werden als die weniger Begabten. Das hat bis in unsere heutige Zeit wundervolle Blüten getrieben.
Ein Musiker kann ein Stück, wenn er es genug geübt hat, schneller spielen als er Noten lesen kann. Ein Schlagzeuger entscheidet sich nicht für den nächsten Schlag. Er schaut sich selbst zu, wie die Musik aus ihm herauskommt. Ein Rallyecrossfahrer kennt seine Maschine so genau, dass er das Gewicht, die Beschleunigung, die Zugkraft, die Verlangsamung beim Bergauffahren nicht mehr schätzen muss. Er fühlt diese Dinge und ist eins geworden mit der Maschine. Sie ist eine Verlängerung seines Körpers geworden. Ein Tischtennisspieler sieht den Ball nicht. Er weiß einfach, wo er sein wird und welchen Spin er haben wird. Indem er seine Intuition nutzt, macht er das Spiel schneller als seine Sinne es ihm erlauben. Müsste er den Ball mit seinen Augen verfolgen und Entscheidungen treffen, müsste auch das Spiel viel langsamer sein.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























