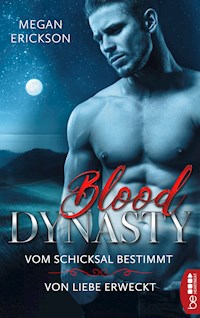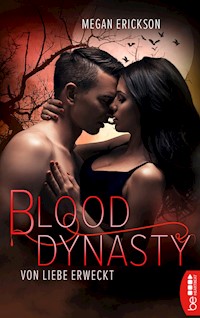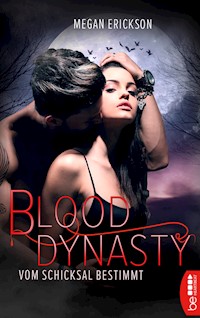
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Vampir-Romance
- Sprache: Deutsch
Eine Welt voller Gefahr. Ein unsterbliches Verlangen. Und ein unfassbares, vom Blut bestimmtes Schicksal
In Mission City ist niemand sicher: Barkeeperin Tendra wird eines Nachts entführt. Ihr Kidnapper Athan behauptet, ein Vampir zu sein, der sie in Sicherheit bringen will. Für Tendra klingt es unglaublich, aber Athan gehört tatsächlich einer im Untergrund lebenden Vampirgesellschaft an. Und Tendras Schicksal ist es, als Königin dieses Clans zu herrschen - an der Seite seines Bruders. Doch die Feinde des Clans wollen Tendras Tod.
Auf der gemeinsamen Flucht spürt Athan etwas zwischen ihnen, etwas Berauschendes, Sinnliches. Er kann nicht anders: Er will Tendra für sich ... Selbst wenn das Hochverrat ist.
Tauche ein in die düstere Welt von Blood Dynasty, in der die Vampire nicht nur unheimlich gefährlich sind, sondern auch höllisch sexy. eBooks bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
"Megan Erickson weiß genau wie man heiße Geschichten schreibt! Mit einer toughen Heldin und einem Held, für den es sich zu sterben lohnt, hat Vom Schicksal bestimmt - Blood Dynasty mich in seinen Bann gezogen. Ich konnte nicht aufhören zu lesen." New-York-Times-Bestsellerautorin Tracy Wolff
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Epilog
Danksagung
Über dieses Buch
In Mission City ist niemand sicher: Barkeeperin Tendra wird eines Nachts entführt. Ihr Kidnapper Athan behauptet, ein Vampir zu sein, der sie in Sicherheit bringen will. Für Tendra klingt es unglaublich, aber Athan gehört tatsächlich einer im Untergrund lebenden Vampirgesellschaft an. Und Tendras Schicksal ist es, als Königin dieses Clans zu herrschen – an der Seite seines Bruders. Doch die Feinde des Clans wollen Tendras Tod.
Auf der gemeinsamen Flucht spürt Athan etwas zwischen ihnen, etwas Berauschendes, Sinnliches. Er kann nicht anders: Er will Tendra für sich … Selbst wenn das Hochverrat ist.
Über die Autorin
Die USA-Today-Bestsellerautorin Megan Erickson war Journalistin, bevor sie sich entschied, Romane zu schreiben. So kann sie wenigstens selbst entscheiden, wie die Geschichte ausgeht.
Sie lebt in Pennsylvania zusammen mit ihrem eigenen Romance-Helden und zwei Kindern. Wenn Megan nicht schreibt, macht sie es sich entweder mit ihren beiden Katzen gemütlich, oder sie denkt über neue Geschichten nach.
MEGAN ERICKSON
BLOODDYNASTY
VOM SCHICKSAL BESTIMMT
Aus dem Amerikanischenvon Susanna Arens
beHEARTBEAT
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Megan Erickson
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Blood Guard«
Originalverlag: This translation is published by arrangement with Loveswept, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: Gabriel Georgescu | givaga | Gessel Edgar
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6755-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Kate Beckinsale:Danke, dass du uns Selene geschenkt hast,eine knallharte Vampirin,
Kapitel 1
Tendra
Brex strich um meine Beine, hörte nicht auf zu miauen, und ich stolperte auf meinem Weg zur Küche beinahe über ihn. »Mist, Mist, Mist«, murmelte ich. Ich würde zu spät zur Arbeit kommen, und so häufig, wie ich in der letzten Zeit gefehlt hatte, bestand die Gefahr, dass man mich feuerte.
Es war nicht so, dass ich meinen Job als Bedienung in einer Bar am miesen Ende einer ohnehin schon miesen Stadt mochte, doch ich verdiente gut, dank meiner tief dekolletierten Kleidung.
»Das können wir uns nicht leisten, was?«, sagte ich zu meinem Kater, während ich den Deckel von einer Futterdose zog. »Wer kauft dir sonst deinen …«, schnell warf ich einen Blick auf das Etikett, »… Thunfisch mit Cheddar?« Ich verzog das Gesicht, während Brex vor mir saß und mich nicht aus den Augen ließ. Ich kaufte sein Futter in großen Mengen im Discounter um die Ecke, hätte ihm aber gerne etwas Gesünderes gegeben. Meine Mutter hatte darüber gelacht. »Tenny, er ist ein Kater. Er kam in einer Scheune zur Welt. Es geht ihm gut, womit auch immer du ihn fütterst.«
Ich fühlte mich trotzdem schlecht. Er war alles, was ich noch an Familie hatte.
»Wenn ich im Lotto gewinne, kaufe ich dir Gourmetlachs, den du aus einer Kristallschale fressen kannst wie diese Katzen im Fernsehen.« Ich riss den Deckel komplett von der Dose. Das dünne Metall bog sich und schnitt mir in den Daumen. Schmerz schoss durch meinen Unterarm, und ich knurrte. »Verdammt.« Ich saugte an dem Schnitt, schmeckte Eisen und ein wenig Thunfisch. Ekelhaft.
Brex zeigte kein Mitleid, da er bereits sein Futter verschlang. Ich hatte keine Zeit, mir ein Pflaster zu holen, und so riss ich ein Stückchen von der Küchenrolle ab und pappte es auf den Schnitt, an dem das Blut bereits gerann.
Ich fuhr mit der Hand über den schwarz-grau getigerten Rücken des Katers, und er schenkte mir ein leises Miauen, bevor er sein Mahl fortsetzte. Irgendwie verstanden wir uns – Brex und ich. Nachdem Mom gestorben war, wich er mir nicht von der Seite, als würde er spüren, dass ich seine Nähe brauchte. Nach einem sehnsüchtigen Blick auf meine Couch, den Afghanen, den meine Mutter mir geknüpft hatte, und eine bequeme Jogginghose schlüpfte ich zur Tür hinaus, um zur Arbeit zu gehen. »Bis bald, Brex!«, rief ich über meine Schulter.
Meine Absätze pochten auf dem fleckigen Teppich im Flur des Apartmenthauses, und die Neonlampen an der Decke flackerten. Sie hatten noch nie ordentlich funktioniert, seit ich vor fünf Jahren hier eingezogen war. Ich drückte die Haustür auf und machte mich auf den Weg ins The Rose, das etwa eine Meile entfernt war.
Ich zog mir die Jacke enger um den Körper, denn noch reichte die Kälte des Winters in die Anfänge des Frühlings. Diese Nacht schien kälter zu sein als der Rest der Woche, und ich wünschte mir, ich würde etwas tragen, das die Beine bedeckte. Stattdessen waren sie bis zur Mitte des Oberschenkels nackt, und so ging ich hastig und mit erhobenem Kopf, während ich mit wachsamem Blick meine Umgebung scannte, wie ich es in all den Selbstverteidigungskursen, die ich besucht hatte, gelernt hatte.
Ich wusste nicht, warum Mom mit mir nach Mission City gekommen war. Ich war in schlimmeren Orten gewesen, und ich war auch schon in einer ganzen Reihe besserer gewesen. Doch Mission im nördlichen New Jersey war eine Abwechslung von unserer ländlichen Wohnsituation davor, und so hatte ich mich nicht beschwert. Ich war immer dorthin gegangen, wo Mom mit uns hinzog. Nun, nachdem sie selbst gegangen war … Meine Augen stachen, und ich blinzelte schnell, während die Straßenlampen durch die Tränen in meinen Augen zu verschwimmen schienen. Schnell wischte ich sie weg, um gleich keine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ich konnte jetzt nicht weinen, nicht heute Nacht. Im letzten Monat hatte ich oft bei der Arbeit gefehlt, während ich gelähmt vor Trauer auf dem Sofa gelegen hatte.
Ein Schatten jagte über die dunkle Straße, als ich weiterging, und meine Schritte stockten. In mein Atmen mischte sich leises Fluchen, während Hitze in mir aufstieg und sich auf mein Gesicht legte. Es gab nicht viel, was ich mehr hasste, als Angst. Sie schnürte mir die Kehle zu und sorgte für Chaos in meinem Kopf. Egal, wie viel ich von Selbstverteidigung verstand, war echtes Grauen nicht zu simulieren. Ich zwang mich, weiterzugehen, doch ich wollte nicht, dass irgendein Verrückter hinter mir herumschlich. Mein Blick wanderte über die Straße, und ich zuckte zusammen, als eine Katze aus der Dunkelheit trottete und sie überquerte. Eine verdammte Katze. Kein Fremder, der in den Schatten wartete, um mir das wenige Geld zu rauben, das ich in meiner Tasche bei mir trug.
Ich atmete tief aus und schloss für einen Moment die Augen, um mich wieder zu beruhigen. Reiß dich zusammen, Tendra. Meine Nerven lagen blank, seit Mom gestorben war, als hätte sie mich wie eine schützende Decke umgeben, die nun weggezogen worden war und rohes Fleisch zum Vorschein brachte. Ich hasste es, verletzlich zu sein, und doch hatte ich mich seit Wochen ständig so gefühlt. Ich sah zu den Gebäuden rechts und links von mir hinauf, und die Brust wurde mir eng, denn ich hätte schwören können, dass sie sich zu mir neigten. Großartig, nun wurde ich also auch noch klaustrophobisch. Vielleicht sollte ich lieber früher als später aus dieser Stadt verschwinden.
Ohne Mom an meiner Seite lag es an mir, ob ich in Mission bleiben oder weiterziehen würde. Ich wusste, wie man von vorn begann, denn das hatte ich mein ganzes Leben lang getan. Als wäre ich allergisch dagegen, Wurzeln zu schlagen und mich an irgendjemanden zu binden. Mir war immer bewusst, dass es einen Fluchtweg gab. Und gerade jetzt kribbelte meine Haut, und eine innere Stimme sagte mir, dass ich diesen Weg nehmen sollte.
Wenn wir umgezogen waren, gab es normalerweise etwas, was uns zum Aufbruch getrieben hatte. Meine Mom hatte immer gesagt, dass es Zeichen gab, wenn es Zeit wurde weiterzuziehen. Ein Mal brannte das Haus nieder, das wir gemietet hatten, ein anderes Mal kamen wir nach Hause, und unsere komplette Wohnung war durchwühlt worden. Lange Zeit habe ich gedacht, dass es normal sei, häufig umzuziehen. Erst als ich schon fast ein Teenager war, begann ich mich zu fragen, warum wir niemals an einem Ort bleiben konnten. Warum wir so ein Pech hatten. Und warum meine Mutter ganz blass geworden war, als ich die seltsamen Kerben an meinem hölzernen Bettgestell sah, nachdem unser Haus durchwühlt worden war, und ich sie danach fragte. Eine Erklärung hatte sie mir nicht gegeben. Und dann gab es da diesen schicksalhaften Schulausflug, als ich gerade sechzehn geworden war. Danach begann ich, Selbstverteidigungskurse zu belegen, weil ich nie wieder in meinem Leben so hilflos sein wollte.
Ich hatte nie Gelegenheit, Mom zu fragen, ob irgendwann eine Zeit kommen würde, in der wir uns dauerhaft niederlassen würden. Manchmal hatte ich Eifersucht verspürt, wenn wir in einer neuen Stadt in ein Geschäft gingen und bereits der Kassierer dort geboren worden war, genau wie seine Mutter und auch seine Urgroßmutter. Wie wäre es wohl, ein Zuhause zu haben, wo jeder dich kennt? Inzwischen war ich mir nicht mehr sicher, ob ich mich überhaupt irgendwo auf Dauer niederlassen könnte. Länger als fünf Jahre hatte ich noch nie an einem Ort gelebt. Vielleicht war Moms Tod ein Zeichen für mich, weiterzuziehen. Nach meiner Schicht heute Abend, wenn mein Kopf klar und nicht mehr von Trauer vernebelt wäre, würde ich ernsthaft darüber nachdenken, wie es wäre, mir Brex zu schnappen und aus Mission zu verschwinden.
Die Straßen waren in dieser Nacht ruhiger als sonst, nur wenige Autos waren unterwegs. Es lauerten keine Schatten mehr in der Dunkelheit von Mission, aber das gruselige Gefühl verließ mich erst, als ich vor dem The Rose stand.
Drinnen stand Kevin am Tresen und bediente einige Stammgäste. Er nickte mir zu und sah mich besorgt an, doch ich winkte und zwang mich zu einem Lächeln. Ich wollte mich nicht mit mitleidigen Blicken herumschlagen müssen. Ich wollte Bier servieren und Trinkgeld kassieren, dann zurück nach Hause gehen und aus meinen hohen Absätzen schlüpfen. In sechs Stunden.
Nachdem ich meine Sachen in meinen Spind geschlossen und noch einmal überprüft hatte, ob mein Mascara auch nicht verlaufen war, band ich mir eine Schürze um und schnappte mir Block und Stift. Die Angst, die ich draußen auf der Straße empfunden hatte, war verschwunden. Das war so toll an der Arbeit – besonders in einer geschäftigen Bar wie dem The Rose. Hier verdiente ich nicht nur Geld, sondern bekam auch den Kopf frei. Abseits des Tresens stand Ruby neben einem vollen Tisch, an dem es bereits ziemlich hoch herging. Als hätte sie einen sechsten Sinn, erwiderte sie meinen Blick.
»Tut mir leid«, formten ich mit den Lippen, denn dass ich mich verspätet hatte, hatte vor allem Ruby auszubaden.
Sie lächelte. »Alles in Ordnung«, entgegnete sie dann ebenfalls stumm, bevor sie sich wieder zu ihrem Tisch drehte.
Dann wechselte ich in den Tendra-Arbeitsmodus, bei dem es mir leichtfiel, zu lächeln und charmant zu sein. Ganz anders als die wirkliche Tendra, die scheue Katzenfrau mit der Angst vor herumschleichenden Killern. Für ein paar Stunden ging alles gut, bis Drake und seine Freunde hereinkamen, denn ab da begann die Nacht wirklich seltsam zu werden.
Einige Male – in schwachen Momenten –, wenn Drake die Augenbrauen hochgezogen und knapp mit dem Kinn in meine Richtung genickt hatte, hatte ich ihn auf einen Quickie mit nach oben in sein Einzimmerapartment genommen, trotz lauter Nachbarn und kaputtem Türschloss. Doch das war Monate her, und meine Lust auf Sex lag auf einer Skala bei minus zehn, seit Mom gestorben war.
Ich stellte ein Stout vor Drake und drehte mich dann weg von dem Tisch, an dem er und seine Freunde saßen. Kaum hatte ich einen Schritt in meinen Zehn-Zentimeter-Absätzen gemacht, als er das Wort an mich richtete. »Hey, Ten.«
Wegen der schlechten Akustik in der Bar hörte ich ihn kaum. Ein wilder Haufen spielte Poolbillard in einer Ecke, und einige Kerle schauten Basketball auf einem verschwommenen Bildschirm, der hinter der Bar hing. Im The Rose tummelten sich die üblichen Stammgäste. Als ich über meine Schulter blickte, hatte Drake die Hand erhoben, als wollte er mich berühren. Ich zog eine Augenbraue hoch, und er ließ die Hand in seinen Schoß fallen. »Hm, wie geht es dir?«
Langsam drehte ich mich zu ihm um, wobei mich seine Freunde nicht aus den Augen ließen. Drake war ein lauter Kerl und nicht der Schnellste, aber er war kein Arschloch. Normalerweise. Doch mit seinen Freunden, die jedes Wort mithörten und sich über ihn lustig machen würden, wenn ich ihn jetzt abkanzelte, wäre er über eine Zurückweisung nicht allzu glücklich. Das hatte ich schon auf die harte Tour bei einer Reihe anderer Männer lernen müssen. Ich warf mir das Haar über die Schulter. »Alles in Ordnung.« Lügen. »Und bei dir?«
Drake trank einen Schluck Bier. »Großartig, seit ich dich in diesem kurzen Rock durch die Bar gehen sehe.« Wieder zuckte sein Kinn vor.
Verflucht noch mal. Ich beugte mich vor und verzog die Lippen zu einem Lächeln, das genauso falsch war wie meine Freundlichkeit. »Schön, dass dir die Aussicht gefällt. Doch ich habe schon Pläne für heute Nacht. Versuch’s nächste Woche noch mal.« Ich konnte nur hoffen, es würde an dem einen Abend sein, an dem ich nicht hier arbeitete. Drake ging darauf ein. »Sicher, Ten.«
Ich schenkte ihm noch ein Lächeln. »Diese Runde geht auf mich, Jungs.«
Sie grölten, und Drakes Zurückweisung war vergessen. Heimlich leckte ich an meinem Zeigefinger und schrieb in die Luft: ein Punkt für Tendra.
Mit meinem Tablett in der Hand machte ich eine Runde durch meine Hälfte der Bar, um leere Gläser einzusammeln. In der anderen Hälfte stand Ruby neben einem Mann, der offensichtlich begeistert von den knappen Uniformen war, die wir trugen. Vor Kurzem hatte sich Ruby das Haar bis zum Schädel abrasiert, sodass ihre unglaublichen Wangenknochen und ihr perfektes Gesicht nun noch besser zur Geltung kamen. Das gedämpfte Licht in der Bar ließ ihre glatte, dunkle Haut leuchten. Kein Wunder, dass sie bei den Stammgästen so beliebt war.
Ein Tisch an der gegenüberliegenden Wand wurde frei, und die Männer stolperten Richtung Ausgang, um in den dunklen Straßen von Mission zu verschwinden. Ich sah auf meine Uhr. Noch fünfzehn Minuten, bis wir schließen würden. Nicht mehr lange, und ich würde nach Hause gehen und zusammen mit meinem Kater ins Bett fallen können.
Mein Job im The Rose sollte zuerst nur vorübergehend sein. Ich wollte dort nur arbeiten, bis ich etwas Besseres gefunden hätte – etwas mit Karriereaussichten –, doch Mission war kein Ort, an dem Träume wahr wurden. Jedenfalls nicht für Menschen wie mich. Trotzdem hatte ich ein Dach über dem Kopf und konnte meine Rechnungen bezahlen. Ich hatte eine Handvoll Freunde, denen ich vertraute. Meistens hing ich mit Ruby und ihren Freunden ab, wobei mein Platz am Rand ihrer Clique war. Nachdem ich als Kind so oft umgezogen war, war ich eine Außenseiterin geblieben, und inzwischen fühlte ich mich wohl in dieser Rolle. Ich war mir nicht sicher, wie es sich anfühlte, vollkommen akzeptiert zu werden. Zuhause war für mich eine sich ständig ändernde Variable. Wenn ich nicht arbeitete, war ich bei meinem Kater. Ruby machte sich lustig darüber, dass ich mit fünfundzwanzig wie diese verrückten Katzenladys war, doch ich sagte ihr, dass ich für diese Bezeichnung wenigstens drei Katzen haben müsste.
Sie entgegnete, dass Brex immerhin genug für drei Katzen wöge, und ich sagte ihr, dass sie ihn nicht dicker machen sollte, als er war; er hätte einfach nur schwere Knochen.
Den Rest meiner Zeit verbrachte ich damit, Spielfilmklassiker zu gucken und mich auf den dazugehörigen Fan-Seiten im Internet herumzutreiben. Vielleicht würde ich dort eines Tages Freunde finden, doch wie im wirklichen Leben war ich auch dort eine Außenseiterin.
Ich fand mich damit ab, dass ich mich schon immer so gefühlt hatte. Vielleicht waren wir nicht alle dazu geschaffen, irgendwo dazuzugehören. Oder zu irgendwem. Abgesehen davon lief es in meinem Leben nicht schlecht. Natürlich wäre alles besser, wenn Mom noch leben würde, doch das konnte ich nicht ändern.
Während ich versuchte, den Kloß in meiner Kehle herunterzuschlucken und die Tränen zurückzublinzeln, die mir in den Augen stachen, räumte ich den Tisch vor mir ab. Nachdem alle schmutzigen Gläser auf meinem Tablett standen, wischte ich mit einem feuchten Tuch über die Tischplatte, als sich plötzlich meine Nackenhaare aufrichteten.
Ich hörte nicht auf zu putzen. Ich vertraute meinen Instinkten, und doch wollte ich denjenigen, der mich beobachtete, nicht wissen lassen, dass ich ihn bemerkt hatte. Noch nicht. Aus dem Augenwinkel sah ich einen Mann in der Ecke sitzen. Er war allein, vor sich ein volles Bier. Seine Brauen waren so üppig, dass seine Augen im Schatten zu liegen schienen, dennoch war ich mir sicher, dass er mich beobachtete.
Verflucht. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen, und das hier war eine Bar, in der sich selten neue Leute blicken ließen. Wir befanden uns in einem Teil von Mission, in dem sich in den meisten Gebäuden Hausbesetzer mit einer Nadel im Arm breitgemacht hatten und keine ehrenwerten Unternehmen residierten. Die gleiche Angst, die ich schon früher am Abend verspürt hatte, schnürte mir die Brust zu, doch ich war auch neugierig. Das war der einzige Grund, aus dem ich meinen Hintern nicht schnellstens von ihm fortbewegte. Außerdem war das hier mein Territorium. Er befand sich auf meiner Scholle.
Mein Herz schlug laut, als ich wieder und wieder über den Tisch wischte, bis ich mein Spiegelbild auf der Oberfläche erkennen konnte. Ich konnte den Mann ignorieren, doch nun wollte ich ihn wissen lassen, dass ich ihn gesehen hatte. Manchmal, wenn ich mich Männern geradeheraus stellte, schienen sie mich für weniger schwach zu halten. Manchmal. Kurz dachte ich an alles, was ich in meinen Selbstverteidigungskursen gelernt hatte. Ich entschied mich dazu, mich normal zu verhalten und ihn zu fragen, ob er etwas bestellen wollte. Er sollte nicht ahnen, dass mich sein Blick in Panik versetzt hatte. Ich holte tief Luft und drehte mich um. Als ich mich auf seinen Tisch zubewegte und er leicht das Kinn hob, wusste ich, dass ich womöglich einen Fehler beging. Einen großen.
Seine Augen waren so dunkel, dass sie schwarz aussahen. Sein markanter Kiefer war scharf geschnitten. Seine schwarzen Haare hatte er im Nacken zusammengefasst, doch einige Strähnen hingen ihm über die Augen, und von seiner ganzen Erscheinung ging etwas aus, das mich leicht benommen machte. Soweit ich sehen konnte, war er ganz in Schwarz gekleidet. Ein langer Ledermantel mit einem schwarzen Shirt darunter, das nicht verbarg, wie breit seine Brust war. Jesus, dieser Mann sah aus, als ob er den gesamte Tresen hochheben und ihn über den Kopf werfen könnte.
Der einzige Türsteher, den wir hatten, war Kev, und der wog kaum siebzig Kilo und konnte weniger Wodkaflaschen tragen als ich.
Tief durchatmen, Tendra. Bleib einfach cool. Ich zeigte auf das Bier des Mannes. »Willst du noch etwas anderes? Ein Wasser? Die Küche hat geschlossen, aber ich könnte bestimmt irgendetwas auftreiben, falls du hungrig bist.« Warum war ich so geschwätzig?
Er rutschte leicht auf seinem Stuhl hin und her und legte die Hände flach auf den Tisch, bevor er sich wieder entspannte. Er schüttelte den Kopf, dann musterte er mein Gesicht für einen Moment. Als sein Blick an mir hinunterwanderte, fühlte ich ihn wie Feuer auf meiner Haut. Als mir der Mann dann wieder in die Augen sah, stand mein Inneres in Flammen.
Machte mich das wirklich an? Ein Fremder, der mir vermutlich mit einer Hand das Genick brechen konnte?
Ich musste verrückt sein. Oder auf dem besten Weg dorthin. Es gab absolut keinen Grund, dass er mich so verwirrte. Und doch … diese dunklen Augen hielten mich gefangen. Verführten mich.
Ich löste die Verbindung zwischen uns mit einer jähen Kopfbewegung. »Gut, also ich bin Tendra. Falls du etwas brauchst, ruf einfach.«
Dann entfernte ich mich so schnell von diesem Berg von Mann, wie meine kurzen Beine es zuließen. Wäre Drake nicht schon gegangen, hätte ich mir meine Entscheidung, ihn abzuweisen, noch einmal überlegt. Nur dass ich bei Drakes Berührungen dann sicher an jemand anderen gedacht hätte – an größere Hände, dunklere Augen, raueren Sex.
Wow, offensichtlich brauchte ich mehr Schlaf oder was auch immer.
An der Bar begann Kevin damit, die Betrunkenen Richtung Tür zu scheuchen. »Ihr braucht nicht nach Hause zu gehen, aber hier …«
»… könnt ihr nicht bleiben«, fielen ihm drei Stammgäste ins Wort und brachen in Gelächter aus.
Ich stellte das Tablett mit den leeren Gläsern auf den Tresen, und Kev begann sie zu spülen, während ich mich an die Bar lehnte, eine Hand an der Hüfte.
Carl drehte sich zu mir um. »Hey, Süße.« Er spitzte die Lippen zu einem Luftkuss, und ich schickte ihm einen zurück. Ich kannte seine Frau, seine Tochter und seine Enkelkinder, und er war der einzige Mann, der mich Süße nennen durfte. Er und sein Bruder kamen fast jeden Abend vorbei, legten ihre Hüte auf den Tresen, sodass das Licht auf ihren identischen glatten schwarzen Köpfen schimmerte.
»Wie geht es Sasha?«, fragte ich. Seine jüngste Enkeltochter hatte sich vor Kurzem den Arm gebrochen.
»Pah«, sagte er und schlug wegwerfend mit der Hand auf den Tresen. Nun ja, er verfehlte den Tresen, aber ich wusste, was er meinte. »Ihr geht’s gut. Hat einen Gips und springt immer noch von ihrem Hochbett runter.«
»Ich würde es wegräumen und sie auf einer Matratze auf dem Boden schlafen lassen«, erwiderte ich.
Michael, der neben Carl saß, lachte. »Ganz schön konsequent, Süße.«
Okay, also Michael durfte mich auch Süße nennen.
»Wir werden sehen, wie es ist, wenn du irgendwann deine eigene Rasselbande hast«, warf Kev ein.
»Wer sagt, dass ich Kinder will?« Ich nahm mein Tablett und beugte mich über den Tresen, um es auf der anderen Seite darunter zu verstauen.
Kev zog eine Augenbraue hoch, sagte aber nichts.
Soweit ich weiß, habe ich keine lebenden Angehörigen mehr. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass mein Dad gegangen war, als ich noch ein Baby war, und später hätte sie gehört, dass er bei einem Autounfall gestorben sei. Ein Teil von mir sehnte sich deshalb nach einer eigenen Familie, doch noch hatte ich keinen Kerl kennengelernt, mit dem ich meine Gene mischen wollte. Und ich würde lang und ernst darüber nachdenken müssen, ob ich überhaupt ein Kind auf diese Welt bringen wollte. Mir war es auf ihr nicht immer gut ergangen.
»Kommt, Jungs«, drängte Kev noch einmal. »Ihr braucht nicht nach Hause zu gehen, aber …«
»Das hast du schon gesagt!«, brüllte Michael und griff dreimal vergeblich nach seinem Hut, während er aufstand. Ich hob ihn für ihn hoch und setzte ihn auf seinen Kopf. Er murmelte einen Dank und folgte seinem Bruder Richtung Tür. »Bye, Süße!«, rief Carl.
»Kommt heil nach Hause!«, rief ich zurück.
Ich warf einen kurzen Blick in die Ecke, doch der große Mann war nicht mehr da. Er musste gegangen sein, während ich mich an der Bar unterhalten hatte. Ich fröstelte und hoffte, dass er niemals wiederkommen würde. Und dann hoffte ich irgendwie, dass er es doch tat.
»Alles in Ordnung?« Kev hatte die Brauen besorgt zusammengezogen.
»Mir? Jaja, mir geht’s gut.«
»Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.«
»Ich hatte nur gerade das Gefühl, als würde jemand über mein Grab gehen«, sagte ich, während ich zusah, wie der letzte Gast zur Tür marschierte. Gleich darauf setzte sich Ruby auf einen Stuhl, zog sich die Schuhe aus und schlüpfte in ein Paar Flip-Flops. Sie war eine zierliche schwarze Frau, und ihre Flip-Flops hatten Kindergröße, worüber ich mich oft lustig machte. Sie seufzte und wackelte mit den Zehen. »Ich habe keine Ahnung, wie du in diesen Dingern die ganze Nacht herumlaufen und dann noch nach Hause gehen kannst.« Sie sah zu mir herüber, fasste sich an ihre gerötete Ferse und verzog das Gesicht. »Ich hasse sie. Teufelsschuhe.« Sie kreuzte die Finger und schwenkte sie vor ihren Füßen hin und her.
Ich zuckte mit den Schultern und begann damit, die Tische abzuwischen und die Stühle hochzustellen. »Keine Ahnung. Mich stören die Schuhe nicht. Außerdem sind sie fantastische Waffen.« Meine Mutter hatte immer große Stücke auf Selbstverteidigung gehalten. Ich war wie MacGyver, wenn es ums Kämpfen ging. Himmel auch, ich würde sogar einen Weg finden, mit einer Büroklammer eine Halsschlagader aufzuschlitzen.
Wir räumten die Bar in Rekordzeit auf. Danach ließ ich mich auf einen Stuhl fallen, um ein Glas Wasser zu trinken, bevor ich mich auf den Heimweg machen würde. Ruby stand neben mir und legte den Kopf auf meine Schulter. »Wie geht es dir? Es kommt mir vor, als hätten wir seit einer Ewigkeit nicht mehr miteinander gesprochen.«
Lachend befreite ich mich von ihr. »Du warst mit deiner Frau beschäftigt.«
Ruby setzte sich neben mich und knabberte an ihrer Lippe. »Ich weiß, aber du bist meine Freundin, und für die sollte ich Zeit haben.«
»Stopp. Es ist eine neue Beziehung. Du fühlst dich nur deshalb schlecht, weil du weißt, dass ich keine anderen Freunde haben.« Ruby schnappte nach Luft. Vielleicht hätte ich das nicht laut aussprechen sollen und auch nicht so deutlich, und doch war es wahr. Ich seufzte. »Ist schon in Ordnung, wirklich. Es macht mir nichts aus, allein zu sein.«
Ruby rieb sich über die nackten Schultern. »Vielleicht könnten wir mal zu dritt abhängen.«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Sie hat gesagt, dass sie vielleicht irgendwann in der nächsten Woche vorbeischauen will, wenn ich hier arbeite. Falls du sie kennenlernen möchtest.« Ruby war immer auf Harmonie bedacht. Sie wollte, dass alle glücklich waren und gut miteinander auskamen.
Ich war zu zynisch für so etwas, aber ihr zuliebe spielte ich mit. »Klar, das wäre nett.«
Rubys Gesicht begann zu leuchten, trotz der müden Linien darauf. »Großartig. Ich werde es ihr sagen. Ich möchte, dass ihr zwei euch mögt.«
Typisch Ruby. Wünschte sich, dass sich alle toll fanden. Was nichts Schlechtes war, denn dafür musste ich über meinen Schatten springen. »Ich bin mir sicher, dass wir uns gut verstehen werden.«
Sie drückte meine Hand, dann stand sie auf. »Ich muss jetzt los. Kannst du allein abschließen, Kev?«
»Das kriege ich schon hin, Ladys.« Er zählte das Geld in der Kasse und machte eine kurze Pause. »Geht nach Hause.«
Nachdem ich mich von Kev und Ruby verabschiedet hatte, schlüpfte ich in meine Lederjacke, schlug den Kragen hoch und machte mich auf den Heimweg. Die Nachtluft war kühl, doch es war eine angenehme Kälte, eine leichte Brise fuhr mir durchs Haar und kühlte meinen Nacken und meine feuchte Haut.
Als Mom noch lebte, war sie extra nachts aufgestanden, um mich in der Bar abzuholen und mit mir zusammen nach Hause zu gehen. Ich sagte ihr, dass ich schon allein klarkäme, doch sie bestand darauf, dass es ihr Vergnügen machen würde. Auf dem Heimweg haben wir dann in der Dunkelheit über alles und nichts gesprochen, und heute gehören diese Momente zu meinen wertvollsten Erinnerungen.
Nun ging es mir richtig mies.
Ich hörte seine Schritte nicht, ich sah ihn nicht, und doch spürte ich seine Anwesenheit, diese überwältigende Aura, die mich schwindeln ließ. Ich war immer stolz auf meine Instinkte gewesen, doch das hier spielte sich auf einer ganz anderen Sechste-Sinn-Ebene ab.
Ich schob die Hand in meine Jackentasche und suchte nach meinem Schnappmesser. Ruby hatte mich irgendwann mal gefragt, warum ich kein Pfefferspray mit mir herumtrug wie andere Menschen. Doch meine Mutter hatte immer darauf bestanden, dass ich auch in der Lage war, mich handfest zu verteidigen. Sie hatte nicht erwartet, dass ich ein Waffentraining absolvieren würde, aber ich tat es. Nun war also ein Schnappmesser die Waffe meiner Wahl, ohne die ich niemals von der Arbeit nach Hause ging. Ob der Mann mich vergewaltigen, ausrauben oder töten wollte – ich wäre vorbereitet. Danach würde ich sofort aus Mission verschwinden.
Er kam näher, die Luft war erfüllt von ihm. Ich zwang mich zu atmen, um einen klaren Kopf zu behalten. Ich würde heute nicht unterliegen.
Bleib fokussiert, zehn. Ich zählte in meinem Kopf herunter und wusste, dass er überzeugt davon war, dass ich ihm nicht entkommen könnte. Niemals. Nicht einem Mann seiner Größe. Nicht, wenn ich hohe Absätze trug.
Fünf. Ich schloss meine Finger um den Griff des Messers. Vier. Ich sorgte dafür, dass es perfekt in meiner Hand lag. Drei. Ich drückte auf den kleinen Knopf, damit die Klinge heraussprang. Zwei. Ich holte tief Luft.
Eins.
Ich wirbelte herum und duckte mich, während ich gleichzeitig mit dem Messer in einem Bogen von unten nach oben schwang.
Ich hatte recht gehabt. Er war da, nur ein Stück hinter mir, und er wich zurück und verhinderte so nur knapp, dass ich ihm die Klinge quer über die Kehle zog. Mit einer fließenden Bewegung senkte ich die Klinge und zielte auf seine Eingeweide, die verletzliche Stelle zwischen seiner geöffneten Jacke.
Ich sah seine Hand nicht einmal, bis seine Finger sich um mein Handgelenk schlossen und so fest zudrückten, dass ich nicht anders konnte, als die Klinge fallen zu lassen. Mit einem frustrierten Schrei griff ich hinter dem Rücken nach meinem Schuh und versuchte, ihm mit dem Stiletto ins Gesicht zu hauen. Doch er schlug ihn mir mit Leichtigkeit aus der Hand, sodass der Schuh über die Straße flog.
Mein Herz schlug voller Panik, und als er mich an seine Brust zog, versuchte ich verzweifelt, das Gleichgewicht zu halten und mich darauf zu konzentrieren, wie ich überleben und entkommen konnte. Es gab eine letzte Möglichkeit, mich zu verteidigen, und so zog ich mein Knie mit Wucht hoch, um es ihm zwischen die Beine zu rammen.
Es gelang mir nicht einmal ansatzweise, weil er nicht länger vor mir stand, und in der nächsten Sekunde hatte ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Seine Arme umfassten mich von hinten, und meine Füße baumelten nutzlos in der Luft, während er mich an seine Brust drückte. Ich versuchte, ihm mit dem Hinterkopf ins Gesicht zu schlagen, doch seine enorme Größe machte das unmöglich.
Meine letzte Chance – alles was mir noch blieb, mich in diesem Teil der Stadt aber vermutlich nicht weit bringen würde – war es, zu schreien.
Also tat ich es. Ich schrie mir die Lunge aus dem Leib und schlug um mich wie ein wildes Tier. Er murmelte etwas, und seine Stimme war ein tiefes Grollen an meiner Wirbelsäule. »Tut mir leid, das tun zu müssen, Tendra.« Dann hielt er sein Handgelenk vor mein Gesicht.
Ich atmete etwas ekelig Süßes ein. »Was zum …« Ich konnte den Satz nicht beenden. Meine Lippen und meine Zunge wurden taub. Mein Blickfeld verdunkelte sich an den Rändern, und das Letzte, woran ich mich erinnerte, bevor alles um mich herum schwarz wurde, waren seine Finger, die mir das Haar aus der Stirn strichen.
Kapitel 2
Tendra
Ich träumte von meiner Mutter. Ihren langen blonden Haaren – genau wie meine –, ihren warmen Händen, den freundlichen Augen. In meinem Traum lächelte sie, und ich lächelte zurück. Tränen sammelten sich in meinen Augen, als ich die Hand nach ihr ausstreckte. Nur eine letzte Berührung, eine letzte Umarmung, ein letztes Mal ihren Duft einatmen.
Doch dann verzerrte sich ihr Gesicht, ihre Augen wurden rot, und ihr Mund öffnete sich weiter und weiter, bis er ein großes schwarzes Loch war, das ihr gesamtes Gesicht einnahm. Etwas Dunkles flog aus ihm heraus und direkt auf mich zu, und ich erwachte mit einem Ruck.
Ich blinzelte, konnte noch nicht klar sehen. Ich hatte nicht ein einziges Mal von ihr geträumt, seit sie tot war. Doch das war kein Traum gewesen – das war ein Albtraum. Meine Haut kribbelte, und das Herz schlug mir in den Ohren, als ich versuchte, meinen Atem zu beruhigen. Ich schüttelte den Kopf und wünschte mir, das Bild löschen zu können, wie sie sich in eine Art Dämon verwandelte. Ich versuchte, mich zu bewegen, doch irgendetwas hielt mich fest, fixierte mich, und meine Schultern waren steif …
Als ich endlich klar sehen konnte und an mir herabblickte, sah ich, dass meine Knöchel zusammengebunden und an einen Stuhl festgebunden waren. Meine Arme waren auf meinem Rücken gefesselt worden. Ich befand mich in einem seltsamen Apartment, das bis auf wenige zusammengewürfelte Möbelstücke leer war. Der Putz bröckelte von den Wänden, die Decke schien kurz vor dem Einsturz, und ich spürte kalte Nachtluft auf meiner Haut, die durch ein teilweise zerbrochenes Fenster hereinströmte. Ich blickte hinaus und schätzte, dass wir uns etwa im fünften Stockwerk befanden. Meine nackten Zehen kratzte über einen schadhaften Blindboden.
Vor mir? War der Mann. Der mit den dunklen Augen aus der Bar. Er hatte sich entspannt in einem Sessel ausgestreckt. Seine langen Beine und kräftigen Schenkel steckten in einer schwarzen Jeans, die Füße in schwarzen Stiefeln lagen auf dem Boden.
Panik stieg in mir auf. Ich war gefangen in einem seltsamen Apartment mit einem seltsamen Mann, der womöglich dreimal so schwer war wie ich. Ich öffnete den Mund, um zu schreien, doch er hob die Hand und sagte mit tiefer Stimme: »Wenn du schreist, werde ich dafür sorgen, dass du wieder schläfst.«
Meine Kiefer klappten zusammen. Ich konzentrierte mich auf meine Atmung. Ein und aus. Ein und aus. Ich wollte um mich schlagen und brüllen, doch er würde mich wieder ausknocken, und das würde mir auch nicht weiterhelfen.
Ich sah mich um. Die einzige Lichtquelle war eine kleine, gedimmte nackte Glühbirne über uns. Der übrige Raum lag im Schatten. Es gab nichts, was ich als Waffe hätte benutzen können, noch nicht einmal meine Schuhe. Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf den Mann vor mir. »Wie sind wir hierhergekommen?«
»Ich habe dich getragen«, antwortete er mit einer Stimme, die ich bis in die Knochen spürte.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich etwas bewegte, und ich starrte ins Dunkel. Ein Umriss wurde sichtbar. Ich musste immer noch träumen, denn plötzlich war Brex da. Er kam auf mich zu, rieb sich an meinem Bein und setzte sich dann neben meine Füße wie ein Katzenwächter. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, doch ich war kurz davor, die Fassung zu verlieren. Datete man sich heutzutage auf diese Weise? »Warum ist mein Kater hier?«
Mein Kidnapper bewegte sich nicht, sein Gesicht lag zur Hälfte im Schatten. »Ich habe ihn hergebracht.«
»Ich habe keinen Ausweis bei mir, also wie konntest du wissen, wo ich wohne?«
»Dazu brauchte ich deinen Ausweis nicht.« Seine Augen verengten sich leicht. »Ich habe dich beobachtet.«
Na großartig. Ein Stalker. Ich konnte von Glück reden, wenn ich hier wieder rauskam, ohne dass mein Kopf in seiner Tiefkühltruhe landete und er meine Haut als Mantel trug. »Okay, cool. Nun, hm. Ich bin Tendra. Ich beglückwünsche dich, zu dieser unkonventionellen … hm … Begrüßung. Möchtest du mich losbinden? Wir könnten irgendwo etwas trinken gehen. Außerdem mache ich einen ganz ordentlichen Screwdriver.«
Für einen Moment sah er verwirrt aus, dann wurde sein Blick noch finsterer, als ärgerte ihn seine Unsicherheit. »Nein.«
Ich wollte ihn nicht gegen mich aufbringen, doch es ist mir noch nie leichtgefallen, den Mund zu halten. Manchmal war mein loses Mundwerk sogar der Grund dafür gewesen, dass wir umziehen mussten. »Willst du Geld? Dann muss ich dir leider sagen, dass du das falsche Mädchen gekidnappt hast. Außerdem habe ich gerade erst die Miete bezahlt. In der nächsten Woche werde ich mich von Erdnussbutter aus der Tube ernähren.«
Wieder schien er verwirrt und sich darüber zu ärgern. Er rieb sich über die Stirn. »Ich will nicht dein Geld.«
Ich knirschte mit den Zähnen. »Also was hast du dann mit mir vor?« Meine Panik wandelte sich langsam in Wut, und der Kampfinstinkt, den meine Mutter mir eingeimpft hatte, war so stark wie immer. Wenn er mich töten wollte, konnte ich ihn vielleicht so sauer machen, dass es schnell vorbei sein würde. »Denn eins sage ich dir gleich. Ich werde bis zum letzten Atemzug gegen dich kämpfen und dann von den Toten wiederkehren und dich so lange jagen, bis du dir irgendwann deinen eigenen Schwanz abschneiden wirst.«
Sein Gesichtsausdruck änderte sich nicht. »Charmant.«
Ich unterschrieb mein Todesurteil, doch ich konnte nicht widerstehen, das Spiel noch weiterzutreiben. »Fick dich, du Kriecher.«
Sein Brustkorb hob sich, als er scharf Luft holte. »Okay, also lass uns eins klarstellen. Ich bin dein Wächter, dein Beschützer, weil du dazu bestimmt bist, dass ich dich zu meinem älteren Bruder bringe, um unseren Clan zu stärken.«
Ich rührte mich nicht. Kein Stück. Weil dieser Kerl nicht nur ein schäbiger Stalker war, sondern noch dazu nicht alle Tassen im Schrank hatte. Es konnte nicht einfach ein verdammter Stalker sein. Oh nein, er musste noch dazu geisteskrank sein. Nichts von dem, was er sagte, machte Sinn, also konzentrierte ich mich erst mal nur auf eine Sache. »Entschuldige bitte. Clan? Was seid ihr, Höhlenmenschen?«
Ich dachte, er wäre beleidigt, stattdessen sah er gelangweilt aus. »Nein, keine Höhlenmenschen. Vampire.«
Ich blinzelte.
Und blinzelte noch einmal.
Doch er war immer noch da. Das alles passierte tatsächlich. Und das mir. Falls ich hier lebend rauskommen sollte, hatte ich eine tolle Geschichte zu erzählen über einen Stalker, der dachte, er wäre ein Vampir. Ich stellte mir vor, wie der Kerl versuchte, mir mit seinen stumpfen Zähnen in den Hals zu beißen. Ein Kichern stieg meine Kehle hinauf, das zu einem Lachen wurde, bis ich schließlich in einem hysterischen Lachanfall den Kopf in den Nacken warf, bis mir die Tränen über die Wangen liefen.
Als ich den Kopf wieder nach vorn fallen ließ und ihn durch meine Tränen hindurch ansah, beobachtete er mich aufmerksam, und seine Miene war weiterhin ausdruckslos.
Er beugte sich vor und griff Brex an der Nackenfalte, was dafür sorgte, dass meine Heiterkeit auf der Stelle versiegte. »Wenn du meinem Kater wehtust, ich schwöre bei Gott …«
Brex miaute und schlug mit der Pfote nach dem Gesicht des Mannes. Eine dünne rote Linie zeigte sich auf seinem Wangenknochen, bevor er Brex losließ, der sich schnell unter einem kleinen Tischchen neben einem alten Sofa verkroch. »Gut gemacht, Brex!«, rief ich ihm zu. »Jetzt komm zurück, und bring den Job zu Ende!«
Ich drehte mich zu meinem Stalker um, und was immer ich gerade hatte sagen wollen, blieb mir in der Kehle stecken. Ich sah, wie sich der Kratzer auf seiner Haut schloss und vor meinen Augen verschwand.
Weg.
Kein Kratzer, kein Blut. Nichts.
Und diese dunklen Augen waren immer noch auf mich gerichtet.
Heilige Scheiße.
Im nächsten Moment schrie ich mir die Lunge aus dem Leib, und purer Horror kroch mir scharf wie Rasierklingen die Kehle hinauf. Es war mir egal, ob er mich wieder betäuben würde. Wenigstens würde ich dann nicht mitbekommen, wenn er meinen Körper für irgendein satanisches Ritual aufschlitzte. Meine wilden Bewegungen sorgten dafür, dass der Stuhl, auf dem ich saß, zur Seite kippte und ich mit der Schulter schmerzhaft auf den Boden schlug.
Nun kam Bewegung in den Mann. Er legte mir eine Hand auf den Mund und hielt mir etwas nah vors Gesicht. Ich kniff die Augen zusammen und weigerte mich hinzuschauen, da ich nicht die Absicht hatte, mich hypnotisieren oder in Stein verwandeln zu lassen oder was auch immer.
»Tendra, sieh hin, was ich dir zeige!«, zischte er.
Ich öffnete die Augen und blickte auf einen Anhänger, der vor meinem Gesicht hin und her schwang. Es war ein Edelstein, und er war identisch mit der Halskette meiner Mutter, die ich zu Hause in meinem Apartment im Schrank versteckt hatte. Langsam nahm der Mann die Hand von meinem Mund, und ich schluckte, damit sich meine heisere Kehle beruhigen konnte. »Warum hast du die Halskette meiner Mutter, du Bastard?«
Er schüttelte den Kopf. »Das ist nicht die deiner Mutter. Diese hier gehört meiner Familie.«
Ich glaubte ihm nicht. Er musste sie gestohlen haben, als er den Kater geholt hatte, dieser verfluchte Psycho. »Gib sie mir wieder.«
Mit einem Seufzer richtete er sich auf und ging davon.
»Wo gehst du hin?«, rief ich ihm nach. »Bind mich los!«
Er antwortete nicht. Sein langer Mantel schwang um seine Beine, als er den Raum mit drei langen Schritten durchmaß und aus meinem Blickfeld verschwand.
»Hey!« Ich wackelte herum, um den Stuhl mit meinem gefesselten Körper darauf zu bewegen. »Ich rede mit dir!«
Nach etwa dreißig Sekunden kam er zurück und hielt die Schachtel mit dem Schmuck meiner Mutter in seiner Hand. Er stellte die Schachtel neben meinen Kopf und machte sich dann in meinem Rücken zu schaffen. Nach einigem Ziehen kamen meine Hände frei. Er löste auch meine Füße, und sobald ich frei war, schnappte ich mir die Schachtel und kroch auf Händen und Füßen weg von ihm. Ich stand auf und sah mich nach einer Waffe und nach Brex um, als sich ein Arm um meine Taille legte und mich in die Luft hob.
Ich grollte. »Es ermüdet mich, dass du mich ständig hochhebst.«
»Und mich ermüdet, dass ich dich ständig hochheben muss«, erwiderte er und warf mich wie eine Stoffpuppe auf das Sofa. Staub wirbelte um mich herum auf, und ich hustete.
Er zeigte auf die Schachtel. »Mach sie auf.«
»Nein«, entgegnete ich, weil ich mir von ihm nicht sagen lassen wollte, was ich zu tun hatte.
Seine Nasenflügel blähten sich für einen Moment. Er war sauer. Gut, eine Emotion. Endlich.
»Tendra, wir verschwenden unsere Zeit. Ich bin nicht dein Feind. Mach die verdammte Schachtel auf.«
Ich ließ die Spange aufschnappen und öffnete sie. Der Anblick des Schmucks tat immer noch weh. Da waren die Ringe meiner Mutter, der Opal, der in der Sonne glitzerte, ihre Perlenhaarspange … und ihre Smaragdkette.
Die identisch mit jener war, die mein Kidnapper in seiner gewaltigen Hand hielt.
Was ging hier vor?
»Wie ist dein Name?«, fragte ich ihn.
»Athan«, sagte er.
»Und du bist ein Vampir.«
Er öffnete den Mund und schürzte seine Oberlippe. In das Schwarz seiner Augen mischte sich ein roter Wirbel, und innerhalb von Sekunden verwandelten sich seine Eckzähne in Fangzähne.
Vampirzähne.
Jede Faser meines Körpers wollte flüchten, doch hatten Raubtiere nicht einen angeborenen Jagdinstinkt? Also blieb ich, wo ich war, und hielt mir die Hand vor den Hals. Sein Blick folgte meinen Bewegungen, und sofort schloss er den Mund, und seine Augen wurden wieder normal.
Nun, seine Art von normal.
Vampire waren ein Mythos, Legende, etwas, von dem Eltern ihren Kindern erzählten, finstere Kreaturen in Filmen.
Sie waren nicht real.
Doch seine Haut heilte, er bewegte sich rasend schnell, und er hatte … Fangzähne.
Ich versuchte, ruhig zu bleiben. »Du hast also eine Halskette, die wie die meiner Mutter aussieht, und … Vampirzähne. Was ist hier los?«
Er setzte sich auf den schmalen Tisch vor mir, dessen Beine unter seinem Gewicht ächzten. Mit den Händen zwischen seinen Knien war er nur ein Stück von mir entfernt. Doch wenigstens hatte ich mich ein wenig von ihm entfernt, und er machte mich nicht mehr ganz so benommen.
Brex’ weiße Pfote schoss vor und erwischte Athan am Knöchel. Dieser hob eine dunkle Braue, bevor er seine gigantische Hand nach unten streckte, um Brex hochzuheben. Mein Kater sah ziemlich verärgert aus, als Athan ihn in meinen Schoß plumpsen ließ. Er schüttelte sich und setzte sich dann neben mich.
»Deine Mom hat darauf bestanden, dass du dich verteidigen kannst.«
»Ja, stimmt, Sport war ihr wichtig.«
»Sie wollte sichergehen …« Er hielt kurz inne und wählte seine Worte mit Bedacht. »Dass du weißt, wie man kämpft.«
»Okay, ich habe es schon beim ersten Mal verstanden.« Finster sah ich ihn an. »Also gut, sie bestand darauf, dass ich es lernte. Doch ich habe mit den Selbstverteidigungskursen erst begonnen, nachdem etwas passiert war.«
Seine Kiefermuskeln zuckten. »Und was war das?«
»Nichts, was dich etwas angeht.«
Er zog die Brauen zusammen. »Was. War. Das?«
»Auf einer Exkursion haben sich einige Kerle meine Freundinnen und mich geschnappt. Zufrieden? Wir waren in einem Museum. Sie haben uns geschnappt und uns in ein Haus gebracht, wo sie uns fesselten. Sie sagten, dass sie uns dort festhalten müssten, bis es dunkel würde. Ich hatte keine Ahnung, warum, und meine Freundinnen auch nicht. Wir konnten nur entkommen, weil uns ein Mitschüler gefolgt war und sich das Autokennzeichen gemerkt hat. Und so wurden wir gerettet, bevor es dunkel wurde.«
Er schluckte, und für einen Moment sah er zornig aus. »Kam dir irgendetwas daran verdächtig vor? Dass sie warten wollten, bis es dunkel war?«
»Hm, weil es einfacher ist, drei Mädchen in der Dunkelheit irgendwohin zu bringen?«
»Richtig. Und nicht, weil Vampire kein Sonnenlicht ertragen.«
»Machst du dich über mich lustig?« Doch kaum hatte er die Worte ausgesprochen, fügten sich die Teile in meinem Kopf zusammen. Sowenig es mir gefiel, schufen sie doch ein Bild, das mich ausflippen ließ.
Er ignorierte meine Frage. »Und du bist als Kind häufig umgezogen?«