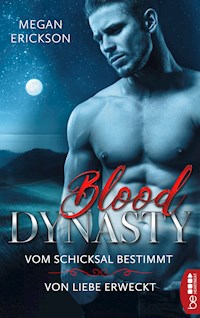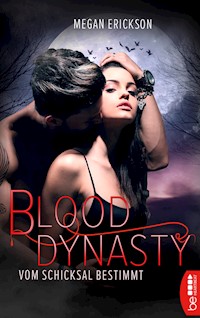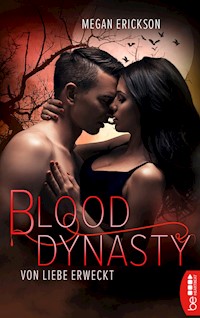
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Vampir-Romance
- Sprache: Deutsch
Blut, Action, Leidenschaft
Celia hat ihre Eltern nie gekannt und sich immer wie ein Waisenkind gefühlt. Alles was sie will ist ein normales Leben. Aber diesen Wunsch muss sie endgültig aufgeben, als sie plötzlich von einem Vampir angegriffen wird. Idris, der zum Clan der Gregorie gehört, kann Celia in letzter Sekunde retten. Doch auch er hat nicht nur Gutes im Sinn - denn als Tochter seines Erzfeindes, soll sie eigentlich der Preis für Idris' Freiheit sein. Wenn es nicht plötzlich gewaltig zwischen den beiden knistern würde ... Das Feuer der Leidenschaft verändert alles. Aber ausgerechnet jetzt versucht die Familie, nach der Celia sich immer gesehnt hat, sie zu töten. Und es ist Idris Aufgabe, sie erneut zu retten.
Die spannende und heiße Fortsetzung zu "Vom Schicksal bestimmt - Blood Dynasty". eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Epilog
Danksagung
Über dieses Buch
Celia hat ihre Eltern nie gekannt und sich immer wie ein Waisenkind gefühlt. Alles was sie will ist ein normales Leben. Aber diesen Wunsch muss sie endgültig aufgeben, als sie plötzlich von einem Vampir angegriffen wird. Idris, der zum Clan der Gregorie gehört, kann Celia in letzter Sekunde retten. Doch auch er hat nicht nur Gutes im Sinn – denn als Tochter seines Erzfeindes, soll sie eigentlich der Preis für Idris Freiheit sein. Wenn es nicht plötzlich gewaltig zwischen den beiden knistern würde … Das Feuer der Leidenschaft verändert alles. Aber ausgerechnet jetzt versucht die Familie, nach der Celia sich immer gesehnt hat, sie zu töten. Und es ist Idris Aufgabe, sie erneut zu retten.
Über die Autorin
Die USA-Today-Bestsellerautorin Megan Erickson war Journalistin, bevor sie sich entschied, Romane zu schreiben. So kann sie wenigstens selbst entscheiden, wie die Geschichte ausgeht.
Sie lebt in Pennsylvania zusammen mit ihrem eigenen Romance-Helden und zwei Kindern. Wenn Megan nicht schreibt, macht sie es sich entweder mit ihren beiden Katzen gemütlich, oder sie denkt über neue Geschichten nach.
MEGAN ERICKSON
BLOODDYNASTY
VON LIEBE ERWECKT
Aus dem Amerikanischenvon Susanna Arens
beHEARTBEAT
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Megan Erickson
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Blood Veil«
Originalverlag: This translation is published by arrangement with Loveswept, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: Arthur-studio10 | ROSSARINPHOTO
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6756-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Wesley Snipes und Stephen Dorff,die eines der besten Held-und-Bösewicht-Teamsin der Geschichte des Vampirfilms abgeben.
Prolog
Idris
Ich schritt durch das Bite, während die tiefen Bässe die Wände vibrieren ließen und in meinem Kopf hämmerten. Der Klub war proppenvoll – auf der Tanzfläche wanden sich zahllose Vampire, die nach Blut dürsteten, und Menschen, die es ihnen bereitwillig geben wollten. Ich ging weiter in den Klub hinein, in den lediglich sorgfältig ausgewählte Menschen kamen – solche, die versprochen hatten, über die Existenz von Vampiren zu schweigen –, um ihr Blut gegen Bezahlung zu geben. Es war ein Geschäft, das für die Menschen und den Vampirclan der Gregorie gleichermaßen funktionierte. Wir nahmen uns nicht mit Gewalt, was wir brauchten, und sie ließen uns in Ruhe in den alten U-Bahn-Tunneln unter ihrer Stadt leben.
Nicht alle Vampirclans respektierten die Autonomie der Menschen. Einige wollten über sie herrschen, sie zu bloßen Blutsklaven reduzieren. Und genau das war der Grund, aus dem ich gerufen worden war, um mich in einem Privatzimmer des Bite mit meinem Bruder zusammenzusetzen – dem neu gekrönten König der Gregorie-Vampire.
Das Hochgefühl, weil ich nur zehn Minuten zuvor meine Fangzähne in einen Menschen gebohrt hatte, und das Rauschen von frischem Blut durch meine Adern ließen langsam nach. Ich war nicht glücklich darüber, dass Athan aus unserem verborgenen Familiensitz außerhalb von Mission herbeigeeilt war, um sicherzustellen, dass ich meine Aufgabe erfüllte. Nein, ich war zum Teufel noch mal ganz und gar nicht glücklich darüber.
Stöhnen erfüllte meine Ohren, als ich durch die Menge schritt. Ich war in einen Bereich gekommen, in dem sich zahlreiche Sofas befanden, auf denen sich mehr oder weniger bekleidete Menschen und Vampire tummelten. Eine Frau, die auf dem Schwanz eines Vampirs ritt, drehte sich um und warf mir einen Blick zu, während ich vorbeiging. Der Mund in Ekstase geöffnet, die Augen glasig.
Doch für all das hatte ich keinen Kopf. Ich hatte Blut getrunken und dann gehört, dass mein Bruder hier war. Meine Menschenfrau war nicht glücklich gewesen. Sie wollte einen Vampirschwanz für sich allein haben. Zu schade, sie würde ihn irgendwo anders finden müssen. Verdammt, wahrscheinlich war sie in diesem Augenblick sogar hier in diesem Raum. Ich hatte ohnehin nicht vorgehabt, sie zu ficken. Anders, als mein Bruder vermutlich annahm, war ich hier, um zu trinken, und auch das nur, weil ich es musste. Ich war ganz und gar auf meine Mission fokussiert.
Ich ging einen Korridor entlang, bog um eine Ecke und folgte dann einem anderen, der mich noch tiefer ins Bite führte, dorthin, wo nur die Angestellten des Klubs, Mitglieder der königlichen Familie – ich – und unsere Wachen Zugang hatten. Endlich kam ich zu der richtigen Tür und stieß sie auf.
Athan saß an einem Tisch, groß und Achtung gebietend, und seine dunklen Augen musterten mich, als ich mich in einen Sessel gegenüber von ihm fallen ließ.
Er sagte nichts, deshalb tat ich es. »Warum bist du hier?«
Athans Kiefermuskel zuckte bei meiner Frage, und plötzlich war der Raum wie aus dem Nichts mit seiner Energie gefüllt. So war es immer, seit er von der Sanguivita getrunken hatte. Athan war nun überlebensgroß, ein wahrer König, der stärker war als zehn Vampire zusammen, hatte verdammte Flügel und konnte sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen, ohne zu verbrennen.
Meine Hand – die mit dem verstümmelten Finger – zuckte in meinem Schoß.
»Ich bin hier, um sicherzustellen, dass du keine Dummheit begehst, Bruder«, antwortete Athan.
»Als du mich auf diese Mission geschickt hast, warst du nicht so besorgt.«
»Ich habe meine Ansicht geändert.«
Meine Augen verengten sich zu Schlitzen, als ich ihn ansah und mich fragte, woher zum Teufel dieses Misstrauen kam. Dann wusste ich es. »Zeb.«
»Ich habe ihn ein Auge auf dich werfen lassen …«
»Verdammt«, sagte ich und fuhr aufgebracht mit der Hand durch die Luft. »Ehrlich? Du hast mich ausspioniert?«
»Ich dachte, dein Zorn würde abkühlen«, erklärte Athan ohne Bedauern in der Stimme. »Ich dachte, du würdest dich auf die Mission konzentrieren und …«
»Ich bin verdammt noch mal konzentriert. Ich war nur deshalb kurz abgelenkt, weil ich trinken musste, und dann hast du mich in diesen Raum beordert, um mir die Leviten zu lesen.«
»Darauf will ich hinaus«, schnappte Athan. »Es besteht ein Unterschied, ob man sich auf die Mission konzentriert und sein Ziel fest im Blick hat oder ob man sich in ihr so verliert, dass man nicht mehr sieht, was am besten für den Clan ist.«
Ich starrte ihn an, sprachlos. Als ich dann doch den Mund öffnete, erkannte ich kaum meine eigene tonlose Stimme wieder. »Willst du damit sagen, dass ich nicht mache, was am besten für die Familie ist?«
Das letzte Wort ließ Athan zusammenzucken, und zum ersten Mal, seit er mich im Bite in die Ecke getrieben hatte, entdeckte ich ein wenig von meinem Bruder in ihm und sah nicht nur den König mit einem Gesicht wie aus Stein. »Ich sagte nicht …«
Ich hob die linke Hand, an der das erste Glied des Mittelfingers fehlte. Es fiel kaum auf, und jeder, der nicht davon wusste, hätte es für eine unwesentliche Verletzung gehalten. Doch für mich war damit ein unvergesslicher Schmerz verbunden, eine ständige Erinnerung daran, wozu mein Vater fähig gewesen war und für wie wertlos er mich gehalten hatte. Ich wedelte mit der Hand vor Athan, und sein Blick fiel auf meinen Finger. »Sag mir nicht, ich würde nicht tun, was für meinen Clan am besten ist. Ich stand auf diesem verdammten Dach und hätte zugelassen, dass mich unser Vater Stück für Stück verbrennen ließ, um deine kostbare Tendra zu retten.« Ich fauchte die letzten Worte und war wirklich angepisst. Mehr als das.
Auch Athan war sich dessen bewusst. Mein Zorn war schon immer so glühend gewesen, dass er alles um mich herum versengte. Athan war derjenige, der sich unter Kontrolle hatte. Der Beständige. Der König.
Als er wieder sprach, bebten seine Nasenflügel, und seine Stimme klang weicher. »Ich will nur mit dir reden, damit ich weiß, wo du mit deinen Gedanken bist. Ich bin nicht hier, um zu streiten.«
»Dann sprich«, fuhr ich ihn an.
Athan schürzte die Lippen. »Zeb sagt, dass du ausgesprochen ungeduldig bist.«
»Ja, ich bin verflucht ungeduldig. Du bist ein gottverdammter Supervampir, und doch willst du es mit dem König der Valarians ruhig angehen lassen? Scheiß drauf. Scheiß auf ihn. Er hat unseren Vater auf seine Seite gezogen, unseren Clan in große Gefahr gebracht und will seinen Daumen auf jedem einzelnen Menschen haben.«
»Ich will keinen Krieg …«
»Er hat uns den Krieg in jener Sekunde erklärt, in der er sich mit seinen Klauen an Vater geklammert hat.«
»Idris, ich will, dass unser nächster Schritt von langfristiger Bedeutung ist. Ich will keinen Krieg beginnen, denn wenn wir der Schlange den Kopf abhauen, werden ihr drei neue wachsen. Ich will, dass es tatsächlich ein Ende findet.«
»Dann beende es, in dem du deinen geflügelten Hintern zu ihnen bewegst und sie alle erledigst.«
In Athans Pupillen wirbelte es wild. »Ich sage nicht, dass ich das nicht irgendwann tun werde, wenn es notwendig ist. Doch noch versuche ich, das hier auf kluge Weise zu spielen. Aber dafür musst du es ebenso machen.«
Ich drehte mich weg von ihm, und im nächsten Moment betrat Zeb den Raum, zusammen mit Dru, dem Security-Chef des Bite. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, überraschte es mich von Neuem, wie groß er war. Nur Athan war – seit es Tendra gab – größer als Dru.
»Muss ich euch beide trennen?«, fragte Zeb grinsend. Dru stand an der Tür, die Hände vor der Brust verschränkt.
»Fick dich, Zeb«, sagte ich zu ihm.
Mit einem Ruck drehte Zeb den Kopf zu mir, und sein Gesicht verfinsterte sich. »Ich sehe, dass Athan unsere Besorgnis zum Ausdruck gebracht hat.«
»Ich mache meinen Job.«
»Ja, und du bist dabei so voller Zorn, dass es verdammt noch mal ein Wunder ist, dass du überhaupt etwas auf die Reihe bekommst.«
»Ich bin es verdammt noch mal leid, dass man mir sagen will, wie ich mich fühlen soll wegen dem, was mein Vater mir angetan hat. Ja, ich bin zornig. Ich habe ein Recht darauf.« Zebs Augen wurden ein kleines bisschen weicher, als Mitleid über sein Gesicht huschte, und das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich verloren hatte. »Sie wird in ein paar Stunden aufwachen. Ich muss gehen.«
»Idris!«, rief Athan, Dru verstellte mir mit seinem Körper den Ausgang und sah mich mit teilnahmslosen, dunklen Augen an. Verflucht noch mal. Dieser Kerl war wie eine Wand.
Ich drehte mich zu meinem Bruder. »Musst du deine Muskeln spielen lassen? Ich kenne Dru schon verdammt lange. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich nicht außer Gefecht setzen wird.«
»Ich habe ein berechtigtes Interesse an der Zukunft der Menschheit«, sagte Dru, und seine tiefe Stimme grollte.
Verdammt. Das hatte ich vergessen. Er hatte sich mit einer Menschenfrau eingelassen, die er im Klub getroffen hatte. Es ging das Gerücht um, dass es ihn ganz schön erwischt hatte. Also, ja, sein Interesse war berechtigt.
Seufzend drehte ich mich zu Athan. »Was?«
»Du wartest auf mein Wort. Sobald du es hast, kannst du sie dir schnappen.«
»Worauf warten wir?«
»Irgendwas tut sich bei den Valarians«, meldete sich Zeb zu Wort. »Die Quellen machen mobil, und wir sind uns nicht sicher, warum.«
Das weckte meine Neugier. Die Quellen waren ein alter Vampirclan, für den nur Geld und Blut zählten. Die Valarians bezahlten sie oft dafür, dass sie die Drecksarbeit für sie erledigten. Zuletzt waren sie beauftragt worden, Tendra zu töten. Sie waren hervorragende Killer, doch glücklicherweise war Athan ein noch besserer Bodyguard, was der Grund dafür war, dass Tendra nun in seinem Bett lag. »Sonst noch was?«
»Ein Informant behauptet, dass es Unruhe in den Reihen der Valarians gibt«, fügte Zeb hinzu.
Auch das war interessant.
»Also werden wir einen Scheißdreck tun, bevor wir nicht sicher sein können, was für Folgen unser Handeln haben wird«, sagte Athan. »Es sieht aber tatsächlich so aus, als ob der König der Valarians seine Hybrid-Tochter überaus schätzt.«
Ich nickte knapp. Es machte immer noch keinen Sinn, warum wir sie uns nicht holten. Zeb hatte gemeint, dass niemand mit Sicherheit sagen konnte, ob sie über ihre Abstammung Bescheid wusste. Aber wie sollte es anders sein? Sie war verdammt noch mal ein halber Vampir.
»Erinnerst du dich?« Athans Blick suchte meinen. »Unser Interesse an ihr besteht darin, ihren Vater zu einer Zusammenkunft zu zwingen. Sie ist ein Pfand, das ist alles.«
Celia Valerie, halb Mensch, halb Vampirtochter des Valarian-Königs. Eine Krankenschwester im Krankenhaus von Mission. Ein Meter sechzig groß. Hübsch, mit mahagonifarbenem Haar. Schokoladenaugen. Schüchtern. Mit einem Apartment, das sie in Weiß- und Cremetönen eingerichtet hatte. Sie mochte die donutförmigen Frühstückszerealien in Regenbogenfarben, und sie fütterte eine streunende Katze, die sich bei ihrem Apartmentkomplex herumtrieb. Sie mochte es auch zu kochen, ließ jedoch regelmäßig etwas anbrennen, was sie »gegrillten Käse« nannte. Obwohl ich kein menschliches Essen zu mir nahm, kannte ich den Geruch von Verbranntem. Natürlich kannte ich ihn, zum Teufel.
Für die anderen war sie ein Pfand, doch für mich war sie seit zwei Wochen mein Leben. Ich beobachtete jeden ihrer Schritte, während sie keine Ahnung hatte, dass ich im Begriff war, ihre Existenz im großen Stil auf den Kopf zu stellen. Doch es ging nicht anders. Die anderen brauchten sie, um ihren Vater in seine Schranken zu weisen, und sie hatte feindliches Blut in ihren Adern.
Ich hatte nicht vorgehabt, sie als Druckmittel zu benutzen, um ihren Vater zu treffen. Athan ahnte auch nicht, dass bei diesem Treffen nicht gesprochen werden würde. Athan konnte über Verhandlungen schwafeln, bis er schwarz wurde, denn ich wusste, dass es diese nicht geben würde. Ich wollte Rache. Es war mir egal, ob ich mich dafür opfern musste; das war es mir wert. Ich wollte sehen, wie der Kopf des Valariankönigs rollte, und wenn es das Letzte in meinem Leben war.
Ich würde derjenige sein, der es tun würde.
Dennoch sah ich meinem Bruder in die Augen. »Ja, so sei es, mein König.«
Athan zuckte kurz, als er den Titel aus meinem Mund hörte, dann nickte er. Sein Blick schoss zu Dru, der sich von der Tür wegbewegte. Dann drehte ich den Türknopf und ging mit großen Schritten hinaus. Ich musste einen Menschen im Auge behalten.
Kapitel 1
Celia
Manchmal hatte ich keine einzige Pause während meiner Schicht in der Notaufnahme des Krankenhauses von Mission. In den bitterkalten Wintermonaten wütete die Grippe wie ein Tornado in Mission City, und es konnte jeden erwischen. Egal, wie viele Impfstellen wir öffneten, es waren einfach nicht genug Einwohner, die das Geld oder die Zeit hatten, sich impfen zu lassen. Dieses Jahr jedoch spielte auch das keine Rolle.
Der Impfstoff war für den falschen Erreger.
Mission war krank bis in den hintersten Winkel.
Ich war für die Aufnahmen verantwortlich und hatte damit begonnen, eine Chirurgenmaske zu tragen. Leider konnte ich nicht mehr tun, als die Gefahr einer Tröpfcheninfektion zu verringern und zu beten, dass ich nicht krank wurde. Ich konnte es mir nicht leisten, frei zu nehmen, denn schon jetzt hatte das Krankenhaus massive Probleme, mit dem Ausfall von krankem Personal klarzukommen, das wie Fliegen aus den Schuhen kippte.
Der Junge, der mit seinem Vater vor mir stand, war fünf und dünn. Sein zarter Körper wurde von Fieber geschüttelt, und er klapperte mit den Zähnen. Er sah mich nicht einmal an, blickte nur starr geradeaus, wie benommen, während sein Fünfundvierzig-Pfund-Körper gegen den Virus ankämpfte.
»Wie lange dauert es noch?«, fragte der Vater des Jungen, der, um ehrlich zu sein, auch nicht besonders gut aussah.
»Es tut mir leid, Sir.« Ich bemühte mich, deutlich zu sprechen, damit sie mich hinter meiner Maske verstehen konnten. »Die Ärzte arbeiten so schnell sie können. Möchten Sie etwas Wasser haben?«
Er schüttelte den Kopf und drückte die Schulter seines Sohnes. »Wir haben welches dabei, danke.« Sein Blick wanderte durch die Notaufnahme, und seine Schultern sackten nach vorn, als er sah, wie voll sie war. »Komm, Kumpel. Wir müssen warten, bis wir an der Reihe sind.«
Gehorsam folgte der Junge seinem Vater, vermutlich zu krank, um mit ihm zu streiten. Ich wollte sehen, ob sie auch tatsächlich einen Sitzplatz fanden, doch ein anderer Patient trat vor und versperrte mir die Sicht. Er blutete. Ich senkte den Kopf und machte mich an die Arbeit.
Eine Stunde später legte sich eine Hand auf meine Schulter, als ich gerade damit fertig war, ein Aufnahmeformular für eine Frau mit Unterleibsschmerzen auszufüllen. Ich blickte auf und sah meinen Kollegen Landon. Er lächelte mich an, und ich zog die Maske nach unten, um das Lächeln zu erwidern. »Hey.«
»Feierabend, Celia«, sagte er. »Zeit, nach Hause zu gehen, dir die Viren abzuspülen und dich auszuruhen.«
Schnell stand ich auf, und im nächsten Moment haute mich der Schwindel fast von den Füßen. Ich hielt mich am Schreibtisch fest, während mich Landon am Arm packte, damit ich nicht umfiel. »Hey, bist du okay? Wann hast du zuletzt etwas gegessen?«
»Gegessen?«, murmelte ich. »Ich hatte Mitta…« Ich hielt inne. Nein, ich hatte kein Mittagessen gehabt. Tatsächlich hatte ich seit dem Frühstück nichts mehr gegessen, und das war … Ich blickte zur Uhr. Neun Stunden her. »Mist«, flüsterte ich.
Landon ließ meinen Arm nicht los, als er über seine Schulter rief: »Pete, übernimmst du hier mal kurz? Ich bringe Celia ins Café.«
»Nein, ich bin in Ordnung«, protestierte ich schwach. Ich war wirklich nicht okay. Mein Blutzucker fiel, und ich fühlte mich wie eine Idiotin.
Wir bewegten uns vorwärts, während Landon meine Tasche in seiner großen Hand hielt und mich mit der anderen immer noch stützte. »Ist kein Problem. Ich habe noch ein paar Minuten, bis meine Schicht beginnt. Ich will sicher sein, dass du heil im Café ankommst.«
Ich wusste, dass ich seine Freundlichkeit einfach annehmen sollte. Doch jeder hatte Hintergedanken. Niemand kümmerte sich einfach so um mein Wohlbefinden – ich hatte schon früh gelernt, dass ich die einzige Person war, der ich vertrauen konnte.
Dr. Yamael hatte mir mal zugeflüstert, dass sie glaubte, Landon wäre in mich verliebt, und dass er mit anderen darüber gesprochen hätte, dass er mit mir ausgehen wollte. Da ich in meinem ganzen Leben vermutlich weniger als fünfzig Wörter mit ihm gewechselt hatte, konnte es ganz sicher nicht daran liegen, dass er meinem unglaublichen Charme und Witz erlegen war. Er wollte Sex haben, und bestimmt hatte die einsame Celia es dringend nötig.
Ich unterdrückte ein Grollen. Warum war ich nur so? Warum unterstellte ich jedem das Schlimmste? Ich kannte die Antwort. Ich wünschte mir einfach, dass ich manchmal jemand anders sein könnte.
Ich warf einen verstohlenen Blick auf Landon. Er sah gut aus, und sein Hintern passte perfekt in seine OP-Klamotten. Er war rund dreißig Zentimeter größer als ich. Alles an ihm schrie nett.
Aber die Menschen sagten, dass auch Charles Manson und Ted Bundy charmant gewesen wären.
Verstanden? Das war so typisch für mich. Das war der Grund, aus dem ich kein Partyknaller war.
»Ich habe gehört, in deiner Schicht ging es heute verrückt zu«, sagte Landon.
Na großartig. Small Talk während mein Blutzuckerspiegel Koma-Niveau erreichte. Das wurde ja immer besser. »Ja.«
»Hast du schon Pläne für den Feierabend?«
Pläne? Was war das für ein Wort? »Ich arbeite an dieser Kreuzsticharbeit für meine Küche. Darauf ist ein Messer mit den Worten Chop it like it’s hot zu sehen.«
Ja, das sagte ich tatsächlich. Laut.
Landon blinzelte mich geschlagene zehn Sekunden lang an, bevor er seinen Mund mit den perfekten weißen Zähnen öffnete und lachte. »Ich wusste gar nicht, dass du so witzig bist.«
Er ging weiter und schüttelte leise glucksend den Kopf. Es traf mich, dass er dachte, ich würde scherzen. Ich scherzte nicht. Ich war gerade bei chop, was ich allerdings noch einmal überarbeiten musste, weil ich mich beim »p« vertan hatte. Das war mein Leben. Das waren meine Pläne. Ich wusste nicht, was mit ihm verkehrt war, dass er nicht sehen konnte, was alle anderen sahen. Ich hatte eine unheimliche Fertigkeit darin entwickelt, mich im Hintergrund zu halten. Ich war wie die ständige Wiederholung eines Films, und ich mochte es so.
Wir betraten das Café, und Landon steuerte direkt auf die Cheeseburger zu. Mir war nicht klar gewesen, wie hungrig ich war – es war, als wäre mein Magen bereits jenseits von hungrig und hätte mich bereits aufgegeben. Doch nun, da ich umgeben von lecker duftendem Essen war, erwachte mein Magen wieder zum Leben und drückte mir sein Besteck in die Rippen.
Das Essen in der Krankenhauskantine hatte einen schlechten Ruf, doch ich war nicht mit selbst gekochtem Essen groß geworden, sodass es besser war als das, was ich gewöhnt war. Ich mochte mein eigenes Essen lieber, doch das Café war auch nicht schlecht.
Landon schnappte sich ein Tablett. »Worauf hast du Hunger?«
»Cheeseburger mit Pommes und Pickles. Einen Cookie mit Schokoladenstückchen.« In diesen Cookies steckte Magie.
Er packte alles zusammen und bezahlte dann sogar mit seiner Karte. Ich stritt mich nicht mit ihm darüber. Wenn er mit einem Acht-Dollar-Cafeteria-Essen um mich werben wollte, nur zu.
Er nippte an einem heißen Kaffee und sah mir beim Essen zu. Wahrscheinlich wurde Small Talk von mir erwartet, doch außer ihm für das Essen zu danken, sagte ich nicht viel. Mein Mund war voll. Das war meine Entschuldigung.
»Übrigens … geht es dir gut?«, fragte Landon, während er mit den Fingern leicht auf das Linoleum der Tischplatte klopfte.
»Wie meinst du das?« Ich leckte einen Tropfen Pickle-Soße auf, der mir über den Daumen lief.
Landons Blick folgte meiner Zunge. »Hm, ich weiß nicht. Du wirkst nur müde in letzter Zeit.«
Ich wollte ihn fragen, warum er mich so genau beobachtete. Dann zuckte ich mit den Schultern. »Ich habe nicht besonders gut geschlafen.«
»Oh?«
»Ja, es ist nur …« Ich schaufelte einige Pommes in meinen Mund, um nicht weiterreden zu müssen. Wie sollte ich ihm erzählen, dass ich in letzter Zeit Träume hatte, die das pure Grauen waren? Träume, in denen ich durch einen Wald lief, in dem Blut von den Bäumen tropfte? Dass ich mit einem Eisengeschmack im Mund aufwachte und mir den Hals festhielt? Ich hatte im Netz gesucht, was das bedeuten konnte, doch ich fand lediglich heraus, dass ich vermutlich auch im wirklichen Leben die Auseinandersetzung mit irgendeiner Sache vermied, wenn ich in meinem Traum vor etwas flüchtete. Aber mir fiel nichts ein, das ich in einem Maße verdrängte, dass es mich unterbewusst an blutenden Bäumen vorbeihetzen ließ.
Landon wartete noch darauf, dass ich meinen Satz beendete. Ich schluckte die Pommes hinunter. »Nur schlechte Träume, nehme ich an. Mir geht es gut.« Ich hatte mir vor Kurzem alle möglichen Teesorten bestellt, die mir beim Einschlafen helfen sollten, genauso wie ich ein Vermögen für ätherische Öle ausgegeben hatte, die mein Nachbar verkaufte. Falls das alles nicht half, würde ich es mit Betäubungsmitteln versuchen. Kleiner Scherz. Vielleicht.
»Ich mache eine ziemlich gute Lasagne. Ich könnte dir was kochen, dazu etwas Wein. Ich wette, danach wirst du großartig schlafen können.« Er zwinkerte mir zu.
Das war es. So also schlug er die Brücke von meinen Albträumen zu seinem Wunsch nach einem Date. Indem er anbot, mich mit Pasta und fermentierten Weintrauben zum Einschlafen zu bringen – das ganze garniert mit einem schmierigen Zwinkern. Arrrrgh.
Ich schob den leeren Teller von mir, leicht abgestoßen davon, wie schnell ich gegessen hatte. »Danke für das Angebot, Landon, aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn sich Kollegen daten.«
»Daten? Es ist nur eine Lasagne.«
Ich warf ihm einen Blick zu.
Er zuckte mit den Schultern. »Du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich es versucht habe.«
»Vermutlich nicht.« Erschöpfung machte sich in mir breit bis tief in die Knochen. Ich musste es nach Hause schaffen, bevor ich in meinem Jeep einschlief. Ich gähnte. »Ich gehe jetzt besser. Danke noch mal, dass du dafür gesorgt hast, dass ich was zu essen bekommen habe. Das war nett von dir.«
»Sicher doch«, erwiderte Landon mit einem weniger enthusiastischen Lächeln. »Hoffe, du kannst heute Nacht gut schlafen.«
Ja, das hoffte ich auch.
Im Pausenraum schlurfte ich gähnend zu meinem Spind und war leicht besorgt darüber, dass ich noch nach Hause fahren musste. Ich drehte das Schloss in meine Zahlenkombination, holte meine Tasche heraus und schnappte mir ein Wasser aus dem Kühlschrank. Ich setzte mich an den Pausentisch und blickte auf eine Schachtel mit Brownies, die irgendwer gekauft hatte. Während ich die Wasserflasche an meine erhitzte Stirn hielt, beschloss ich, dass es doch eine schlechte Idee gewesen war, mich hinzusetzen. Eine sehr schlechte. Nun würde ich mich wieder aufrappeln müssen. Doch wie sollte mir das gelingen, wenn meine Glieder gegen jede Form von Bewegung protestierten?
Die Tür öffnete sich, und Monica kam herein. »Hey«, sagte sie. »Dachte ich mir doch, dass ich dich hier reingehen sah. Bist du fertig?«
Ich nickte. »Ja, meine Schicht ist vorbei, und ich habe den Fehler gemacht, mich hinzusetzen. Jetzt könnte ich auch gleich hier schlafen.« Das war schon komisch, denn Schlaf war nichts, mit dem ich mich in letzter Zeit leichtgetan hatte.
Besorgt senkte Monica die dunklen Brauen und setzte sich dann neben mich. Zugegebenermaßen stand ich nicht vielen Menschen nahe – es war mir immer schwergefallen, Freundschaften zu schließen; gleichzeitig war ich ziemlich gut darin, alle aufkeimenden Freundschaften zu sabotieren. Ich hatte mich daran gewöhnt, eine Einzelgängerin zu sein. Meine Arbeit mit den Patienten erfüllte mich, machte mich glücklich und bot genügend zwischenmenschlichen Austausch, um gesund zu bleiben.
Doch Monica war anders. Sie hatte nicht zugelassen, dass ich mich zurückzog oder verkroch. Sie hatte mich zu ihrer Freundin erklärt, und ich hatte festgestellt, dass ich es mochte, Monicas Freundin zu sein. Sie arbeitete als Krankenschwester auf der Entbindungsstation, und ihr Mann war einer der Hausmeister im Krankenhaus. Sie hatten einen Sohn, einen kleinen Jungen namens Charlie, den ich liebte, liebte, liebte. Ich liebte ihn mehr als mich selbst, weshalb ich mir wünschte, ich könnte ihm den Krebs ab- und auf mich nehmen, der in seinem Körper wütete, damit er glücklich und ohne Schmerzen leben könnte.
Ich fühlte mich elend, als ich Monicas Besorgnis sah. Sie hatte genug damit zu tun, sich um Charlie Gedanken zu machen.
»Ich mache mir Sorgen um dich …«, begann sie.
Ich fiel ihr ins Wort. »Mir geht’s gut.«
»Das sagst du immer.«
»Weil es stimmt. Du weißt, wie es in der Grippesaison ist. Es wird besser werden.«
Sie schürzte die Lippen und schüttelte ihre dunklen, lockigen Haare über die Schulter. Ihr Haar war unglaublich, und ich beneidete sie darum – voll und dick, ein Erbe ihrer dominikanischen Mutter. Amüsiert blickte sie mich an. »Ich habe dich mit Landon in der Cafeteria sitzen sehen.«
Ich stöhnte. »Spionierst du mir etwa nach?«
Sie grinste. »Vielleicht.«
»Du machst dir zu viele Sorgen um mich.«
»Ich sorge mich gerne um dich. Du tust so viel für Tim, Charlie und mich …« Ihre Stimme brach, sie blickte zur Seite und blinzelte schnell. Wieder fühlte ich mich wie ein Arschloch.
Ich streckte den Arm aus und drückte ihre Hand. »Hey, es gefällt mir, Dinge für dich zu tun, und es ist wirklich nicht viel.«
»Du besuchst ihn. Die meisten seiner Freunde sind ständig beschäftigt, aber du bist eine treue Seele.«
»Nun, ich glaube, eine Frau in den Zwanzigern ist ein mieser Ersatz für einen anderen Jungen in seinem Alter, doch wenn es ihm gefällt, werde ich ihn gerne weiter besuchen.«
Monica lachte. »Du weißt, dass er dich liebt.«
»Ich werde heute Abend bei ihm vorbeischauen«, sagte ich.
»Bist du sicher? Du bist so müde.«
»Ich bin sicher.«
»Tim ist zu Hause. Er kann dir die Tür öffnen.«
Ich zeigte auf die Brownies. »Hast du die gemacht?«
Sie schüttelte den Kopf. »Vivian.«
Ich zog die Nase kraus. Ich mochte Vivians Brownies nicht. Ich meine, Brownies waren Brownies. Ich hatte nicht gewusst, dass man Brownies vermasseln konnte, bis ich Vivian traf.
Monica lachte. »Ich werde nächste Woche welche backen.«
»Dann stehen die hier immer noch rum, weil niemand sie essen mag. Ich habe keine Ahnung, warum sie sie immer noch backt.«
»Weil Landon sagt, dass er sie mag, nur weil er nett sein will. Dann wirft er sie weg, damit sie denkt, die Leute würden sie essen.«
»Siehst du, genau deshalb kann ich mich nicht mit Landon treffen. Er sorgt für diese Brownie-Folter.«
»Du bist lächerlich.«
»Ich bin im Delirium«, murmelte ich.
»Dann hau jetzt ab, sieh kurz bei Charlie vorbei, geh nach Hause und ruh dich aus.«
Ich stand auf und warf mir die Tasche über die Schulter. »In Ordnung, Captain.« Ich machte einen Schritt auf die Tür zu. »Hab eine gute Nacht. Bring viele Babys auf die Welt.«
Monicas leises Lachen folgte mir zur Tür hinaus.
Ich ging aus dem Krankenhaus zum Angestelltenparkhaus. Es war dunkel, und ein wächserner Mond stand hoch am Himmel und umgab die Autos mit einem unheimlichen Licht.
Obwohl ich todmüde war, spürte ich auf meinem Weg an den Autos entlang bis zu meinem Parkplatz, dass irgendetwas seltsam war. Meine Kopfhaut prickelte, und mein Blut kochte. Es war etwas hier in dieser Garage zusammen mit mir. Ich ließ die Hand in meine Handtasche gleiten und schloss die Finger um mein Pfefferspray. Meine Nackenhaare stellten sich auf. Ich blickte hinter mich, ging schneller, sah jedoch niemanden.
Aus einer entfernten Ecke kam ein schlurfendes Geräusch, und ich wirbelte herum und blickte mit erhobenem Pfefferspray suchend in die Schatten. Doch ich sah niemanden, nichts, und ich würde mich auch ganz sicher nicht in die Dunkelheit wagen. Schnell zu deinem Wagen, Celia.
Irgendwo wurde eine Tür mit lautem Schwung geöffnet, und ich schrie auf.
Es war Landons Stimme, da war er auch schon und lief mit einem Handy in der Hand auf mich zu. Auf seinem Gesicht stand Besorgnis. »Tut mir leid, ich habe dich erschreckt. Alles okay?«
Das war es ganz und gar nicht, doch ich schob es auf meine Erschöpfung. Hier war nichts bei mir, nichts, was mir schaden wollte. Es waren nur meine Träume, die mich verfolgten, selbst wenn ich wach war.
Ich ließ mein Pfefferspray zurück in meine Handtasche fallen. »Mir geht es gut. Alles gut.«
Er hielt mein Handy in die Höhe. »Das hast du auf dem Schreibtisch liegen lassen.«
Ich nahm es ihm ab. »Oh, wow. Ich wäre verrückt geworden, wenn ich zu Hause gemerkt hätte, dass ich es hier vergessen habe. Danke, dass du es mir gebracht hast.«
Landon sah sich in der Parkgarage um und runzelte die Stirn. »Bist du sicher, dass du okay bist?«
»Ja, mein Auto ist«, ich zeigte auf das Ende der Reihe, »da hinten.«
Er nickte. »Ich begleite dich.«
»Das brauchst du nicht …«
»Ist doch keine große Sache. Es ist Mitternacht, und du bist müde. Also lass mich kurz mitkommen.«
Das war der Punkt, an dem ich immer störrisch wurde. Ich war seit so langer Zeit allein und verließ mich in allem auf mich selbst. Eltern? Was war das? Ich war in Pflegefamilien groß geworden. Und Pflegefamilien in Mission City waren ein Witz. Geschwister? Meine waren niemals mit mir verwandt gewesen und hatten mich nur mit Verachtung behandelt. Freunde? Jeder in Mission kümmerte sich nur um sich selbst. Wow, in mir war wirklich alles voller Hundebabys und Regenbögen.
Doch ich hatte Angst und war erschöpft, und es fühlte sich diesmal einfach angenehm an, jemanden etwas Nettes für mich tun zu lassen. Dennoch fiel es mir nicht leicht, Landons Angebot anzunehmen. »Ja, sicher. Nett von dir.«
Er schenkte mir ein kleines Lächeln, und dann brachte er mich zu meinem Wagen, wobei er mich leicht am Ellbogen berührte. Ich hoffte, Landon würde eine nette Frau finden, mit der er sich verabreden konnte. Mit mir bellte er definitiv den falschen Baum an.
Als wir meinen blauen Jeep erreichten, wartete er, bis ich eingestiegen war, und gab mir sogar ein Zeichen, dass ich abschließen sollte. Ich ließ das Fenster herunter. »Was ist mit dir?«
»Die Tür ist direkt da drüben«, sagte er grinsend. »Und ich mache Krav Maga. Ich kann mich selbst verteidigen.«
Ich wusste nicht, was Krav Maga war, doch es hörte sich Furcht einflößend an. »Okay, danke noch mal, Landon. Du bist ein echter Freund.«
Das schien ihm zu gefallen. Sein Lächeln wurde breiter. »Ich nehme an, Freunde zu sein ist nicht das Schlechteste.«
Ich lachte. »Du bist ein großer Junge. Du wirst damit klarkommen.«
Er klopfte auf das Dach meines Jeeps und trat einen Schritt zurück. »Nacht, Celia. Fahr vorsichtig.«
»Alles Gute für deine Schicht.«
Ich fuhr rückwärts aus meiner Parklücke und steuerte Richtung Ausgang. Gerade als ich um die letzte Ecke bog, leuchteten meine Scheinwerfer in die Schatten, und das Licht wurde von zwei kleinen Punkten zurückreflektiert. Augen.
Ich schnappte nach Luft und trat auf die Bremse, doch worauf auch immer das Licht gefallen war, es war verschwunden. »Es muss ein Marder sein, richtig? Eine Katze. Ein Hund.« Wie eine Geisteskranke sprach ich zu mir selbst.
Dann schoss ich mit quietschenden Reifen aus dem Parkhaus und raste nach Hause, als würde ich durch einen Wald mit blutenden Bäumen gejagt.
In jeder Straßenlaterne sah ich diese reflektierenden Augen, die mich anblickten.
Idris
Roxy blinzelte mich an, dann sah sie zu Dru und verdrehte die Augen, und ihr Blick sah auf eine Ist das zu fassen?-Weise so menschlich aus, dass ich fast lächeln musste.
Sie drehte sich zu mir um, die Augen noch immer leicht geweitet. »Sie sollten euch Kerlen wirklich mal Unterricht ins Sachen Menschen geben oder irgend so etwas.«
Ich sagte nichts. Roxys Apartment in Mission sah ähnlich aus wie Celias. Laut ihrem Freund Dru war sie vor Kurzem umgezogen, und der Ort, an dem sie nun zusammen mit ihrem Bruder lebte, war größer, schöner. Ich wusste, dass Dru sie finanziell unterstützte, und ich wusste auch, dass er so gut wie alles für sie tun würde. Ich war überrascht, dass er mich mit ihr sprechen ließ, und mir war ebenfalls bewusst, wie wichtig meine Mission für unseren Clan war.
»Also lass es mich auf den Punkt bringen«, sagte sie. »Du hast gesehen, wie sie eine Heizdecke auf ihren Bauch gelegt hat, und nun willst du wissen, warum.«
Nannte man diese Teile so? »Es war ein Stück Stoff mit einem Kabel …«
Roxy winkte ab. »Ja, ja, ich sagte dir doch, das ist eine Heizdecke.«
Weil sie zu Dru gehörte, ließ ich es ihr durchgehen, dass sie mich unterbrach. »Was ist der Zweck einer Heizdecke?«
Wieder starrte sie mich an. Dann blickte sie zu Dru, doch offensichtlich hatte er nicht die Absicht, ihr zu Hilfe zu kommen, denn seine Lippen waren fest verschlossen.
Roxy seufzte tief und legte ihre Handflächen auf den Tisch. »Vermutlich hatte sie Krämpfe.«
»Krämpfe?«
»Ja, Bauchschmerzen.«
Ich richtete mich auf dem Stuhl auf, mit dem ich am Küchentisch saß. »Schmerzen?«
Roxys Gesichtszüge wurden weich. »Das ist in Ordnung. Es ist so ein Menschen-Ding. Nun ja … Menschenfrauen-Ding …« Sie suchte nach Worten und neigte dann den Kopf zur Seite. »Hast du wirklich keine Ahnung, wovon ich spreche?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Okay«, sagte sie langsam. »Einmal im Monat, falls kein Baby im Uterus der Frau ist …« Ihre Wangen erröteten leicht, als sie murmelte: »Ich kann nicht glauben, dass ich hier einem Vampir Fünfte-Klasse-Sexualkundeunterricht gebe.« Dann räusperte sie sich. »Sie blutet dann …«
»Menstruation«, sagte ich ungeduldig. »Natürlich weiß ich, was das ist.«
Sie warf die Hände in die Luft. »Und warum dann diese Krämpfe-Frage?«
»Ich habe nicht gewusst, dass es wehtut«, schnappte ich zurück.
Sie zuckte zusammen, dann verengten sich ihre Augen zu Schlitzen. Es gefiel mir nicht, wie sie mich musterte, dennoch wich ich ihrem Blick nicht aus.
»Manchmal«, sagte Roxy. »Es kann wehtun. Wir bekommen Krämpfe. Wir haben Kopfschmerzen. Wir werden launisch und gereizt. Du kannst Dru fragen. Mein PMS kann mich ganz schön aggressiv machen.«
Dru zuckte nur mit den Schultern.
Ich machte mir nicht einmal die Mühe, sie zu fragen, was PMS war.
»Also, ja«, fuhr sie fort. »Ein Wärmekissen kann bei Krämpfen helfen. Lag sie auf ihrem Sofa? Im Bett?«
»Sofa«, sagte ich. Sie hatte eine Decke über sich gebreitet, und sie hatte einen Becher mit Wasser und einem kleinen Beutelchen darin in der Hand gehalten, wie sie es abends mochte. Das war vor einer Woche gewesen.
Roxy nickte. »Ja, dann hatte sie Krämpfe. Es war eine Heizdecke. Das ist alles.«
»Sie ist also nicht krank.«
»Nun, nein. Nein, sie ist nicht krank. Also, ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass es nur Krämpfe gewesen sind, denn dann benutzen Frauen normalerweise Heizkissen.«
Ich nickte und erhob mich. Roxy öffnete den Mund, und ich wusste, dass eine Frage folgen würde. Ich hatte ihr bislang nur gesagt, dass ich eine Frage über eine Menschenfrau hatte.
»Roxy«, sagte Dru, und in seinem Tonfall schwang eine sanfte Warnung mit.
Sie schloss den Mund mit einem hörbaren Klacken. Sie wusste, dass wir Menschen nichts zuleide taten, doch ich vermutete, dass sie mich zu gerne gefragt hätte, ob ich dieser Frau Schaden zufügen wollte. Roxys Augen blickten finster, und sie biss sich auf die Lippe, als sie mir zur Tür folgte.
»Falls du noch etwas wissen willst, nur zu«, sagte sie. »Ich freue mich immer, wenn ich einer anderen Frau helfen kann.«
Das war es. Das war ihre kleine Warnung an mich. Ich hatte sie gehört, und Dru hatte sie gehört. Er spannte den Rücken leicht an, und ich wusste, dass er es tat, um sicherzustellen, dass ich nicht mit einer Dummheit auf ihre Bemerkung reagierte. Auch wenn ich nicht der König war, so war ich doch ein Mitglied der Herrscherfamilie. Dru arbeitete für mich.
Trotzdem sagte ich nicht mehr als: »Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Roxy.«
Sie nickte. Dann ging ich durch die Tür, die Stufen ihres Apartments hinunter und in die mondhelle Nacht von Mission hinaus.
Bald würde Celia von der Arbeit nach Hause kommen. Sie würde da sein, wenn ich dort eintraf, und so ging ich in Richtung ihres Apartments. Es war drei Wochen her, seit ich begonnen hatte, sie zu beobachten. Eine Woche seit jener Nacht im Bite, als mein Bruder meine Motive infrage gestellt hatte.