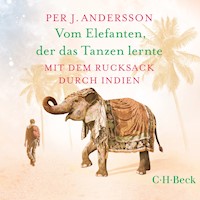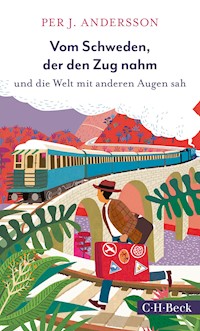12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn das Leben immer stressiger und komplizierter wird und sich die Weltlage düster aufs Gemüt legt, dann träumen wir uns in die Ferne. An einen Ort, wo es friedlich und ruhig ist, einfach und harmonisch. Wo die Sonne im Meer versinkt und die Sorgen mitnimmt. Natürlich gibt es diesen Ort nicht. Wir wissen das. Aber wenn es ihn doch geben würde, läge er mit Sicherheit auf einer Insel. Der Reiseschriftsteller und Bestsellerautor Per J. Andersson liebt Inseln. Sie sind für ihn Rückzugsort und Inspiration. In diesem Buch schreibt er über die jahrhundertealte Sehnsucht nach dem Glück jenseits des Festlands und nimmt uns mit auf eine Reise zu seinen zehn Lieblingsinseln – Bali, Usedom, Sri Lanka, El Hierro und andere fantastische Orte. Die Reise darf gerne lang und aufregend sein und die Überfahrt rauh. Doch einmal an Land sucht er Ruhe und Einfachheit, genießt Sand, Salz und endlosen Horizont. Er trifft auf eigentümliche Inselbewohner, schräge Vögel, unglaubliche Geschichten und atemberaubende Landschaften. Es ist sein Traum von der Insel: Das Gefühl, an einem Ort zu sein, wo das Leben leicht, langsam und weniger komplex ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
PER J. ANDERSSON
Vom Schweden, der ein Schiff bestieg und auf den Inseln sein Glück fand
Aus dem Schwedischenvon Angela Beuerle
C.H.BECK
Zum Buch
Reif für die Insel? Bestsellerautor Per J. Andersson reist zu seinen Sehnsuchtsorten
Wenn das Leben immer stressiger und komplizierter wird und sich die Weltlage düster aufs Gemüt legt, dann träumen wir uns in die Ferne. An einen Ort, wo es friedlich und ruhig ist, einfach und harmonisch. Wo die Sonne im Meer versinkt und die Sorgen mitnimmt. Natürlich gibt es diesen Ort nicht. Wir wissen das. Aber wenn es ihn doch geben würde, läge er mit Sicherheit auf einer Insel. Der Reiseschriftsteller und Bestsellerautor Per J. Andersson liebt Inseln. Sie sind für ihn Rückzugsort und Inspiration. In diesem Buch schreibt er über die jahrhundertealte Sehnsucht nach dem Glück jenseits des Festlands und nimmt uns mit auf eine Reise zu seinen zehn Lieblingsinseln – Bali, Usedom, Sri Lanka, El Hierro und andere fantastische Orte. Die Reise darf gerne lang und aufregend sein und die Überfahrt rauh. Doch einmal an Land, sucht er Ruhe und Einfachheit, genießt Sand, Salz und endlosen Horizont. Er trifft auf eigentümliche Inselbewohner, schräge Vögel, unglaubliche Geschichten und atemberaubende Land- schaften. Es ist sein Traum von der Insel: Das Gefühl, an einem Ort zu sein, wo das Leben leicht, langsam und übersichtlich ist.
Über den Autor
PER J. ANDERSSON ist ein schwedischer Reisejournalist und Schriftsteller. 2015 erschien sein Bestseller «Vom Inder, der mit dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden». Sein bei C.H.Beck erschienenes Buch «Vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte» war ein halbes Jahr unter den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Bei C.H.Beck ist zuletzt von ihm erschienen: «Vom Schweden, der den Zug nahm und die Welt mit anderen Augen sah» (22020).
Inhalt
Ja, ich bin nesophil!
Der Traum von der Insel
El Hierro – Das Ende der Welt
North Sentinel Island – Bitte nicht hierher reisen!
Bali – Nach dem Sündenfall
Gotland – Scholle und Familie
Denis Island – Auf Schatzsuche im Indischen Ozean
Sri Lanka – Keine ruhige Minute
Usedom – Geteilte Insel wurde wieder ganz
Norrbyskär – Utopie im Bottnischen Meerbusen
Muravandhoo – Luxusleben auf dem bedrohten Archipel
Amorgos – Nach Hause kommen
Heimkehr
Was ist eine Insel?
Die 20 inselreichsten Länder
Die 20 größten Inseln der Welt
Die 20 größten Inseln Deutschlands
Die 20 Inseln mit der größten Bevölkerung
Die 20 dichtbevölkertsten Inseln
Inselbücher, die nicht ungelesen bleiben sollten
Dank
Quellennachweis
«Die Insel-Besessenheit ist ein wesentlicher Bestandteil der westlichen Kultur, ein zentraler Punkt und eine treibende Kraft aus vorgeschichtlicher Zeit bis in unsere Zeit hinein.»
John R. Gillis
«Seit zwei Tagen ohne Schnupftabak, verschmachten wir auf dieser Insel.»
Pippi Langstrumpf
Ja, ich bin nesophil!
Drei mal fünf Kilometer. Größer ist die Insel nicht. Dennoch gibt es hier einen Lebensmittelladen, eine Grundschule, Breitbandzugang und eine Kapelle samt Friedhof. Während der hellen Monate des Jahres, wenn die zweihundert Anwohner Gesellschaft von viertausend Feriengästen bekommen, öffnen auch ein Restaurant, eine Bäckerei und ein Kino. Sehr viel mehr braucht man nicht. Das finden zumindest wir Feriengäste. Was die ganzjährigen Bewohner von dem ausgesuchten Service-Angebot halten, ist eine andere Geschichte.
Die Knappheit verstärkt mein Gefühl, mich am Rande von etwas aufzuhalten, an einem Ort abseits des Zentrums, an den die Neuigkeiten aus der großen Welt erst mit gewisser Verspätung gelangen. Es sind nicht die Wälder, Schafweiden, Granitfelsen oder die im Meer versinkende Sonne, die den inneren Kern meiner Begeisterung ausmachen. Auch nicht die Geröllstrände, die silberblitzenden kleinen Seen, die Apollofalter oder all die verschiedenen Orchideenarten, die hier wachsen. Das magische Gefühl, sich jenseits von Zeit und Raum zu befinden, entsteht durch etwas anderes: den Schotterweg, der sich von Söderby über Svängen weiter nach Styrsvik und bis hin nach Stenbro schlängelt. Und das Seltsame dabei ist nicht, was passiert, sondern, was nicht passiert. Meist ist die Straße menschenleer, obwohl es die Hauptstraße der Insel ist. Vom Festland her bin ich stark frequentierte, asphaltierte und gerade Straßen gewöhnt. Hier sehe ich kaum mehr als ein paar Autos pro Tag. Aber umso mehr Fußgänger, Fahrradfahrer und das eine oder andere Lastenmoped. In den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass die Mopeds allmählich durch Quads ersetzt werden. Ich mag sie nicht, weil sie modern sind. Ich mag Lastenmopeds, weil sie das Gefühl einer vergangenen Epoche aufkommen lassen. Quads gehören in die Gegenwart, und die ist auf dem Festland zu Hause.
Jedes Mal, wenn ich rittlings auf einem der alten Armee-Fahrräder ohne Gangschaltung sitze, über die man als Mitglied des Schriftstellerverbands in den Häuschen auf Runmarö frei verfügen darf, bekomme ich beste Laune. Weil ich nämlich, unterwegs auf dem Schotterweg zum Lebensmittelladen durch den Wald, quer über die Kleewiese und an der ochsenblutroten Schule vorbei, statt Motorengeräuschen nur das Rauschen des Windes und Rascheln der Blätter höre.
Früher war die Atmosphäre auf dem Festland ebenso ruhig und friedvoll und die Straßen so gewunden und mit Schotter bedeckt. Auf der Insel entspricht die Anzahl der Autos pro Kopf ungefähr der auf den Festlandstraßen vor siebzig Jahren, und so werde ich an einen verlorenen Zustand erinnert. Dabei spielt es keine Rolle, dass ich zu jung bin, um selbst die Zeit erlebt zu haben, in der sich die Straßen auf dem Festland zwischen Wäldchen und Kuhweiden entlang schlängelten und die Verkehrsteilnehmer so wenige waren, dass sie sich grüßten, wenn sie einander begegneten. An den Zustand erinnere ich mich nicht, aber die Sehnsucht danach habe ich geerbt.
Nicht zu grüßen, wenn man jemandem auf der Hauptstraße der Insel begegnet, wäre grob unhöflich, geradezu suspekt. Wer kann das sein, der da offenbar anonym bleiben will? Hat sicher Dreck am Stecken. Während ich den Schotterweg entlang radele und immer wieder die Hand zum Gruß hebe, denke ich daran, wie erkannt zu werden etwas ist, worum ich auf dem Festland immer gekämpft habe. Wiederholte Male habe ich zu Hause versucht, vom Personal im Lebensmittelladen und in den Cafés als Stammgast begrüßt zu werden. Hin und wieder hat das für einen kurzen Zeitraum funktioniert, aber dann wechselte das Personal, oder der Laden schloss, oder ich wurde ungeduldig und bin in einen anderen Laden oder ein anderes Café gegangen oder in eine andere Stadt gezogen, und da musste ich wieder von vorne beginnen. Hier ist alles viel übersichtlicher und von einer größeren Kontinuität geprägt, wodurch das Zugehörigkeitsgefühl unmittelbar gegeben ist. Das gegenseitige Grüßen erscheint mir als triumphale Wiedergutmachung nach meinen Misserfolgen auf dem Festland.
Auf der Insel sitze ich im roten Häuschen vor meinem Computer und schreibe an dem Buch über Inseln. Nicht genug damit, dass ich mich auf einer Insel aufhalte und von anderen Inseln träume – ich befinde mich darüber hinaus im größten zusammenhängenden Inselreich der Welt. Vierundsiebzigtausend Inseln, Felseneilande und Schären schauen aus dem Schärengarten-Meer zwischen Stockholm und Åbo heraus (wovon vierundzwanzigtausend davon zu Schweden gehören und der Rest zu Finnland). Nirgendwo anders auf der Welt werden Meer und Horizont so häufig und so dicht gefolgt von kleinen Landstücken unterbrochen. Alle anderen Archipele bleiben weit dahinter zurück. Die Inselnation Indonesien hat nur achtzehntausend Inseln, die Karibik siebentausend, Griechenland gut dreitausend.
Runmarö gehört zu Schwedens Randbereich. Trotz der Nähe zur Hauptstadt ist Stockholms Schärengarten dünn besiedelt, mit historisch gesehen schwindender Bevölkerung, miserablen Kommunikationsmöglichkeiten und zunehmend ausgedünnter staatlicher Infrastruktur. Das Gefühl, außen vor zu sein, ist stark.
Vor noch gar nicht so langer Zeit konnte man sich im inselreichsten Schärengarten mit Infrastrukturvorteilen brüsten. Die Meere waren die Hauptverkehrswege der Welt, während das Innere der Kontinente Randbezirk und Wildnis war. Bereits während der Antike waren die Küsten und Inseln das Zentrum der Welt, empires of access. So war es in Griechenland und Rom, bei der mittelalterlichen Hanse und bei den europäischen Seefahrernationen mit ihren Kolonialreichen. Auf dem Mittelmeer, dem Atlantik, dem Indischen Ozean und der Ostsee wurde Handel getrieben und politische Macht ausgeübt, und Städte, von denen man etwas erwarten konnte, lagen immer am Wasser. Am besten auf einer Insel.
In der Dämmerung höre ich auf zu schreiben, sitze still für mich da und betrachte die gigantischen Estlandfähren, die draußen auf dem Kanholmsfjärden vorbeigleiten. Sie leuchten, blinken und glitzern vor Licht und erinnern mich an die Geschichte der Inseln als infrastrukturelle Hotspots. Vor zweihundert Jahren allerdings geschah etwas, das den Inseln gegenüber der Festland-Konkurrenz ihren infrastrukturellen Vorteil nahm: Die ersten Eisenbahnlinien wurden gebaut. Nun setzte eine Veränderung ein, die Zentrum und Peripherie die Plätze tauschen ließ. Das Festland (zumindest die Gegenden, in denen Eisenbahnlinien entstanden) übernahm die Rolle, die zuvor die Inseln gehabt hatten. Welche stattdessen zum Gegenstand von Träumen über das verlorene Paradies wurden. Ideen und Vorstellungen aus Mythen und Sagen der Antike erhielten in Verbindung mit den Entdeckungen von Inseln in der Karibik und im Pazifischen Ozean durch die Weltumsegler neue Kraft.
Als die Industrialisierung Fahrt aufnahm und sich der europäische Himmel vom Kohlenrauch aus Dampflokomotiven und Fabrikschloten verdunkelte, wurde die Insel einmal mehr zum Gegenstand von Sehnsüchten nach einem Naturzustand. Das Leben auf der Insel wurde zur Antithese zum Kapitalismus. Inselbewohner waren glückliche Wilde, die – dachte man – so lebten, wie wir es alle in menschlicher Frühzeit getan hatten. Und die Inselzeit verging langsam, während sie auf dem Festland voraneilte.
Hier auf der Insel fühle ich mich ruhig, zufrieden, geradezu glücklich. Der Dichter Tomas Tranströmer, der die Sommer auch auf Runmarö verbracht hat – in einem Haus gegenüber dem von mir gemieteten Häuschen und dem Lebensmittelladen – fasst dieses Gefühl in folgenden Worten zusammen: «Ein stets helles Staunen, /wenn die Insel eine Hand ausstreckt / und mich aus Traurigkeit herauszieht.» Der englische Schriftsteller Lawrence Durrel hat die Gemütsverfassung, die ihn selbst auch überkam, als «eine seltene, aber keineswegs unbekannte Behexung der Seele» bezeichnet. In einem seiner vielen Inselbücher, Leuchtende Orangen, das von Rhodos handelt, analysiert er die Liebe zu Inseln, seine, meine und die vieler anderer. Die davon Betroffenen, schreibt er, erfüllt allein das Wissen, sich in einer kleinen, von Meer umgebenen Welt zu befinden, mit einem unbeschreiblichen Rausch.
Der Traum von der Insel
Regelmäßig bekomme ich Sehnsucht, zu einer weiteren Insel zu reisen. Gerne salzbesprengt, am liebsten ohne Brückenverbindung und am allerliebsten von kantigen und leicht schrulligen, aber zugleich unverfälschten und echten Persönlichkeiten bewohnt. Die Reise dorthin darf durchaus etwas Zeit kosten und muss nicht ganz einfach sein. Ein stürmisches Meer ist kein Hindernis. Aber wenn ich an Land gekommen bin, möchte ich das Gefühl bekommen, an einem Ort gelandet zu sein, an dem das Leben leicht, langsam und weniger komplex als auf dem Festland ist.
Mein Traum von der Insel ist keineswegs außergewöhnlich. Er ist so verbreitet, dass man ihn banal nennen könnte, denn ohne es zu wissen, sind die meisten von uns nesophil, Insel-Liebhaber. Man sehe nur, was die Reisebüros und Reiseveranstalter anbieten, dann wird deutlich, dass die Insel, wenn wir von einem anderen Ort träumen, einen zentralen Platz einnimmt. Allererstes Charterflug-Reiseziel der Schweden war im Sommer 1955 Mallorca. Noch immer gehört die spanische Mittelmeerinsel für die Europäer – nebst den Kanarischen Inseln, Sizilien und Sardinien in Italien sowie dem griechischen Korfu, Rhodos und Kreta – zu den Top Ten der Lieblingsreiseziele. Die Australier hingegen haben Bali und die Südseeinseln. Die Amerikaner Hawaii und die karibischen Inseln. Die Inder die Andamanen und die Malediven. Die Japaner die Ryūkyū-Inseln. Die Chinesen Hainan.
Die Festlandbewohner halten das Inselleben gerne für befreiend und verwandelnd. Auf den Inseln fühlen wir uns unserem Urspung näher und schauen neidisch auf das Leben der Inselbewohner, das sich durch viel mehr familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalt auszuzeichnen scheint.
Zugleich ist die Insel ein Ort, an dem wir gelegentliche Besucher unsere Ruhe haben. Manche reisen sogar auf eine Insel, um herauszufinden, wer sie in ihrem tiefsten Inneren eigentlich sind.
Für so viele Vorstellungen, so viele Träume, so viele Ideen mussten die Inseln herhalten. Wie konnten sie all das tragen, was wir über sie denken?
Bereits vor zweitausend Jahren haben die Römer auf Capri ihren Urlaub verbracht, aber erst Ende des neunzehnten Jahrhunderts hat der Insel-Tourismus ernsthaft begonnen. Außer Sonne und Wasser suchte man dort Ursprung, Vergangenheit, Übersichtlichkeit und Gemeinschaft, all das, was in dem industrialisierten, urbanen Leben auf dem Festland verloren gegangen war. Man sah die Inselbewohner zwar als weniger kultiviert und gebildet an als die Festlandbewohner, zugleich jedoch auch als natürlicher, einfacher, ehrlicher und freundlicher.
Die Griechen im Allgemeinen und Platon im Besonderen betrachteten Inseln als ideale Orte, um neue Städte zu gründen, sowohl in Wirklichkeit als auch in der Phantasie. Platons literarische Erfindung, Atlantis, war das Sinnbild der vollkommenen Insel, wo der Mensch in paradiesischer Harmonie lebte. Doch waren diese Inselbewohner von Hybris verblendet. Nachdem sie an der Eroberung Athens gescheitert waren, sank ihre Insel Atlantis in einer Nacht und einem Tag auf den Meeresgrund – was natürlich eine politische Allegorie darüber war, wie es einem ergehen kann, wenn man den Hals nicht voll kriegen kann und gegen die Gesetze der Natur verstößt. Eine Warnung, bedeutsamer denn je im Zeitalter der globalen Erwärmung, wo mehrere tief liegende Inseln – wie die Malediven und einige weitere in Melanesien, Mikronesien und Polynesien – zu den ersten Opfern steigender Meeresspiegel gehören werden. Letzten Endes ist nämlich die ganze Erde eine Insel im Universum, die, wenn wir gedankenlos weiter Dampf machen, Gefahr läuft, dasselbe Schicksal zu erleiden wie Atlantis.
Auch wenn die Sehnsucht nach Inseln eine mehrere Jahrtausende alte Geschichte hat, scheint die Intensität des Träumens davon zugenommen zu haben. Wenn das Leben sich immer stressiger und komplizierter anfühlt und die Weltlage sich verdüstert, träumen wir uns an einen Ort, an dem Ruhe, Einfachheit und Harmonie herrscht. Ein abgeschiedener Ort, umschlossen von Wasser, der für diese ideale Welt herhalten muss, nach der wir uns sehnen. Natürlich gibt es dieses erträumte Paradies nicht wirklich, das wissen wir wohl. Aber wenn es das geben würde, dann läge es aller Wahrscheinlichkeit nach auf einer Insel.
Auch in der Literaturgeschichte spielt die Insel eine Schlüsselrolle, von Homers Odyssee aus dem achten Jahrhundert vor Christus über Daniel Defoes Robinson Crusoe von 1719 bis zu William Goldings Herr der Fliegen von 1954.
Goldings Buch handelt von einigen Jungs, die auf einer Insel stranden und anfangen, sich gegenseitig zu mobben, zu misshandeln und schließlich auch zu töten. Der zentralen Aussage des Buches zufolge ist die Zivilisation ein dünner Firnis, ohne den wir als die grausamen Tiere erscheinen, die wir im tiefsten Inneren eigentlich sind. Einige Jahre, nachdem das Buch erschienen war, ist etwas in der Art wirklich passiert. Eine Gruppe Jungs aus Tonga landete schiffbrüchig auf einer einsamen Insel, von wo sie erst nach einem Jahr gerettet wurden. Das Ereignis ist gut dokumentiert, unter anderem durch den niederländischen Historiker Rutger Bregman, der sowohl die Jungen (die inzwischen in den Siebzigern sind) interviewt hat als auch die Besatzung, die sie gerettet hat. Hat es sich abgespielt wie in dem Buch? Nein, sagt Bregman und stellt fest, dass die beiden Geschichten, stellt man die wahre neben die erfundene, komplett gegenteilig verlaufen sind. Als die Jungen gerettet wurden, waren sie alle am Leben und vergleichsweise gesund. Um zu überleben hatten sie sich umeinander gekümmert und in beispielhafter Weise zusammengearbeitet.
Die Idee, dass die Isolation auf einer Insel das Schlechteste in uns hervorkehrt, löste sich nicht ein, als sie auf die Wirklichkeit traf. Gerade durch unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit ist die Spezies Mensch trotz allem so weit gekommen. Dennoch ist die Ansicht, der Mensch sei von Grund auf egoistisch, vom Kirchenvater Augustinus über den konservativen Philosophen Thomas Hobbes bis hin zur heutigen kapitalistischen Mainstreamkultur tief verwurzelt in der westlichen Zivilisation. Es liegt im Interesse der Machthaber zu behaupten, dass wir selbstsüchtige Monster seien, meint der niederländische Historiker. Denn wenn die Menschen nicht aufeinander vertrauen können und wenn es wahr ist, dass die Zivilisation nur ein dünner Firnis ist, dann brauchen wir schließlich Könige, Geschäftsführer, Präsidenten, Bürokraten, Polizisten, Militär sowie strenge Verbote und Restriktionen. Kurz gesagt: dann braucht man Hierarchie.
So knüpft Alex Garland in seinem Bestseller Der Strand von 1996 an William Goldings These an. In dem Roman versucht eine Gruppe Rucksackreisender auf einer thailändischen Insel ihre eigene Idealgesellschaft zu verwirklichen. Das Buch wurde in Maya Bay auf den thailändischen Kho Phi Phi verfilmt. Nach der Filmpremiere wurden die Inseln von Reisenden überschwemmt, die eine paradiesische Umgebung wie in dem Film erleben wollten. Doch sie trafen nur auf massentouristische Ausbeutung und Gedränge. Und auch die Reisenden in dem Buch scheitern in ihrem Versuch, die perfekte Gesellschaft zu erschaffen, da Alex Garland (wie Golding auch) der Überzeugung zu sein scheint, dass selbst das schöne Erlebnis eines vollkommenen tropischen Strandes Egoismus, Neid und Machtgier der Menschen keinen Einhalt gebieten kann.
Der Traum von der Insel ist also nicht neu. Bevor wir wussten, wie man auf die Weltmeere hinaus reist, haben wir davon phantasiert, es zu tun. Auf den Karten war die Welt hinter dem Horizont nicht leer, nur weil wir noch nicht dort gewesen waren. Dank der Phantasie war das Meer, noch ehe wir es kartiert hatten, voller Leben. Die mythologische Geographie mit phantasievoll ausgemalten Inseln und Meeresungeheuern war für die Menschen des Mittelalters mindestens ebenso wirklich wie die tatsächliche Geographie, die allmählich die erfundene ersetzte. Zu dieser Zeit durften Mythos und Wirklichkeit gerne verschwimmen, die Grenzen dazwischen waren nicht so scharf, wie sie es heute wären.
Daher hatten die ersten Weltumsegler nicht die Erwartung, auf den abgelegenen Inseln etwas Unbekanntes zu erleben, sondern Dinge, die man dank antiker Sagen und Mythen bereits kannte. Man ging davon aus, die Inseln wiederzuentdecken, über die man seit tausend Jahren schrieb, redete und sie in Karten einzeichnete. Als man auf den Inseln im Atlantik und der Karibik an Land stieg, war daher die erste Herausforderung, sich von seinen vorgefassten Vorstellungen zu befreien und sie durch tatsächliche Beobachtungen zu ersetzen. Es muss ein Schock gewesen sein.
Ich finde, dass die Entdeckungsreisenden, denkt man an ihre lebhafte Vorstellungskraft, auch zu Hause hätten bleiben und weiter träumen können. Eine, die das viel später getan hat, war die deutsche Schriftstellerin Judith Schalansky, die schon ihr ganzes Leben lang an Inseln gedacht und sich nach ihnen gesehnt hat. Auf der falschen Seite der Berliner Mauer geboren, konnte sie in ihrer Kindheit nur in der Phantasie frei reisen. In dem Buch Atlas der abgelegenen Inseln. Fünfzig Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde von 2009 nimmt sie uns mit an Orte, die sie, gerade wie die mittelalterlichen Seefahrer, mit erfundenem Leben gefüllt hat. Das Buch wurde ein internationaler Bestseller. So stark sind unsere Inselträume, dass wir bereit sind, sowohl wirklich erlebte als auch fiktive Inselschilderungen zu verschlingen.
Vielleicht wäre es besser, wenn ich es wie Judith Schalansky machte und die Träume von Abenteuern, exotischen Kulturen und idealen Inselgesellschaften Träume bleiben ließe?
Um die Ideengeschichte der Inseln zu verstehen, lese ich Islands of the Mind: How the Human Imagination Created the Atlantic World von dem amerikanischen Historiker John R. Gillis, einen der ehrgeizigsten Versuche, zu verstehen, welche Rolle Inseln im westlichen Denken gespielt haben.
Von Gillis lerne ich, dass der Garten Eden, das irdische Paradies, im frühen Mittelalter auf Bergspitzen verlegt wurde, da der Berg sich ein kleines Stückchen näher dem Himmelreich befand und so der Sintflut entkommen war, die weiter unten liegende Gegenden überschwemmt hatte. Daher platzierte Dante Alighieri in Die Göttliche Komödie von 1321 das Paradies beispielsweise auf den Gipfel des Läuterungsberges. Einige Forscher gingen von einem realen Vorbild für den Garten Eden aus und verorteten ihn entweder irgendwo in Armenien oder an der Mündung der Flüsse Euphrat und Tigris am Persischen Golf.
Als das Osmanische Reich im fünfzehnten Jahrhundert die Landwege Richtung Osten abschnitt und die Europäer sich stattdessen auf dem Meer Richtung Westen begaben, zog das Paradies von den Berggipfeln auf die Inseln. Die Portugiesen und Spanier waren überzeugt, sie würden den Garten Eden auf Inseln und Inselgruppen finden, die später Madeira, Kanarische Inseln, Kap Verde und Azoren genannt wurden. Als sie entdeckten, dass diese Inseln nicht so paradiesisch waren, wie sie es sich vorgestellt hatten, begannen sie stattdessen, sie als Orte anzusehen, an denen man zu weltlichem Vermögen kommen konnte. Da die Konkurrenz um Boden und Ressourcen auf dem europäischen Festland zugenommen hatte, schien es leichter, auf den dünn bevölkerten oder unbewohnten Inseln reich zu werden. Die primitiven Wilden, die dort möglicherweise schon wohnten, ließen sich leicht unterwerfen.
Diejenigen, die zuerst westwärts segelten, stellten sich das Meer voller Inseln vor. So ausgeprägt war diese Überzeugung, dass es lange dauerte, bis man verstand, dass einige der Landmassen, an denen man gelandet war, keine Inseln, sondern in Wirklichkeit Kontinente waren. So erging es auch Christoph Kolumbus. Er erwartete nicht, über weite Meeresgebiete zu segeln, sondern durch einen dichten Archipel mit tausenden von Inseln. Er war so besessen von diesem Gedanken, dass er, als er dann schließlich Amerika entdeckte, lebenslang in dem Glauben blieb, die neue Welt bestünde nicht aus einem Kontinent, sondern aus einem Archipel.
Außerdem war Kolumbus überzeugt, einige Inseln entdeckt zu haben, die in der Bibel erwähnt wurden. Als er vor Hispaniola ankerte, heute aufgeteilt in Dominikanische Republik und Haiti, glaubte er auf die mythischen Inseln gestoßen zu sein, von denen im Alten Testament erzählt wird – darunter Ofir, wohin König Salomo Schiffe schickte, um Gold, Sandelholz und Edelsteine zu holen. Kolumbus war sicher, eine der biblischen Inseln entdeckt und auf diese Weise die Menschheit ein Stück näher an Jesu Wiederkunft geführt zu haben. Jetzt, dachte er, könnte die Erde wieder ganz werden und das Meer verschwinden. «Er [Kolumbus] stellte sich selbst ins Zentrum des göttlichen Dramas und gab den Inseln die wichtige Rolle, die sie in der Bibel haben», schreibt Gillis. Was für eine Hybris!, denke ich.
Nachdem die spanischen Konquistadoren die Schätze des Inkareiches erblickt hatten, suchten die Seefahrer auch nach der vergoldeten Stadt El Dorado. Die goldbedeckten Wände entfesselten Träume von einer ganzen Stadt, einem ganzen Berg, einem ganzen See oder einer ganzen Insel, bedeckt von Gold. Hernán Cortés segelte nach Westen und suchte im Meer zwischen Südamerika und den Molukken, ebenso Álvaro de Mendaña, der nach der Insel Ausschau hielt, von der König Salomo dem Alten Testament zufolge sein Gold geholt hatte. Entsprechend heißen die Inseln, die Mendaña entdeckte, heute Salomon-Inseln.
Im antiken Griechenland gab es den Mythos von den Inseln der Seligen, gelegen irgendwo im westlichen Mittelmeer. Auf diesen befinde sich ein irdisches Paradies, bewohnt von Inkarnationen der Superhelden der griechischen Sagen. Der Philosoph Plutarch, der diese Inseln ein Stück weiter, draußen im Atlantik lokalisierte, beschrieb sie als Orte, an denen die Luft immer mild ist, der Regen wie silbriger Tau fällt und die glücklichen Bewohner sich ohne Mühe an reifen Früchten satt essen können.
Im frühen Mittelalter wurden die Trauminseln zahlreicher. Irgendwo westlich von Nordafrika wurde Sankt Brendan auf der Seekarte eingezeichnet, und ein Mönch, der behauptete, dort gewesen zu sein, berichtete von einem «atlantischen Paradies». Hundert Jahre später erschien eine weitere Insel auf den Karten. Brasilinsel oder Hy Brasil nannte man sie und platzierte sie westlich von Irland. Dass niemand sie mit eigenen Augen gesehen hatte, spielte keine große Rolle.
Bis zum fünfzehnten Jahrhundert führten die Meere gewissermaßen nirgendwohin. Und von da an überallhin. Während der vierhundert Jahre, die auf die Expeditionen des Kolumbus, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan folgten und die Gillis the age of islands nennt, erfanden die Europäer weitere Inselträume. Einerseits paradiesische Inseln, auf denen es alles gab, was der Mensch durch den Sündenfall verloren hatte – mit anderen Worten, Orte, die es nicht mehr gab –, und auf der anderen Seite utopische Inseln, die von besseren Gesellschaftssystemen als den existierenden erzählten – also Orte, die es noch nicht gab.
Die Inseln wurden zum Gegenstand politischer Visionen über Gesellschaften, die rationaler, demokratischer, gleichberechtigter und glücklicher waren. Als erster kam 1516 der Engländer Thomas More mit dem Buch Utopia heraus, das von einer Insel handelt, auf der das Leben so viel schöner und besser als zu Hause in England ist. Den Namen der Insel konstruierte er aus dem griechischen Wort für nicht und Ort, also nirgendwo. Also ein Ort, den es nicht gibt oder der aber zu gut ist, um wahr zu sein. So wie es geschrieben ist, kann man trotz des entlarvenden Titels verleitet werden, an die wahre Existenz der Insel zu glauben. Zu Beginn der Erzählung begegnet More in Antwerpen einem portugiesischen Seefahrer, der bei Amerigo Vespuccis Expeditionen in die Neue Welt dabei war. Der Portugiese erzählt, er sei dort auf der Insel Utopia an Land gegangen, die so ganz anders als England sei, und habe dann fünf Jahre lang dort gelebt. Alles Eigentum sei gemeinschaftlich, es herrsche Vollbeschäftigung, ein Sechs-Stunden-Tag und Arbeitsrotation (jeder Städter müsse zwei Jahre seines Lebens in der Landwirtschaft arbeiten). Jagen und Schlachten würden als barbarische Tätigkeiten angesehen. Die Bewohner hätten keine Konflikte untereinander und folglich gäbe es auch keine Anwälte. Wenn es mit anderen Inseln zum Krieg komme, heuere man Söldner von den kriegerischen Nachbarstaaten an oder ziehe sich durch Bestechung aus der Affäre. Für die Utopier ist Frieden, nicht Krieg am ehrenvollsten. Gold und Edelsteine haben keinen praktischen Nutzen, sind daher ohne Wert und werden von niemandem begehrt. Jeder Haushalt besteht aus einem Kollektiv von mindestens vierzig miteinander verwandten Personen. Leute, die spotten oder sich über andere lustig machen, werden als seltsam und abweichend angesehen.
Mit anderen Worten: ein entspanntes, friedliches, veganes Volk, das in Kollektiven wohnt, keinen Rachedurst verspürt und seine Mitmenschen respektvoll behandelt. Gibt es etwas Besseres? Vermutlich war More von Vespuccis echten Reisebeschreibungen von Nordamerika inspiriert, in denen der italienische Seefahrer die Ureinwohner auf den Karibischen Inseln mit folgenden Worten beschreibt: «Sie haben kein Privateigentum, alles gehört allen. Sie leben ohne König, ohne Obrigkeit, jeder ist sein eigener Herr.»
Gut hundert Jahre später war es Zeit für ein weiteres Buch über eine idealistische Trauminsel. Francis Bacon, auch er ein Engländer, verfasste 1626 Neu-Atlantis, beeinflusst sowohl von Mores Utopia als auch von Platons Beschreibung der versunkenen Insel. Bacons Erzählung beginnt damit, dass ein europäisches Schiff, unterwegs von Peru nach China und Japan, durch Stürme vom Kurs abkommt. Nach langer Zeit auf dem Meer gehen die Dinge des täglichen Bedarfs zur Neige, während zugleich immer mehr Menschen an Bord erkranken. Da, endlich, sichten sie in einem unbekannten Teil des Pazifischen Ozeans eine Insel. Nachdem sie an Land gekommen sind, werden sie im «Haus der Fremden» einquartiert. Die Kranken bekommen Medizin und werden gesund. Im Gespräch mit den Inselbewohnern wird ihnen deutlich, dass sie in eine ideale Gesellschaft geraten sind. Wenn sie wollen, dürfen sie gerne auf der Insel bleiben. Die Insel heißt Bensalem, zusammensetzt aus dem hebräischen ben – Sohn – und salem – Ganzheit. Die Inselbewohner erzählen von ihrem König namens Solamona, was an den alttestamentarischen Salomo erinnert. Früher hatte man einen lebhaften und ertragreichen Handel mit der übrigen Welt. Aber um Einflüsse des Bösen von außen zu vermeiden, entschied der König, die Insel zu isolieren. Die Jahrhunderte vergingen, der Handel mit der Welt nahm ab, die Navigationskenntnisse wurden verlernt, und in der übrigen Welt vergaß man die Insel.
Bensalem ist nicht genauso egalitär wie Utopia, sondern eher eine patriarchale Monarchie, die von einflussreichen Geschlechtern mit starken Familienoberhäuptern dominiert wird. Im Haus des Königs studiert man Gottes Werk und Schöpfung mit dem Ziel, Wissen zu erwerben über «die Ursachen und geheimen Bewegungen aller Dinge und die Erweiterung der Grenzen menschlicher Herrschaft …». In der übrigen Inselgesellschaft dominiert die Wissenschaft in Laboren mit unbegrenzten Ressourcen, in denen Forscher Experimente durchführen, Theoretiker die Ergebnisse deuten und Ausführende für die praktische Anwendung sorgen. Mit anderen Worten, Ausdruck der Hoffnung auf eine zukünftige Welt, bestimmt von einem rationaleren, weniger religiösen Weltbild.
1602 erschien das Buch Der Sonnenstaat des italienischen Philosophen Tommaso Campanella. Die Rahmenerzählung ist ein Gespräch, das hundert Jahre zuvor in einer italienischen Hafenstadt stattgefunden haben soll. Ein Seefahrer berichtet einem Mann im Hafen, wie er während einer Weltumsegelung auf der Insel Taprobana an Land gekommen ist. Das war der alte Name der Griechen für die Insel, die heute Sri Lanka heißt. Auf der Insel, erzählt der Seemann, befinde sich eine befestigte und uneinnehmbare Stadt, die von einer Ringmauer umgeben und in sieben ineinander liegende Kreise aufgeteilt sei. Jeder Kreis ist von einer Mauer umgeben. Durch verschiedene Tore können die Bewohner sich von einem Kreis in den anderen begeben. In der Mitte des innersten Kreises liegt ein Tempel mit einem Altar, versehen mit zwei Globen: einem Himmelsglobus und einem Erdglobus. Der Sonnenstaat wird von einem gewählten Oberpriester namens Sol regiert, der drei Berater mit den Namen Pon, Sin und Mor hat, was Macht, Weisheit und Liebe bedeutet. Jede zweite Woche ist Vollversammlung, an der alle über Zwanzigjährigen, sowohl Männer als auch Frauen, teilnehmen und ihre Meinung äußern – und wenn sie Lust haben, sogar die Regierungsbeamten absetzen dürfen. Ausgesprochen demokratisch.
Doch viel Freiheit haben die Inselbewohner nicht. Die Regierenden bestimmen, wer sich mit wem paaren darf und zu welcher Zeit genau sie miteinander schlafen sollen, damit die Nachkommenschaft optimal wird. Der Zeitpunkt für die Vereinigung wird vom Stand der Sterne am Himmel bestimmt. Die Kinder bleiben bis zum Alter von zwei Jahren bei ihren Müttern und werden danach gemeinsam aufgezogen. Privateigentum gibt es nicht, und die Regierenden verteilen die notwendigen Dinge nach Bedarf. Wissenschaft und Technik stehen hoch im Kurs, man findet es entscheidender, die Natur durch eigene Beobachtungen zu studieren, als Buchwissen auswendig zu lernen. Die Religion schließlich besteht aus einer synkretistischen Verbindung des Besten von Christentum, Astrologie und östlichen Lehren.
1656 war es Zeit für die Inselphantasien eines weiteren Engländers. Da nämlich erschien James Harringtons The Commonwealth of Oceana, das von einer Insel handelt, auf der die Herrschergewalt – anders als in den europäischen Monarchien – nicht erblich ist, sondern durch demokratische Wahlen zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen rotieren musste. Auch darf niemand zu viel Ackerland besitzen, es soll vielmehr gerecht verteilt werden.
Die Welle von Büchern über Trauminseln war eine Folge der überlieferten, in der Antike verwurzelten Sagen und der Segel- und Entdeckerleidenschaft, von der Europa in den Jahrhunderten nach Kolumbus ergriffen worden war. Verstärkt wurden die Träume durch Schilderungen der Kolonisatoren vom glücklichen Leben, zunächst auf den blühenden Karibischen und später auf den Polynesischen Inseln. Dabei wurden die Bewohner als heitere Naturvölker beschrieben, die sich in einer an Früchten überbordenden Natur mit unbegrenzter Lust erotischen Ausschweifungen und sorglosen Vergnügungen hingaben.
Wie Lord Byron in dem Gedichtzyklus Die Insel von 1823, in der Übersetzung von Otto Gildemeister, schreibt:
Ihr ratet, was geschah. Das Inselland
Reichte dem weißen Mann die braune Hand,
Ein Wunder jeder jedem; dann gedieh
Das Staunen bald zu wärmrer Sympathie;
Hold war der Gruß der sonngebornen Väter,
Der Töchter Lächeln holder und beredter;
Die Eintracht wuchs; wohl sahn des Sturmes Söhne,
Wie Anmut manche dunkle Form verschöne […]
Das Cavafest, der Yam, der Cocusschaft,
Der Alles, Frucht und Milch und Becher, schafft;
Der Brotbaum, der auf ungepflügtem Feld
Die schnitterlosen Erntefeste hält […].
In einer chaotischen und unsicheren Welt handelt die magische Anziehungskraft der Inseln, denke ich, letzten Endes von der Sehnsucht nach Orten, die sich abgrenzbar, überschaubar, begreiflich und sicher anfühlen. Wahrscheinlich gibt es kaum einen Traum, der so weit verbreitet ist, wie dieser.
Doch träumen alle Menschen auf der Welt gleichermaßen von Inseln? Der amerikanisch-chinesische Geograph Yi-Fu Tuan bezweifelt es. Seiner Ansicht nach haben Inseln zwar eine gewisse universelle Anziehungskraft, allerdings ist diese in den westlichen Ländern am stärksten.
John R. Gillis meint, dass es auch einen Klassenaspekt gibt – oder gab. Die Armen Europas haben historisch gesehen nicht von ideal organisierten Gesellschaften auf abgelegenen Inseln geträumt, sondern eher vom Himmelreich, das sich der Offenbarung des Johannes zufolge den Rechtgläubigen eines Tages zeigen wird. Auch die Nomaden – die Samen, die Roma, das Reisende Volk und die Landstreicher – haben nicht so viele Inselträume gehabt, da sie ja selbst ständig unterwegs sind und es besser wissen, als von einem Paradies hinter dem Horizont – oder hinter der nächsten Wegbiegung oder im nächsten Tal – zu träumen. Auch in den zentralistischen und mächtigen Staaten, wie dem Römischen Reich, dem Kaiserreich China oder später der Sowjetunion, gediehen keine Träume von der Paradiesinsel, so Gillis, weil die Bürger der Imperien schließlich indoktriniert waren zu glauben, dass sie sich bereits mitten im Paradies befänden.
Im Westen denken wir nicht nur an Inseln, wir denken mit ihnen. Wir haben eine Tendenz, überall Inseln zu sehen, was die Insel zu einer unserer zentralen Metaphern macht. Wir denken an Inseln, wenn wir über Oasen in der Wüste sprechen, über Ghettos in Großstädten, über frei im Raum stehende Küchenschränke, über Zellgruppen, über einen Teil des Gehirns, über Muster, die man im Fingerabdruck findet und sogar über uns selbst als Individuen («jeder Mensch ist eine Insel» oder «kein Mensch ist eine Insel»). Zugleich stellen wir uns den Cyberspace als ein Meer voller Inseln vor, in dem wir herum surfen, mit Hilfe eines Webbrowsers als Navigator. Wenn jemand sich irrt oder etwas falsch verstanden hat, können wir sagen, dass er «auf dem falschen Dampfer» ist, wobei der Ozean die Lieblingsmetapher für Chaos und Verwirrung ist.
Gillis sieht zudem in den westlichen Ländern eine Tendenz, archipelartig zu denken und sich eher auf die Teile als auf das Ganze zu fokussieren. Viele andere Kulturen konzentrieren sich hingegen mehr auf das Verbindende als das Trennende. Die Einwohner Polynesiens haben sich beispielsweise eher einem Meer von Inseln als einer speziellen Insel zugehörig betrachtet. Es waren die Europäer, die im Zuge ihrer Weltumsegelungen den Begriff insular prägten, der nicht nur für Abgeschiedenheit, sondern – zumal im Englischen – auch für Kleingeistigkeit und kulturelle Isolation steht, die zwischen ihren Inselbesitzungen Grenzen schufen und eine Insel von der anderen isolierten. Das Meer, durch das die Polynesier sich verbunden fühlten, erschien den Europäern als ein Zwischenraum, eine Leere. Auch die Bewohner der Karibik dachten früher einmal wie die Polynesier, bevor die Europäer die Inseln zwischen sich aufteilten und sie voneinander und von ihrer eigenen Geschichte abtrennten.
Heute sind die Inselbesitzungen der Kolonialimperien im fernen Ozean eine bloße Erinnerung. Dachte ich zuerst. Aber wieso eigentlich? Denn es stimmt natürlich nicht. Frankreich herrscht noch immer über hundertachtzehn Inseln in Polynesien, siebenundsechzig davon bewohnt, mit Tahiti als Hauptinsel. Außerdem über Martinique und Guadeloupe in der Karibik und Réunion und Mayotte im Indischen Ozean. Und etwas weiter südlich im selben Meer über einige der isoliertesten Inseln der Welt: die Kerguelen-Inseln, auch bekannt als Inseln der Trostlosigkeit (Îles de la Désolation), die selbst darum gebeten hatten, adoptiert zu werden.
Auch Großbritannien hat einige seiner kolonialen Insel-Eroberungen behalten, unter anderem Anguilla, Bermuda, die Britischen Jungferninseln, die Cayman-Inseln und die Turks- und Caicoinseln in der Karibik; die Falklandinseln, St. Helena, Ascension, Tristan da Cunha, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln im Südatlantik; Henderson und die Ducie- und Oenoinseln (Pitcairninseln) im Pazifischen Ozean sowie den Chagos-Archipel im Indischen Ozean.
Die Chagos-Inseln wecken meine Neugierde. Anfang der siebziger Jahre vertrieben die Briten die letzten Ureinwohner von der Inselgruppe, die offiziell British Indian Ocean Territory heißt, direkt unterhalb der Malediven liegt und eine britisch-amerikanische Militärbasis beherbergt. Die Chagossianer haben lange davon geträumt, auf ihre Heimatinseln zurückkehren zu können. Anfang 2022 durfte erstmals eine Gruppe glücklicher Ureinwohner, die auf Mauritius gelebt hatten, zurückreisen. Am liebsten wäre es ihnen, wenn die Briten verschwinden, damit sie die Inseln wieder für sich bekämen. Dieses Anliegen fand Unterstützung sowohl bei der UNO als auch von mehreren internationalen Gerichtshöfen. Doch die Briten weigern sich. Die Inseln haben große militärstrategische Bedeutung. 2020 hatte Mauritius es satt und wandte sich an Google, damit die Information, dass die Inseln zu Großbritannien gehören, gelöscht würde. Mit gewissem Erfolg, denn in den meisten Einträgen steht dort jetzt, dass Mauritius Anspruch auf die Inseln erhebt und bei der UNO Recht bekommen hat.
Die Chagos-Inseln sind ein Beispiel für Inseln, von denen die meisten Festlandbewohner noch nie gehört haben. Und natürlich gibt es noch mehr unbekannte Archipele. Wer kann die Königin-Elisabeth-Inseln, die Lakkadiven und die Nikobaren auf einer Weltkarte zeigen? Niemand? Das dachte ich mir! Nimmt man ihre Bekanntheit für den überwiegenden Teil der Menschen, ist also nicht die gesamte Welt durchkartografiert. Und wenn es Orte gibt, von denen wir nie haben reden hören, sind es mit größter Wahrscheinlichkeit abgelegene Inseln.
Die Zeit der kolonialen Neuerwerbungen ist vorbei. Stattdessen haben die Touristen die Rolle der Kolonisatoren übernommen. Heute reisen wir zu Inseln auf der Jagd nach «phantastischer Abgeschiedenheit und einer Atmosphäre von Zeitlosigkeit», um mit Gillis zu sprechen, kurz, all dem, was die frühen Entdecker gesucht haben. Und, muss man hinzufügen, auch nach der Abgeschnittenheit, der alle, die dauerhaft auf Inseln leben, nach Kräften zu entkommen versuchen.
Genau wie andere zentrale Metaphern kann die Insel für eine Menge verschiedener Dinge stehen. Die Inseln wecken also viele gegensätzliche Wünsche, Befürchtungen und Begierden. Sie können Bedrohtheit und Verletzlichkeit, aber auch Ganzheit, Echtheit und Sicherheit repräsentieren. Inseln symbolisieren etwas, was wir verloren haben, und sind damit ein Ort, an dem wir uns erholen können. Sie sind Metapher für Paradies und Hölle. Sie sind sowohl attraktiv als auch abschreckend. Sie stehen sowohl für Trennung als auch für Kontinuität, für Isolation und Zusammenhalt. Sie lassen uns in die Vergangenheit und in die Zukunft blicken. Wir projizieren auf sie unsere Wünsche und unsere Begierden. Zugleich sind sie geeignete Orte, um unsere größten Ängste zum Ausdruck zu bringen. Wie in Arnold Böcklins Gemälde Die Toteninsel von 1880–1881, in Stephen Spielbergs Film Jurassic Park von 1993 oder in den sechs Staffeln der amerikanischen Fernsehserie Lost, die zwischen 2004 und 2010 ausgestrahlt wurde – um nur einige Beispiele zu nennen.
Auf Inseln fühlen wir uns ungewöhnlich frei, aber auch extrem eingeschränkt. Auch wenn Inseln inzwischen meist mit Vergnügen, Friedlichkeit und Entspannung verbunden werden, nicht zuletzt in der Tourismusindustrie, stehen sie noch immer für Schmerz. Wir schicken Subversive, kriminelle Immigranten, Asylbewerber, Infizierte und andere nicht Erwünschte auf Inseln. Napoleon Bonaparte wurde gezwungen, zunächst auf Elba und dann auf Sankt Helena ins Exil zu gehen. Später schickten die Franzosen Kriminelle und Regimekritiker (unter anderem Dreyfus) auf die Teufelsinsel direkt vor Französisch Guyana, die Briten brachten ihre Diebe und Staatsfeinde per Schiff nach Australien, die Seychellen und die Andamanen, und Südafrika sperrte seine Apartheidsgegner wie Nelson Mandela auf Robben Island ein. Venedig schickte Leprakranke auf die Insel Lazaretto und Pestinfizierte nach Poveglio, während Schweden Infizierte auf Känsö im Göteborger Schärengarten und auf Fejan im Stockholmer Schärengarten isolierte. Kürzlich erst brachte Australien Asylsuchende nach Papua-Neuguinea und Nauru, um sie nicht auf ihrer eigenen Rieseninsel, die eher ein Kontinent ist, haben zu müssen.
Auf den Inseln in der Karibik und im Indischen Ozean legten Briten und Franzosen Plantagen an, auf denen die Arbeit von Sklaven getan wurde. Für diese waren die Inseln natürlich Synonyme für Zwang, Gewalt, Tod und Krankheiten. So hoffnungsvoll, wie das Inselleben für die träumenden Kolonisatoren erschien, so hoffnungslos konnte es für die Untergebenen und Kolonialisierten sein.
Während der Aufklärungszeit verwandelten Wissenschaftler die Insel in eine Art natürliches Laboratorium. Anthropologen fanden sie ideal für Feldstudien zu Kulturen der indigenen Völker. Bronislaw Malinowskis Feldstudien auf einer Insel – genauer gesagt Kiriwina von den Trobriand Inseln – legten den Grund für die heutige Sozialanthropologie.
Die Europäer waren, kurz gesagt, fixiert auf Inseln, auf die sie ihre Träume projizierten, sich über sie entsetzten, auf sie emigrierten – dabei natürlich auch reich wurden –, auf denen sie ihren Ursprung erforschten und sich neugeboren fühlten.
Die indischen und chinesischen Festland-Imperien, die vor den europäischen Kolonialismen die Weltökonomie dominierten, schauten hingegen weiterhin in die Mitte der Kontinente. Das indische Königreich hatte seine Zentren weit von den Küsten entfernt und betrachtete das Meer – das kala pani, schwarzes Wasser, genannt wurde – als bedrohlich und uneinnehmbar. China hatte nach einigen Versuchen aufgegeben, durch Langstrecken-Seefahrt reich zu werden. In einem Handbuch von 1701 fasste dort ein Autor alle Europäer, Amerikaner und Afrikaner, von denen man fand, sie hätten das Meer und die Inseln im Kopf, zusammen und bezeichnete sie als «die Menschen vom großen westlichen Meer».