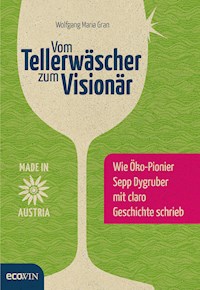
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Erfolgsgeschichte von Öko-Revoluzzer Sepp Dygruber Als er mit seinen claro-Geschirrspültabs gegen die internationalen Giganten antrat, erklärte man ihn für verrückt. Doch Sepp Dygruber ist ein Mann mit Visionen – und beweist, dass sich umweltbewusstes Handeln und kommerzieller Erfolg nicht ausschließen. Er setzt früh auf ökologische Produktion und macht eine steile Karriere. Heute ist er eine fixe Größe in seiner Branche: ein Vordenker im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Unternehmen. In der vom Journalisten Wolfgang Maria Gran aufgezeichneten Biografie spricht der claro-Chef über seine Erfolge und Rückschläge, über seine Anfänge und seinen Weg zum Gründer und Firmenlenker. Zentrale Themen im Buch: - David gegen Goliath: Firmengründung 1995 – gegen etablierte Marktführer - Firmenziel: ökologische Nachhaltigkeit – ohne Wenn und Aber - Vernichtendes Urteil als Ansporn: erst beim Warentest durchgefallen – dann Testsieger - Zwei Damen für ein Halleluja: Welche Rolle spielen Dagmar Koller und Anna Veith in der claro-Firmengeschichte? Innovativ und mutig: Bilanz über 25 Jahre Unternehmensgeschichte Als Kind aus einfachen Verhältnissen ist Sepp Dygruber eigentlich eine Laufbahn vorgezeichnet, die auf Sicherheit setzt. Doch nachdem er wichtige Erfahrungen bei einem internationalen Unternehmen gemacht hat, geht er auf volles Risiko und gründet seine eigene Firma. In seinem kleinen österreichischen Unternehmen implementiert er bereits ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit als Unternehmenswerte, als diese Begriffe in der Wirtschaft noch kaum eine Rolle spielten. Im Buch werden die unternehmerischen und persönlichen Herausforderungen des claro-Gründers beschrieben. Was sich heute wie eine einzigartige Erfolgsgeschichte liest, war ein langjähriger Lernprozess. Und was bringt die Zukunft? Für Dygruber ist das nächste Ziel ganz klar: eine Öko-Fabrik! »Vom Tellerwäscher zum Visionär« ist ein inspirierendes Buch darüber, dass Erfolg manchmal Zeit braucht – und Durchhaltevermögen genauso wichtig sein kann wie eine gute Idee zur Firmengründung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolfgang Maria Gran
VomTellerwäscherzumVisionär
Wie Öko-Pionier Sepp Dygruber mit claro Geschichte schrieb
Umschlag und Inhalt gedruckt auf Naturpapier. Dieses Buch wurde CO2-neutral produziert.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
Der Verlag hat sich bemüht, alle Bildrechteinhaber ausfindig zu machen. Sollten Ihnen dennoch Unstimmigkeiten im Bildnachweis auffallen, so bitten wir Sie, mit uns in Kontakt zu treten.
Gendererklärung
Der besseren Lesbarkeit wegen verwendet der Autor im nachfolgenden Text zumeist die Sprachform des generischen Maskulinums. Personenbezogene Aussagen beziehen sich auf alle Geschlechter.
1. Auflage
© 2021 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Gesetzt aus der Palatino, Interstate
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Umschlaggestaltung: www.b3K-design.de, Andrea Schneider, diceindustries, unter Verwendung von Elementen der CI der claro products GmbH
Fotos: alle ©claro products GmbH, außer S. 1: Foto Holzer; S. 6 unten, S. 7: Andreas Schaad
Autorenillustration: Claudia Meitert/carolineseidler.com
ISBN 978-3-7110-0282-2
eISBN 978-3-7110-5307-7
Inhalt
Vorwort
Nichts ist Claro – alles ClaroEin Sitzenbleiber wurde zum Musterschüler
Wenig Geld, viel NaturAls der Opa ein Marmor-Denkmal ritzte
Lebensschule sanft und hartVon der Bank auf den Schleudersitz
Das 1000-Kilogramm-TabWarum claro eigentlich Clever heißen sollte
Zwei Damen für ein HallelujaDagmar Koller und Anna Veith als Haupttreffer
In der UmsatzfalleÜberlebenskampf und Umstrukturierung
Der grüne FadenWie sich claro zur Green Brand entwickelte
Die große FreiheitVom Gründer zum Firmenlenker
Bibel und IronmanWie claro-Chef Josef Dygruber privat tickt
Vom Tellerwäscher zum VisionärDer große Traum von der Ökofabrik
Epilog
Über den Autor
Vorwort
Bei meiner Lehrtätigkeit an der Universität Salzburg erzähle ich den jungen Menschen in jedem Sommersemester, dass ich Neugierde für eine entscheidende Grundvoraussetzung dafür halte, eine gute Journalistin oder ein guter Journalist zu werden. Wer nicht neugierig auf Menschen und deren Leben mit all seinen Facetten ist, wer nicht so genau wie möglich wissen will, was sich hinter Offensichtlichem und allgemein Zugänglichem verbirgt, wer das noch Unbekannte scheut, weil es kuscheliger und sicherer ist, sich im Vertrauten zu rekeln, wird bestenfalls einmal passabel nacherzählen, aber niemals gut berichten können.
Was man anderen erzählt, sollte man im Idealfall auch selbst leben, und demnach fand ich mich Anfang 2020 mit einer gewissen Neugierde im Sky-Restaurant eines Salzburger Hotels ein, um mich erstmals mit claro-Chef Josef Dygruber zu treffen, nachdem das Ansinnen an mich herangetragen worden war, ein Buch über die Geschichte dieses Unternehmens und seines Gründers zu verfassen.
Der scharfsinnigen Leserin und dem detailverliebten Leser wird nun sofort aufgefallen sein, dass ich von einer »gewissen Neugierde« schrieb, die man getrost als die kleine Schwester des brennenden Interesses bezeichnen kann. Denn noch war mir die Welt der kleinen Waschwürfelchen für Geschirrspüler außerhalb des häuslichen Gebrauches eine gänzlich unbekannte. Viel zu fremd vom Fachgebiet her und ziemlich weit weg von meinen sonstigen thematischen Vorlieben, um dafür gleich einmal leidenschaftlich zu entflammen. Und daran änderte auch dieses erste Beschnuppern zunächst wenig.
Anders verhielt es sich mit dem Menschen hinter der Firma. Der zog mich vom ersten gemeinsamen Espresso hoch über den Dächern Salzburgs an in seinen Bann, und auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht die geringste Ahnung hatte, wofür Tenside oder Enzyme in Geschirrspültabletten gut sein sollten, zeichnete sich schon bei diesem allerersten Treffen allein aufgrund der Persönlichkeit des Firmengründers eine hoch spannende Geschichte ab.
Die Geschichte eines Arbeiterkindes aus einfachsten Verhältnissen, das mit ziemlich eindeutigen Vorgaben für ein gelingendes Leben ins Erwachsensein entlassen worden war. Wie bei so vielen seiner Generation und Herkunft war dem Über-Ich das Mantra eingepflanzt worden, »es einmal besser zu haben« als die Generation vor ihm. Und »Sicherheit« war der zentrale Wert, der sich im Marschgepäck für diesen Weg befand. Umso spannender war Dygrubers Ausbruch aus dieser Prägung – hinein in ein hoch riskantes Leben als Selfmade-Unternehmer in einer Branche, in der Global Player wiederholt auf schmerzhafte Art die Ellbogen ausfuhren, um den aufmüpfigen neuen Mitspieler wieder loszuwerden.
Es ist aber auch die Geschichte der »Faszination Marke«, die ihren Gründer auch in schwierigen Phasen, deren härteste zum Überlebenskampf mit allen dazugehörigen Sorgen und Existenzängsten geriet, niemals aufgeben ließ. Diese tief verwurzelte Sehnsucht, mit einer eigenen Marke einen bleibenden Wert zu erschaffen, prägt die gesamte, wechselvolle claro-Historie. Wie mühsam so ein Weg ist, welche Fallstricke lauern, wie lange es dauert, eine anfangs noch diffuse Sehnsucht in eine zielführende Strategie zu gießen, erfuhr ich erst in den vielen weiteren Gesprächen, die diesem ersten Treffen in Salzburg folgten. Aber es bestätigte, dass der erste Eindruck nicht getrogen hatte und diese Geschichte von so viel mehr handelte als der Produktion kleiner Waschwürfelchen.
Schließlich verdient der »grüne Faden«, der sich durch die Historie dieses Unternehmens und seines Gründers zieht, entsprechende Beachtung. Denn diese kleine österreichische Firma implementierte ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit bereits zu einer Zeit in ihr Tun, als diese Begriffe im Wirtschaftsleben noch keine oder bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielten. Und es spricht für die Aufrichtigkeit Dygrubers, dass er diesen Punkt nicht nachträglich »begrünt«, um besser dazustehen, sondern offen zugibt, dass auch das ein Lernprozess war, der vieler Jahre und Erkenntnisgewinne bedurfte.
Jedenfalls war plötzlich aus meiner professionellen Neugierde eine sehr spezielle geworden, weil sich hier in Summe eine spannende Geschichte über die Wechselwirkung Mensch, Wirtschaft und Ökologie aufgetan hatte. Mit all ihren Verlockungen und Fallen, aber vor allem auch mit der Idee eines Weges zum symbiotischen Gelingen. Denn diese Geschichte zeigt, dass es kein Widerspruch sein muss, als Firmenlenker menschlich zu agieren, ein Unternehmen mit achtsamem Blick auf die Natur und ihre Ressourcen zu führen und kommerziellen Erfolg zu haben. Und zwar nicht trotzdem, sondern deswegen.
Es handelt sich hier gleichermaßen um die letztendlich erfolgreiche Geschichte eines in vielerlei Hinsicht erstaunlichen Unternehmens wie um die persönliche Entwicklungsgeschichte eines faszinierenden Menschen, der sich ein Ziel gesetzt und sich damit auf eine wechselvolle Berg- und Talfahrt eingelassen hat, die an manchen Punkten auch hätte schiefgehen können. Josef Dygruber spricht in großer Offenheit über alle Stationen, die unternehmerischen wie die persönlichen, und das macht dieses Buch nicht nur für Wirtschaftsaffine spannend, sondern auch zu einer auf mehreren Ebenen interessanten Entwicklungsgeschichte eines Menschen, der auszog, um mit seinem Tun Spuren zu hinterlassen.
Bleibt noch, Danke zu sagen. Vor allem Josef Dygruber, der so konsequent der Versuchung widerstand, Dinge in der Rückschau zu verklären, und der damit die Arbeit an diesem Buch auch für den Autor zu einer spannenden Forschungsreise in bis dahin unbekannte Gefilde gestaltete. Hanni und Sepp Dygruber danke ich dafür, dass sie das eine oder andere Fensterchen zu Kindheit und Jugend ihres »Buben« geöffnet haben, obwohl sie in der Regel nicht viele Worte machen. Marietta Dygruber dafür, dass sie einen Blick auf den Ehemann und Vater ihrer beiden Kinder Laura und Josef gestattete. Und schließlich dem ehemaligen Chef von Miele Österreich, Peter Graski, für interessante Einblicke in das Innenleben des Geschäftspartners, der schließlich zum engen Freund wurde.
Abschließend danke ich auch Anna-Magdalena Samardzic und Gerlinde Tiefenbrunner von Benevento Publishing für die gleichermaßen angenehme wie professionelle Zusammenarbeit.
Wolfgang Maria Gran
St. Pölten, im November 2020
NICHTS IST CLARO – ALLES CLARO
Gerade erst hatte der kleine Außenseiter im Ring ein wenig zu tänzeln begonnen; sich nicht respektlos, aber doch ganz schön frech in den Kampf eingebracht; erste leichte Körpertreffer bei den Gegnern gelandet, auch wenn diese eher als lästig, denn als schmerzhaft empfunden wurden. Aber es reichte immerhin, um zu bemerken, dass es da plötzlich jemanden gab, der zuvor nicht da gewesen war.
Und dann kam, für die ausgefuchsten Profis im Ring vorhersehbar, für den frechen Jungen aber wie aus dem Nichts, diese Gerade. Exakt auf die Kinnspitze. Die Sterne, nach denen er gegriffen hatte, tanzten nun vor seinen Augen, ehe es tiefschwarz wurde und der harte Aufprall auf den Brettern erfolgte. Ein Aufprall, der einerseits so richtig schmerzhaft war, der andererseits aber auch naive Träume aus dem brummenden Schädel beutelte und den ungetrübten Blick auf eine knallharte Realität frei machte.
Genau so erging es an einem Februartag des Jahres 2008 dem jungen Salzburger Unternehmer Josef Dygruber, der sich, nach seinem Abgang als Verkaufsleiter in der Österreich-Filiale des damals noch nicht mit der englischen Firma Reckitt fusionierten deutschen Waschmittelkonzerns Benckiser, 13 Jahre zuvor mit der Marke claro selbstständig gemacht hatte. Während ein großer Teil der Konsumenten damals noch Geschirrspülpulver verwendete, setzte der zu diesem Zeitpunkt erst 27-Jährige auf die kurz zuvor auf den Markt gekommenen Tabs und sah darin seine Chance, mit einer eigenen Marke in den Ring zu steigen. Einen Ring, den er zwar schon ganz gut kannte, aber bis dato nur von der relativ sicheren Seite aus, von der aus er den Kampf der langjährigen Profis zwar erste Reihe fußfrei mitverfolgt hatte, aber nur als Mitglied des Betreuerstabes. Jetzt wollte er nicht mehr nur gute Ratschläge erteilen, sondern selbst mitfighten.
Diese Profis, das waren im deutschsprachigen Raum Dygrubers ehemaliger Arbeitgeber Reckitt Benckiser mit der Marke Finish, die damals hierzulande noch Calgonit hieß, und die Henkel AG mit der Marke Somat. Beide beschäftigen Zehntausende Mitarbeiter und erwirtschaften Umsätze im deutlich zweistelligen Milliardenbereich. Dem gegenüber stand claro, das nach den ersten 13 Betriebsjahren mit drei Dutzend Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 15,8 Millionen Euro generierte. Außerhalb des deutschen Sprachraums, wo Dygruber schon einige Jahre nach der Firmengründung ebenfalls erste Gehversuche wagte, kamen mit multinationalen Konzernen wie Procter & Gamble mit der Marke Fairy oder Unilever mit Sun Giganten als Mitbewerber dazu, deren Jahresumsätze sich aktuell im Bereich von 50 Milliarden Euro bewegen.
Da piepste also gewissermaßen eine Micky Maus rotzfrech eine Elefantenherde an.
Blaue Augen hatte sich Dygruber schon in den Anfangsjahren immer wieder einmal geholt, aber mit dem Niederschlag im Februar 2008 drohte ein schwerer K. o. Ausgeführt wurde dieser Treffer von der deutschen Stiftung Warentest, der 1964 in Berlin gegründeten gemeinnützigen Verbraucherorganisation, die Waren und Dienstleistungen aus allen möglichen Bereichen vergleichend unter die Lupe nimmt. Ihr Urteil kann ein Unternehmen in hellem Glanz erstrahlen lassen, aber auch in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Weit mehr als 6000 verschiedene Tests, vom Schokoriegel bis zur Sicherheit von Fußballstadien, machten die Prüfer dieser Stiftung von ihrer Gründung bis heute; in diesem Februar 2008 veröffentlichten sie ihren Testbericht über Geschirrspültabs.
Josef Dygruber und sein Chemiker und technischer Leiter Erich Fabianitsch, die das Unternehmen 1995 aus dem Boden gestampft hatten, waren mit ihren claro-Tabs erstmals dabei und eigentlich guter Dinge. In Österreich hatte man es bei den großen Handelshäusern nach etlichen Anläufen in die Regale geschafft, in Deutschland war kurz vor dem großen Testbericht ein spektakulärer Deal mit der Drogeriemarktkette dm gelungen. Außerdem hatte man als erster und bis zu diesem Zeitpunkt einziger Anbieter auf dem Markt die Tabs in wasserlöslicher Folie verpackt und damit aus ökologischer Sicht einen gewaltigen Pionierschritt getan.
Doch statt sich dafür bei Stiftung Warentest einen Ritterschlag abzuholen, schritten die Österreicher schnurstracks ihrer eigenen Hinrichtung entgegen. In der Regel werden die Headlines ja den strahlenden Siegern gewidmet, aber diesmal gehörte alle Aufmerksamkeit in fetten Lettern dem Newcomer: »Nichts ist Claro« lautete das vernichtende Urteil der Tester schon im Titel, und im Text kam es noch viel dicker. Da war von »Totalausfall« und »teurem Flop« die Rede, und wenn man bei so vielen schallenden Ohrfeigen überhaupt noch in der Lage ist, die schmerzlichste zu definieren, dann war das in diesem Moment wohl das Desaster mit der vermeintlichen Trumpfkarte, der wasserlöslichen Folie. Der Test der Lagerfähigkeit der Geschirrspültabletten fand nämlich bei hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit statt, und da hatte man bei claro die hygroskopischen Eigenschaften der neuen Folie für einen Test unter solchen Bedingungen nicht ausreichend bedacht. Jedenfalls blieben von den brandneuen, innovativen 7-in-1-Tabs, mit denen man die übermächtigen Konkurrenten vor sich hertreiben wollte, nur noch »1-in-1-Knödel« übrig, weil die Folie alle Feuchtigkeit gebunden und die Tabs in undefinierte Klumpen verwandelt hatte.
Und damit hieß es für die Österreicher: Nicht genügend. Setzen.
Da saßen sie nun völlig zerknirscht in der kleinen Firma in Mondsee, Josef Dygruber und sein Chemiker Erich Fabianitsch, und fühlten sich auch wie Schüler, die zwar brav gelernt hatten, aber trotzdem mit einem Fünfer nach Hause gekommen waren: »Es war mit Sicherheit die schwärzeste Stunde«, sagt Dygruber heute. Eine Stunde, in der er fast froh war, dass sein Kollege aus dem Labor, der mit ihm einst bei Benckiser gearbeitet und dort die Entwicklungsabteilung geleitet hatte, noch eine Spur geknickter wirkte als er selbst: »So konnte ich ihn ein wenig aufrichten, ihm Hoffnung machen und Mut zusprechen – und das hat wiederum auch mir geholfen, nach diesem Niederschlag wieder aufzustehen.«
Denn natürlich kam auch beim Firmenchef dieser erste Reflex hoch, dass man Opfer einer großen Ungerechtigkeit geworden wäre und die Tester auch andere Möglichkeiten gehabt hätten, als eine Headline wie die scharfe Klinge einer Guillotine auf jemanden herabsausen zu lassen, der zu dieser Zeit gerade einmal 0,4 Prozent Marktanteil in Deutschland hatte: »Das wurde ja auch im Internet veröffentlicht, und da war es dann noch sehr, sehr lange so, dass du ›claro‹ eingegeben hast und sofort auf ›Nichts ist Claro‹ gestoßen bist. Hilfreich war das nicht«, erinnert sich Dygruber.
Aber es reichte auch nicht für einen finalen K. o., denn noch mit dem niederschmetternden Testergebnis vor Augen gab der claro-Chef seinem Chemiker Fabianitsch ein Versprechen: »Ich weiß, was du kannst, ich glaube fest an uns und sage dir: So etwas wird uns nie wieder passieren. Und auch wenn es eine Weile dauern wird, sage ich dir schon heute: Eines Tages werden wir Testsieger sein.« Als ihn der väterliche Freund daraufhin einen Träumer nannte, kam das bei Josef Dygruber quasi als Arbeitsauftrag an. Denn wer, wenn nicht der Chef selbst, sollte kühne Träume entwickeln und deren Umsetzung vorantreiben.
Zugute kam ihm dabei eine Fähigkeit, die unter anderem den durchschnittlichen vom außergewöhnlichen Unternehmer unterscheidet: Niederlagen und Rückschläge nicht lange zu beklagen und die Schuld im Außen zu suchen, sondern unverzüglich und ohne Umwege in die schonungslose Selbstanalyse zu gehen. Dabei gingen dem Salzburger gleich mehrere Lichter auf. Das Test-Desaster mit der wasserlöslichen Folie hatte ihm zwar in der Bewertung das Genick gebrochen, Dygruber musste sich aber auch andere, zunächst schwer verdauliche Faktoren eingestehen: »Unser Produkt war zwar von der Reinigungsleistung her gut, aber in Bereichen wie Glanztrocknung oder Belagsbildung, also in vielem, das von einem Multi-Tab verlangt wurde, waren wir noch meilenweit von den großen Mitbewerbern entfernt. Das mussten wir uns damals, zähneknirschend, aber doch, eingestehen.«
Zwei entscheidende Erkenntnisse nahm der Selfmade- Unternehmer aus diesen stockfinsteren Stunden mit: dass die Performance seines Produktes noch lange nicht dort war, wo sie zu sein hatte, um mehr als eine Sternschnuppe zu werden. Und dass er sich schleunigst mit den Regeln des Spiels vertraut machen musste, nach denen die Großen der Branche spielten, denn das Blauäugige hatte er nun im übertragenen wie wörtlichen Sinn hinter sich gebracht. Selbstverständlich saßen nämlich zum Beispiel Vertreter der großen Konkurrenten in jenem Fachbeirat von Stiftung Warentest, der unter anderem bei der Auswahl von Testkriterien beratend tätig ist. Und der Unterschied, ob man aus der Ferne ein Liedlein nachpfeifen konnte, oder selbst in irgendeiner Form dort präsent war, wo die Musik spielte, war Josef Dygruber nun überaus schmerzlich bewusst geworden: »Dabei ging es überhaupt nicht um Beeinflussung, sondern darum, besser und schneller informiert zu sein und auf manche Dinge reagieren zu können, bevor man eine böse Überraschung erlebt.«
Ihm wurde nun auch nachträglich klar, dass die zunächst schmeichelhafte Einladung zum Essen ins noble Salzburger Schloss Aigen, die der damalige Boss eines Mitbewerbers ausgesprochen hatte, nicht der unbestreitbaren Tatsache geschuldet war, dass Dygruber ein interessanter und sympathischer Gesprächspartner war. Sondern dass es hier in erster Linie um den Versuch gegangen war, in vermeintlich jovialer Atmosphäre mehr über das Innenleben und die Pläne einer kleinen Firma zu erfahren, die mit dem 7-in-1-Tab soeben dem 5-in-1-Modell eines Großkonzerns frech aufgefahren war.
Kurz: Der letzte Platz bei Stiftung Warentest animierte Josef Dygruber zu einer längst notwendigen Aufholjagd in Menschenkenntnis, Business-Regelkunde, vor allem aber zu einer deutlichen Schärfung der Zielperspektiven für seine eigene Marke. Mit diesem Fünfer im Zeugnis büffelte er von dieser Stunde an wie ein Besessener, um claro vom Sitzenbleiber zum Musterschüler zu machen. Denn da verstand Josef Dygruber überhaupt keinen Spaß. Diese Marke war für ihn im wirtschaftlichen Sinn wie ein Kind, für dessen Wohlergehen er sich verantwortlich fühlte. Und dieses Kind war mit 13 Jahren, wenn man so will, mitten in der Pubertät, von außen als »Totalversager« abgestempelt worden. Das konnte Josef Dygruber so auf keinen Fall stehen lassen.
Zeitensprung: Am 24. Oktober 2019 bestieg der claro-Chef in Salzburg ein Flugzeug, um mit seinen Chemikern am Kongress der SEPAWA in Berlin teilzunehmen, der 1954 in Ludwigshafen am Rhein gegründeten Vereinigung der Seifensieder, Parfümeure und Waschmittelfachleute. Hier trifft sich jedes Jahr alles, was in diesem Metier Rang und Namen hat. Aber leicht nervös war Dygruber aus einem anderen Grund. Wieder einmal stand nämlich das Jahreszeugnis der Warentester an, und nach der Landung steuerte er deshalb unverzüglich noch am Flughafen den nächsten Zeitungskiosk an, um das neue Magazin von Stiftung Warentest zu erwerben. Erwartungsvoll blätterte er sich bis zu Seite 63 durch, und da stand es dann in fetten Lettern:
»Alles Claro.«
Was Josef Dygruber seinem inzwischen bereits in Rente gegangenen Chemiker Erich Fabianitsch im Februar 2008 mehr aus Verzweiflung und Mitgefühl, denn aus Überzeugung versprochen hatte, war nun tatsächlich wahr geworden. claro war Testsieger bei Stiftung Warentest, und wo noch elf Jahre zuvor »Flop« und »Totalversager« gestanden war, konnte man nun lesen: »Sauber spülen und zugleich die Umwelt schonen – das ermöglicht nur eins der 19 getesteten Pulver und Tabs. Sein Name: Claro Classic.« Eine riesige Schmach war nicht nur getilgt, sondern in einen Triumph umgewandelt. Der Verspottete aus der Eselsbank war zum gefeierten Klassenprimus mutiert.
Der Kiosk-Betreiber staunte nicht schlecht, als ihm der Kunde aus Österreich gleich noch zwei Magazine abkaufte und ihn dann auch noch bat, ein Handyfoto zu schießen. Diesen Moment wollte der claro





























