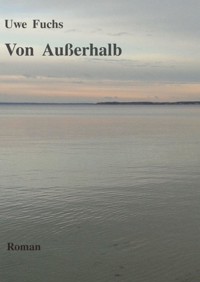
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schönhagen, ein kleines Dorf an der Ostsee. Gerade ist der 16-jährige Hauke mit der Mutter und dem jüngeren Bruder Henri hierhergezogen. Aus der Großstadt direkt in die Einöde - kann es etwas Schrecklicheres geben? Hauke ist total gefrustet, er will mit den "Bauerntölpeln" in seiner neuen Umgebung nichts zu tun haben. Aber alles kommt ganz anders: Er verliebt sich in Maren, ein Mädchen aus dem Dorf, und verbringt mit ihr die schönste Zeit seines Lebens. Auch die problematische Situation in der Familie verbessert sich – nicht zuletzt durch Klaus, den neuen Freund der Mutter. Dann zerbricht die Beziehung zwischen Hauke und Maren. Hauke, der die Trennung nicht verkraftet, driftet in eine Parallelwelt ab, verliert zusehends den Kontakt zur Wirklichkeit. Alles scheint auf eine Tragödie zuzulaufen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Von Außerhalb
Ebook
Fremde Welt
Also gut, zum Automaten. Filterzigaretten waren eigentlich viel zu teuer, aber wo sollte ich in diesem Nest am Samstagabend wohl Tabak kaufen, bitteschön?
Ich ging runter ins Erdgeschoss, nahm die Jacke vom Garderobenhaken. Als ich die Haustür aufmachte, schlug mir kühle, feuchte Luft entgegen. Im Schein der Straßenlaternen zeichnete sich Nebel ab. Plötzlich bekam ich wieder Muffe. Gab es denn keine andere Lösung? Konnte ich mir nicht einfach ein paar Zigaretten schnorren, von Klaus oder von Hartmann? Musste ich wirklich da raus?
„Stell dich nicht so an!“, schimpfte ich leise mit mir selbst. Ich atmete tief ein, als wollte ich tauchen. Dann stapfte ich entschlossen nach draußen und zog die Haustür hinter mir zu.
Stille.
Wo war der Straßenlärm, wo das Rauschen der Züge? Irgendwas musste doch zu hören sein. Vielleicht ein Flugzeug am Himmel? Stimmen? Schritte? Ich rührte mich nicht, atmete nur ganz flach, lauschte mit aller Aufmerksamkeit.
Aber da war tatsächlich nichts. Nur eine einzige, tiefe Ruhe, wie ich sie bisher noch nie erlebt hatte.
Ich stand in einer fremden Welt. Hinter mir der Reihenhausblock, gerade mal zwei Stockwerke hoch. Er zog sich bis zu Straßenecke hin. Zwischen ihm und der Straße ein Streifen mit Vorgärten. Die Blumenbeete waren fein säuberlich abgezirkelt und wirkten durch die umgegrabene Erde trotzdem irgendwie schmutzig, ländlich. Gegenüber eine Wiese, in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Links an der Ecke eine Handvoll Einfamilienhäuser. Kein Lebenszeichen drang aus ihnen, sämtliche Fenster waren dunkel. Es wirkte, als würden die Gebäude leerstehen.
Der Automat sei gleich an der Ecke, hatte Henri gesagt, keine zwanzig Meter entfernt. Ich spähte in die Dämmerung, konnte aber nichts erkennen. Das Gartentürchen quietschte beim Öffnen, das Holz des Sprossenzauns war feucht und glitschig. Zögernd betrat ich die Straße. Die Gehwegplatten waren gefegt, kein Streusand knirschte mehr unter den Schuhsohlen. Bis vor kurzem hatte er noch überall gelegen, aber nach und nach wurden die Straßen gesäubert. Tatsächlich hatten wir schon länger keinen Schnee mehr gehabt. Der Winter schien endlich vorbei zu sein. Aber von Frühling war auch noch nichts zu spüren, Sonne und Wärme ließen auf sich warten. Es war eine seltsame, unwirkliche Zwischenzeit.
Ich ließ den Block langsam an mir vorüberziehen. Die Häuser waren grün, gelb oder braun angestrichen, eins orange. Bis auf ihre Farbe sahen alle gleich aus. Links neben jeder Tür das große Küchenfenster, rechts davon die kleine Luke, die zur Toilette im Erdgeschoss gehörte. Im ersten Stock immer zwei gleichgroße Fenster nebeneinander. Auf einigen Treppensimsen standen Blumentöpfe, in denen aber nichts wuchs.
Eine aufgeräumte, wohlgeordnete Welt. Ich hatte hier nichts verloren, war ein totaler Fremdkörper. Auf einmal glaubte ich hinter den dunklen Fenstern überall Augenpaare zu erkennen, die mich feindselig musterten. Panik kroch in mir hoch, der Weg schien sich immer weiter auszudehnen, ins Endlose zu ziehen. Verdammt, wo blieb nur der Automat?
Ich wollte schon kapitulieren, auf dem Absatz kehrt machen, als ich ihn doch noch entdeckte: an der Außenwand des letzten Hauses. Man musste durch den Vorgarten gehen, um hinzukommen. Durfte man das überhaupt? Wer hatte bloß die bescheuerte Idee gehabt, einen Zigarettenautomaten auf ein Privatgrundstück zu setzen?
Wenigstens stand die Gartenpforte offen. Als ich zwischen den Blumenrabatten hindurchging, rechnete ich jeden Augenblick damit, dass ein Hund anschlug oder die Haustür aufgerissen wurde und jemand mich anbrüllte. Hastig zog ich eine Schachtel Marlboro und sah zu, dass ich wieder auf die Straße kam.
„Nur ruhig bleiben“, sagte ich mir beim Zurückgehen. Ich versuchte, langsam und konzentriert einen Fuß vor den anderen zu setzen. Aber schon wurde ich wieder schneller, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. Schließlich rannte ich fast. Was für eine Erleichterung, als ich endlich das Haus erreichte!
***
Ich hockte in meinem Sessel und starrte Löcher in die Luft. Die Zeit floss dahin, verrann, versickerte. Waren es Minuten? Stunden?
Der Arbeitslärm draußen auf dem Flur wollte einfach nicht aufhören. Henri, Klaus und Hartmann schleppten unermüdlich Möbel herauf. Wenn sie sperrige Teile durch den Treppenaufgang bugsieren mussten, riefen sie sich Kommandos zu. Nicht immer klappten ihre Manöver. Einmal rammten sie mit voller Wucht das hölzerne Treppengeländer – das Quietschen klang wie ein Schmerzensschrei.
Ich hatte nur so lange mitgeholfen, bis meine eigenen Sachen oben gewesen waren. Seitdem hörte mir von hier drinnen an, wie sie keuchten und schnauften. Hatte ich ein schlechtes Gewissen? Na, ein bisschen vielleicht.
Nachher sollte es gemeinsames Abendbrot geben. Dann würden sie über mich herfallen, ganz sicher. Ich glaubte, jetzt schon ihr Gemotze hören zu können: „Hauke, dieser faule Sack!“, „Das Schwein hat uns uns total hängenlassen!“ und so weiter. Egal! War es meine Idee gewesen, aus der Nordstadt wegzuziehen in ein beschissenes Kaff am Ende der Welt?
Zum x-ten Mal wanderte mein Blick durch diesen fremden Raum, der jetzt mein Zimmer sein sollte. Ein langgezogenes Rechteck, fast ein Schlauch. Ich saß an einer der Längsseiten, gleich neben der Tür. Neben mir ein Tischchen für Aschenbecher und Kippen, dann ein weiterer Sessel. Unter dem Fenster der Schreibtisch. Wenn man ihn nicht brauchte, konnte man ihn hochklappen. An der gegenüberliegenden Wand das Bettsofa, der Kleiderschrank und ein Regal.
Bis auf die Sitzecke, die Klaus mir vermacht hatte, waren alle Möbel frisch aus dem Einrichtungshaus. Mein altes Zimmer war eine Ansammlung von Sperrmüll gewesen: ein speckiger Sessel, ein durchgelegenes Bett, ein Schrank, der jeden Augenblick zusammenbrechen konnte, und so weiter. Früher hatte ich nie darüber nachgedacht, aber nun wunderte ich mich, wie ich es in dem ollen Plunder so lange ausgehalten hatte.
Die neuen Möbel waren ein Bestechungsversuch, ganz klar. Sie wollten mich dazu bringen, dass ich die Situation akzeptierte, die Nordstadt einfach hinter mir abhakte. Aber das würde ich niemals machen. Hieß ich etwa Henri? Dieser Trottel von Bruder war zuerst genauso gegen den Umzug gewesen wie ich. Aber kaum hatten sie ihm die neue Ausstattung versprochen, war er zum Gegner übergelaufen. Typisch!
Auch auf Hartmann war ich insgeheim sauer. So was nannte sich also Kumpel. Muttern und Klaus hatten ihn als Helfer geholt, gegen Bares. Schön und gut, aber musste man sich deshalb so reinhängen? Er knüppelte wie verrückt, gab alles. Offenbar wollte er den Job möglichst perfekt erledigen, das schien für ihn geradezu eine Frage der Ehre zu sein.
Ehre – von wegen! Einspannen ließ er sich von diesen Pappnasen, er machte gemeinsame Sache mit ihnen. Und morgen verdünnisierte er sich wieder in die Nordstadt, ließ mich hier allein. Dieser Verräter!
***
Die „Rockpalast“-Nacht fing an. Ich hatte den Fernsehton weggedreht, ließ die Musik über meine Anlage kommen. Die Sendung wurde parallel im Radio übertragen, in Stereo. Wenn bloß das Bild besser gewesen wäre! Ständig wurde es zu Schnee, alles Hin- und Herrücken der Zimmerantenne half nichts. Wahrscheinlich war man hier draußen zu weit ab vom Schuss für normalen Empfang.
Hartmann hing in seinem Sessel wie ein Toter. Der Umzug hatte ihm den Rest gegeben „Ohne ihn wären wir heute nicht fertig geworden“, hatte Klaus vorhin gesagt. „Hat geschuftet wie ein Tier.“ Na toll, dafür war er jetzt nicht mehr zu gebrauchen! Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch ein bisschen quatschen könnten, immerhin war dies unser letzter gemeinsamer Abend. Das konnte ich wohl vergessen.
Endlich – der große Moment: „The Who“ betraten die Bühne! Würden sie es noch bringen? Immerhin gingen sie stramm auf die 40 zu. Am Anfang klangen sie tatsächlich etwas lahm, aber je länger das Konzert dauerte, desto mehr kamen sie in Fahrt. Sie hatten es also noch drauf, die alten Recken! Bloß schade, dass Keith Moon nicht mehr dabei war. Kenney Jones war okay, aber er hatte einfach nicht dieselbe Power.
Hartmann sank schon wieder der Kopf auf die Brust. Vorhin war er noch total heiß auf das Konzert gewesen, und jetzt pennte er ständig ein. Zwischen seinen Fingern steckte eine Zigarette, die immer weiter runterbrannte. Gespannt wartete ich, dass sie ihm die Pfoten versengte. Geschah ihm ganz recht! Schließlich hatte ich Erbarmen. Ich nahm ihm den Glimmstängel weg, zog selbst noch ein paarmal dran und drückte ihn im Aschenbecher aus.
Es war ein komisches Gefühl, endlich im eigenen Zimmer rauchen zu dürfen. Aber das riss es auch nicht mehr raus. Gern wäre ich zum Qualmen weiterhin auf die Straße gegangen, wenn wir dafür in der Nordstadt geblieben wären.
Zu allem Unglück wurde heute Nacht auf Sommerzeit umgestellt. Sie klauten uns einfach eine Stunde. Das Alleinsein hier draußen, in der Fremde, würde noch früher beginnen. Bei diesem Gedanken spürte ich ein Würgen im Hals. Mir blieb regelrecht die Luft weg.
***
Jetzt war ich schon den dritten Tag hier. Seit meinem kurzen Ausflug zum Zigarettenautomaten am Samstag hatte ich keinen Fuß vor die Tür gesetzt. Am liebsten wäre ich gar nicht mehr rausgegangen, hätte mich ganz in meinem Zimmer eingeigelt. Aber das hätte auch nichts genützt. Selbst wenn ich in den Hungerstreik getreten wäre – Muttern hätte den Umzug niemals rückgängig gemacht. Eher wäre ich hier oben jämmerlich verreckt.
Hartmann, der Glückliche! Er war gestern mit Klaus in die Nordstadt zurückgefahren. Auf einmal lagen 60 Kilometer zwischen uns. Kurz mal bei ihm vorbeischauen, auf eine Zigarette, ein Bierchen – das ging nicht mehr. Wir kannten uns seit einer halben Ewigkeit, hatten so viel zusammen erlebt, und nun war er einfach weg. Da war bloß noch Leere, unbegreifliche Leere. Und endlose Langeweile. Robinson Crusoe konnte sich nicht mieser gefühlt haben als ich. Hauke Jansen auf seiner einsamen Insel.
Ich spürte eine Mordswut in mir aufsteigen. Alles hatten sie mir weggenommen, regelrecht von mir abgeschnitten. Mein komplettes Leben war auf dem Müllhaufen gelandet. Diese Schweine! Am liebsten hätte ich geschrien, sämtlichen Frust aus mir herausgebrüllt.
Aber keiner hätte es gehört. Sie waren alle unterwegs. Muttern machte Einkäufe. Henri strolchte durch die Gegend. Und Klaus war arbeiten.
Klaus – erst hatte ich ihn im Verdacht gehabt, hinter der Idee mit dem Umzug zu stecken. Er wohnte ja selbst irgendwo in dieser Gegend, mit Frau und Kindern. Wenn er demnächst wie geplant geschieden war, wollte er ganz bei uns einziehen. So würde er es nicht weit zu seinen beiden Gören haben.
Muttern dagegen schwor hoch und heilig, dass der Hauskauf allein ihre Idee gewesen sei. Die Nordstadt hätte uns „kaputtgemacht“, meinte sie. Nur Hochhäuser und Beton. Überall besprühte Wände, eingeschlagene Scheiben, zerkloppte Sitzbänke, demolierte Spielplätze. Dann der ganze Müll, den die Leute einfach aus den Fenstern warfen. Kein Wunder bei all den Asis, Junkies, Säufern, Pennern. Sie hätte das nicht mehr nötig, behauptete sie, könne sich endlich was Besseres leisten. Na super! Und ich durfte jetzt hier sitzen und in der Nase bohren.
Sogar die Schule mussten Henri und ich wechseln, nach Ostern. Er war hier im Ort auf der Realschule angemeldet, ich sollte auf irgendein „Kreisgymnasium“ kommen, in Eckhorst, 30 Kilometer entfernt. Auf die tägliche Fahrerei freute ich mich jetzt schon.
Wenigstens hatten wir jetzt erst mal Ferien. Zwei Wochen Gnadenfrist, bevor es losging.
Nordstadt
Schulwechsel – das klang wie der totale Horror. In der Nordstadt gab's bloß das KBZ, sonst nichts. Genauer: das „Kurt-Schumacher-Bildungszentrum“. Alle waren sie dort gewesen, egal ob Gymmis, Real- oder Hauptschüler. Irgendwo im Keller existierte auch eine Sonderschule. Das Gebäude war ein regelrechtes Labyrinth, ein Monster aus Beton, Stahl, Plastik und Glas. Mehr als 3.000 Leute wuselten darin herum. Einige nannten unsere Schule bloß „KZ“.
Das war hart, aber es passte. Wer sich bei uns nicht knallhart durchsetzte, wurde früher oder später selbst plattgemacht. Die Lehrer hackten auf den Schülern rum, die Schüler revanchierten sich, indem sie die schwachen, gutmütigen Lehrer terrorisierten. Und auch unter den Schülern selbst herrschte permanenter Kriegszustand. Es war ein einziges Hauen und Stechen. Man musste unbedingt Verbündete finden, sich einer der bestehenden Gruppen anschließen, notfalls selbst eine gründen. Wer allein blieb, sah keine Sonne mehr.
Hartmann war das beste Beispiel. Keiner hatte ihn damals dabeihaben wollen. Er war für alle bloß ein Fußabtreter gewesen, ein Ventil, um Frust abzulassen. Regelrecht gequält hatten sie ihn. Wenn ich nicht angefangen hätte, ihn zu beschützen, wäre es ihm schlecht ergangen. Irgendwann hätten sie ihn endgültig fertiggemacht.
Wir hatten uns gleich in der Ersten kennengelernt. Mit unseren sieben Jahren waren wir die beiden Klassenältesten gewesen. Dass wir damals nebeneinander saßen, war aber reiner Zufall: Ich war erst ein paar Tage nach der offiziellen Einschulung ans KBZ und in die Klasse gekommen. Alle Sitzplätze waren da schon vergeben – außer der neben ihm.
Ich merkte ziemlich schnell, dass er eine komische Type war. Die ganze Zeit machte er Stress, gab keine Ruhe. Er hatte immer Panik, zu kurz zu kommen, übersehen zu werden, im Unterricht und auch in den Pausen. Wenn er nicht ganz vorn dabei war, nicht die erste Geige spielen durfte, drehte er durch. Warf Sachen durch die Gegend, trat gegen Stühle, kippte den Tisch um. Er musste festgehalten werden, bis es vorbei war. Manchmal bekam er Schreikrämpfe, dann stopfte ihm Frau Blank, unsere Lehrerin, kurzerhand einen Lappen in den Mund.
Seinen Eltern war es anscheinend egal, was er trieb. Mehr als einmal kam es vor, dass die Bullen Hartmann im Klassenzimmer ablieferten. Später erfuhr ich, dass seine Mutter schon frühmorgens zu ihrem Putzjob musste. Und sein Vater, der arbeitslos war, stand meistens erst mittags auf, weil er sich am Abend vorher die Hucke zugesoffen hatte. Niemand interessierte sich also für Hartmann und dessen jüngere Schwester Bettina. Kein Wunder, dass er ab und zu „vergaß“, zur Schule zu gehen, stattdessen lieber durch die Gegend stromerte.
Prügeln konnte er sich überhaupt nicht. Er verlor jede, wirklich jede Klopperei, sogar wenn es gegen Mädchen ging. Ein einziger gut gesetzter Schlag, und er knickte ein. Fing an zu heulen, rannte weg, alles mögliche. Obwohl er so eine komplette Null war, legte er sich ständig mit irgendwelchen Leuten an. Er kapierte einfach nicht, dass sie ihn bloß reizen, zur Weißglut bringen wollten. Jedes Mal sprang er auf ihre Verarsche an und wollte die Sache schließlich mit Fäusten regeln. Dann gab's Saures. Irgendwie stand ihm „Schlag mich!“ auf die Stirn geschrieben, und jeder, der die Gelegenheit hatte, machte von dieser Aufforderung Gebrauch.
Obwohl er im Grunde selbst schuld war, tat mir der Kerl leid. Seine Hitzköpfigkeit wurde gnadenlos ausgenutzt, alle Welt hackte auf ihm rum, sie schlugen und traten ihn, wo sie konnten – es war heftig. Halt typisch KBZ! Irgendwann hatte ich genug. Ich fing an, ihn zu verteidigen, zog den Ärger, den er sich ständig aufhalste, auf mich. Weil ich ziemlich schmächtig war, wurde ich oft unterschätzt. Dafür war ich schnell und hatte Stehvermögen. Ich konnte viel einstecken, geduldig auf meine Chance warten. Und die kam fast immer.
Als Gegenleistung für meine Schutzdienste nahm Hartmann mich nachmittags mit auf Tour. Anders als in der Schule hatte er in der Nordstadt jede Menge Kumpels. Viele waren älter als wir. Sie rauchten, hatten Waffen. Einige klauten wie die Raben in den Supermärkten und verhökerten ihre Ware untereinander – Klamotten, Werkzeug, technische Geräte. Bei einer Gruppe waren wir ziemlich oft. Ich hatte jedes Mal ziemliche Muffe, wenn wir hingingen, trotzdem kam ich immer wieder mit. Sie waren die Größten, jeder in der Nordstadt kannte ihre Namen. Da war Holgi, der inoffizielle Kopf der Bande. Er hatte schon öfters mit den Bullen zu tun gehabt, war sogar mal im Jugendknast gewesen. Wolkan konnte Karate und Kung-Fu. Manchmal machte er sich einen Spaß daraus, Leute auf die Matte zu legen, wenn sie ihm blöd kamen. Salami, der eigentlich Selim hieß, klaute ständig Mofas und kurvte damit rum, dabei war er erst zwölf. Der Härteste war Ramos. Er hatte eine echte Knarre, die er wie einen Schatz hütete. Einmal führte er sie uns vor. Das sei eine Polizeiwaffe, erklärte er, eine P6 von SIG Sauer. Und zum Beweis, dass er sich mit dem Ding auskannte, ließ er das Magazin herausspringen. Wir waren natürlich total beeindruckt.
Bei mir zu Hause war es ähnlich wie bei Hartmann: Keinen kümmerte es, womit ich den Tag verbrachte. Muttern arbeitete in der Nordstadt-Klinik. Sie kam erst spätabends oder nachts zurück, wenn Henri und ich schon in der Falle lagen. Ursprünglich hatte sie in der Klinik-Kantine angefangen, als ungelernte Kraft. Später war sie ins Büro gewechselt, hatte nebenbei einen Abschluss als Sekretärin gemacht. Auch danach hatte sie sich laufend weitergebildet und war immer höher aufgestiegen. Mittlerweile lief in der Nordstadt-Klinik nichts mehr ohne sie. Dafür musste sie aber endlos Überstunden schieben.
Vaddern machte einen Deppen-Job auf der Werft, überwachte dort irgendwelche Maschinen. Abends genehmigte er sich gern noch ein Schlückchen in der „Schwarzen Hand“, einer berüchtigten Spelunke am Einkaufszentrum, in der so manches Monatsgehalt komplett versoffen wurde. Wenn er nach Hause kam, natürlich jedes Mal völlig blau, kriegte er meistens seinen Moralischen. Die halbe Nacht saß er in der Küche und jammerte rum. Wie mies der Job sei, dass er die Schnauze voll hätte, ohne uns längst abgehauen wäre und solche Sachen. Zwischendurch hörte man ihn in die Spüle kotzen.
Am Anfang hatte Muttern immer versucht, ihn zu beruhigen und zu trösten. Aber irgendwann war ihr der Geduldsfaden gerissen. Seitdem gab sie Contra, wenn Vaddern in der Küche seine nächtliche Show abzog. Manchmal klatschte es auch laut. War ihr da die Hand ausgerutscht? Ich wollte es gar nicht so genau wissen, wollte am liebsten von dem ganzen Elend nichts sehen und hören. Keine Ahnung, wie ich es immer schaffte, wieder einzupennen.
Mitleid war es nicht, was ich Vaddern gegenüber empfand. Eher Fassungslosigkeit und Ekel, dass man so runterkommen konnte. Aber eigentlich war mir der Typ egal. Er war sowieso bloß unser Stiefvater. Der Richtige hatte vor Ewigkeiten die Biege gemacht, ich konnte mich kaum noch an ihn erinnern. Muttern hatte dann schnell wieder geheiratet, seitdem gab es halt Vaddern und sonst nichts.
Genau genommen hatten wir sogar Glück mit ihm gehabt. Wenigstens prügelte und randalierte er nicht, wie so viele andere in der Nordstadt. Höppner im zehnten Stock zum Beispiel flippte fast jeden Abend aus. Pausenlos hörte man es von oben scheppern und klirren, dazwischen kreischte die Frau unverständliches Zeugs. Eric, der Sohn, hatte ständig geschwollene Lippen und Veilchen. Es hieß sogar, dass Höppner es mit seiner Tochter trieb. Dann lieber eine Flasche wie Vaddern.
So wuchsen Henri und ich fast wie Waisenkinder auf. Wir mussten selbst sehen, wie wir klarkamen, aber dafür hatten wir auch alle Freiheiten: Abends blieben wir endlos lange draußen, wir schauten fern bis zum Abwinken, gingen pennen, wann wir Bock hatten. Unsere Hausaufgaben wurden nie kontrolliert, die Zeugnisse ungeprüft unterschrieben. Bloß sitzenbleiben war tabu.
Und ich konnte jeden Nachmittag mit Hartmann losziehen, ohne dämliche Fragen befürchten zu müssen. Die Treffen mit ihm, die Besuche bei Holgis Clique – das alles war mir bald wichtiger als jede Scheiß-Familie. Holgi und seine Leute waren schlicht die Größten. So wie sie wollten Hartmann und ich später auch werden. Ach was, noch viel schlimmer! Unsere eigene Gang würde die berühmteste und gefährlichste sein, die es in der Nordstadt je gegeben hatte. Die Leute würden sich unsere Namen nur zuflüstern, aus Angst, weil wir so berüchtigt waren, aber auch aus Ehrfurcht, weil sie uns bewunderten.
Es machte Spaß, sich mit Hartmann solche Geschichten auszudenken. Obwohl ich insgeheim natürlich wusste, dass sie ein Traum bleiben würden. Hartmann und gefährlich – wie sollte das wohl zusammengehen? „Hartmann“ – schon dieser Name stand im Grunde für einen schlechten Scherz. Aber darüber dachte ich nicht nach.
Nach der Vierten musste er auf die Hauptschule. Eigentlich wollten sie mich auch dorthin schicken, aber Herr Weber, unser Lehrer für Schreiben und Lesen, setzte sich dafür ein, dass ich aufs Gymnasium kam. Auf einmal waren Hartmann und die anderen Kumpels weit weg. Wenn ich zu ihnen wollte, musste ich erst mal zehn Minuten quer durch das riesige Gebäude laufen. Ich besuchte sie zwar, wann immer es ging, aber es war nicht mehr dasselbe wie früher. Wenn wir quatschten, konnte ich oft nicht folgen. Ich hatte die Namen der Leute, um die es ging, nie gehört, kannte die Lehrer nicht, über die gelästert wurde. Auch nachmittags wurden die Treffen mit Hartmann nun seltener. Ohne es zu wollen verloren wir uns mehr und mehr aus den Augen.
Schließlich riss die Verbindung ab. Ich hörte rein gar nichts mehr von ihm, hätte nicht mal sagen können, ob er überhaupt noch in der Nordstadt wohnte.
***
Der fünfte Tag. Muttern, Henri und ich saßen beim Mittagessen. Es sollte von nun ab täglich eine gemeinsame Mahlzeit geben. So lange Muttern Urlaub hatte und zu Hause war, mittags, danach abends.
Bisher hatten Henri und ich immer in der Schulkantine gegessen. In den Ferien hatte Muttern uns Geld dagelassen, damit wir uns selbst was zum Beißen kauften. Meine Kohle war meistens für Süßigkeiten und Comics draufgegangen, später für Tabak.
Das Essen schmeckte eigentlich ganz gut. Koteletts mit Stampfkartoffeln und Gemüse. Ich hatte gar nicht gewusst, dass Muttern so gut kochen konnte.
„Willst du heute nicht mal raus?“, fragte sie, als ich mir gerade einen zweiten Berg Püree auf den Teller schaufelte. Ich warf ihr einen betont genervten Blick zu. Ging das schon wieder los? Was kümmerte es sie, dass ich bloß drinnen hockte? Wieso interessierte sie sich mit einem Mal dafür, was ich trieb? Ich wollte nicht, dass sie in mein Leben reinschnüffelte. Bisher war ich immer gut allein klargekommen.
Volle drei Wochen hatte sie sich freigenommen, um sich „mit uns zusammen einzuleben“, wie sie es ausdrückte. Drei Wochen – so lange am Stück war sie vorher nie zu Hause gewesen. Es war seltsam, dass sie jetzt immer um uns war.
Neulich hatte sie gemeint, ich solle versuchen, hier neue Freunde zu finden. „Freunde finden“ – wie das klang! So was erledigte man doch nicht wie Hausaufgaben! Entweder es ergab sich – oder eben nicht.
Ihre plötzliche Fürsorglichkeit wirkte auf mich total aufgesetzt. Ich war mir sicher, dass spätestens nach ihrem Urlaub alles werden würde wie vorher, in der Nordstadt.
„Geh doch mal mit Henri los“, schlug sie jetzt vor. „Der kennt hier schon Leute. Vielleicht kannst du dich da ja anschließen.“
Vor Schreck blieb mir glatt das Essen im Hals stecken. Mit Henri losgehen? Diesem Riesenbaby? Ich bekam einen derben Hustenanfall.
Henri sah aus, als wäre er gerade zehn geworden. In Wirklichkeit war er 15, also bloß ein Jahr jünger als ich. Wir waren sogar zusammen eingeschult worden – zum Glück in unterschiedliche Klassen. Inzwischen ging er eine Jahrgangsstufe tiefer, weil er in der Siebten sitzen geblieben war.
In der Nordstadt hatte er sich nachmittags immer mit Jüngeren herumgetrieben. Dort war er natürlich der Big Boss gewesen, der alle nach Herzenslust herumkommandierte. Wer nicht parierte, bekam Kloppe oder flog ganz raus. „Henri und seine Minirocker“ nannte man sie überall. Oder auch „die Müllmänner“, weil sie immer in die Müllcontainer der umliegenden Wohnblöcke stiegen. Es hieß, sie hätten sich da drinnen regelrechte Höhlensysteme angelegt, in denen sie hausten, ähnlich wie die ganzen Penner und Obdachlosen, die in der Nordstadt rumliefen.
Und mit so einem Idioten sollte ich jetzt losgehen? Nicht zu fassen, dass Muttern mir das ernsthaft vorschlug! Sie nahm mich anscheinend nicht für voll, hielt mich noch immer für den kleinen Jungen aus Grundschulzeiten.
Aber damit war es lange vorbei.
***
In der Achten waren die ganzen Sitzenbleiber in meine Klasse gekommen, Dominik, Thorsten, Gerhard, Zucki und so weiter. Mit einem Schlag wurde alles anders. Keine Spur mehr von der drögen Langeweile in der Schule, wie bisher. Die Neuen waren älter, selbstbewusster und irgendwie cooler. Schnell entstand eine Clique um sie herum. Unser verbindendes Element war das Rauchen. Es unterschied uns von den anderen, den Strebern und Schnarchnasen. In den Pausen verdrückten wir uns immer zusammen vom Schulgelände, um eine zu qualmen. Ab und zu zogen wir auch eine Tüte durch.
Nach den letzten Sommerferien kamen noch mehr Leute zu uns, die eine Ehrenrunde drehen mussten. Jetzt war endgültig Party angesagt. Wir machten uns einen Spaß daraus, den Unterricht regelrecht zu sabotieren, alles im Chaos versinken zu lassen. Von den Scheiß-Lehrern ließen wir uns gar nichts mehr sagen, die kriegten nur Druck. Manchmal schafften wir es, dass sie heulend rausliefen. Das feierten wir immer wie einen Sieg.
Auch in der Nordstadt herrschte seit einiger Zeit Aufbruchstimmung. Überall bildeten sich Cliquen, formierten sich um, lösten sich wieder auf. Alles war ständig in Bewegung. Der Treffpunkt ergab sich immer zufällig: eine Sitzbank, ein Spielplatz in der näheren Umgebung – was sich gerade anbot. Man hockte zusammen, quatschte, alberte rum. Wenn man Bock hatte, drehte man eine Runde, zeigte sich unter den Leuten.
Ich gehörte nirgends fest dazu, war bald hier dabei, bald dort. Aber genauso wollte ich es. Wenn man unabhängig blieb, bekam man besser mit, was im Viertel lief.
Eines Nachmittags saß ich mit einigen Kumpels bei mir vor der Haustür herum. Piet war dabei, ein Typ aus dem Nachbarblock, der schon als Knirps die Keller der Gegend aufgebrochen hatte. Und Marcel, der in meine Parallelklasse ging. Wie so viele vom KBZ-Gymnasium wohnte er nicht direkt in der Nordstadt, sondern in der Jahn-Siedlung, einem angrenzenden Stadtteil. Die Leute von dort galten eigentlich als Schnösel, mit denen sich keiner abgab, aber Marcel war eine Ausnahme. Er schimpfte am lautesten von allen über sein Viertel, nannte es immer „Bonzennest“, wollte es am liebsten abfackeln und so weiter. Auch sonst gab er sich extra hart. Zum Beispiel kannte ich niemanden, der so viel klaute wie er.
Wir saßen also bei mir vor der Haustür und laberten. Zum x-ten Mal musste Marcel eine Schachtel Camels herumreichen und uns versorgen. Sie war Teil seines letzten Raubzuges: Zehn Stangen Zigaretten hatte er aus dem Edeka-Markt rausgetragen. Wie, das blieb sein Geheimnis.
„Nachher besucht uns noch ein alter Bekannter“, meinte Piet beiläufig. Ich dachte mir nichts dabei und fragte nicht weiter nach. Irgendwann sah ich aus den Augenwinkeln einen Typen auf uns zusteuern. Ich hatte das Gefühl, ihn zu kennen, aber der Groschen wollte und wollte nicht fallen. Erst als der Kerl sich direkt vor uns aufbaute, kam mir die Erleuchtung: Es war Hartmann. Und war es doch nicht. Unglaublich, wie er sich verändert hatte! Das Haar hing ihm lang und verfilzt auf die Schultern herab. Über der Lippe und am Kinn spross dichter, rötlicher Bartflaum. Sein Gesicht war kantig und knochig geworden, es zeigte keine Spur mehr von der alten Gutmütigkeit, die den ständigen Schlägen getrotzt hatte. Dazu dieser Blick – etwas Berechnendes, fast Heimtückisches lag in ihm, das mir unwillkürlich Respekt einflößte.
Wir quatschten über harmlose Sachen. Was gerade abging in der Nordstadt, wie cool es früher gewesen war und ähnliches. Es war wie ein vorsichtiges gegenseitiges Abtasten. An diesen neuen, fremden Hartmann musste ich mich erst gewöhnen. Er und Piet gingen seit kurzem in eine Klasse. Piet hatte ihm erzählt, dass wir heute hier abhängen würden, und Hartmann hatte sofort zugesagt, vorbeizukommen.
Diese erste Begegnung dauerte nicht lange, aber von nun an traf ich Hartmann wieder häufiger. Mit dem Looser und Prügelknaben aus der Grundschule hatte er keine Ähnlichkeit mehr. Er wirkte abgehärtet, gestählt. Man hatte das Gefühl, ihm besser nicht blöd zu kommen. Die alten Sticheleien und Witzchen, mit denen wir ihn früher immer aufgezogen hatten, ließen wir jetzt lieber bleiben. Auf einmal hatten wir ein bisschen Muffe vor ihm.
Zu recht, wie sich bald zeigte. Eines Nachmittags gingen wir gemeinsam runter zum Einkaufszentrum, um Bier zu holen. Auf der niedrigen Betonmauer neben dem Eingang trafen sich oft Alkis zum Saufen. Auch heute lungerte dort ein Typ rum. Etwas älter, stämmig gebaut, Bierdose in der Hand, schon ordentlich einen im Kahn. Als wir vorbeigingen, laberte er uns blöd an. Früher wäre Hartmann bei dieser Sorte sofort abgehauen. Jetzt machte er halt und guckte neugierig, fast provozierend.
„Was gibt's, Milchgesicht?“, brüllte der Säufer, „ist das hier'n Zoo, oder was?“ Er stand auf, warf die halbvolle Dose in die Ecke. Bierschaum spritzte durch die Gegend. Der Platz vorm Supermarkt war mit einem Mal wie leergefegt. Piet nickte mir beschwörend zu. Ich verstand und wollte Hartmann am Ärmel packen, ihn in den Laden ziehen. Notfalls dem Besoffenen irgendwas Lustiges zurufen, zur Besänftigung. Aber der Typ holte bereits aus. Scheiße, dachte ich, das geht nicht gut.
Hartmann, der den Schlag längst erwartet hatte, sprang zur Seite. Die Faust rauschte weit an ihm vorbei, fast meinte ich den Luftzug zu spüren. Der nächste Schlag kam, und wieder wich Hartmann problemlos aus. Das wiederholte sich noch ein paarmal. Hartmann hatte zu tänzeln angefangen, wie ein Boxer. Der Säufer war inzwischen stark am Keuchen.
Urplötzlich knipste Hartmann sein Grinsen aus wie eine Lampe und schlug selbst zu. Fast ohne Ansatz, genau auf die Nase. Es klatschte laut. Der Typ ging nach unten, hielt sich mit beiden Händen den Zinken. Hartmann packte ihn an den Ohren und rammte ihm mit voller Wucht das Knie in die Fresse. Der Alki taumelte, fiel, knallte mit dem Hinterkopf gegen die Betonbrüstung. Gerade wollte er sich berappeln, als Hartmann zutrat, mit der Stiefelspitze mitten ins Gesicht. Und noch mal, immer und immer wieder. Ich sah das Blut, den Körper, wie er sich zusammenkrümmte, beim nächsten Tritt wieder zurückflog, hörte das Stöhnen und Jammern. Schließlich packte ich Hartmann an der Schulter, um ihn wegzuziehen.
Er drehte sich zu mir. Sein Gesicht war völlig bleich. Um seine Augenhöhlen hatten sich Schatten gebildet, zwischen den Brauen lag eine tiefe Falte. Er schien mich nicht zu erkennen, ich bekam unwillkürlich Schiss...
Aber schon hellte sich sein Blick wieder auf. Die Farbe kehrte in sein Gesicht zurück, das unheimliche Glimmen in den Augen verschwand. Piet und ich nahmen ihn zwischen uns. Wir mussten sehen, dass wir die Biege machten, bevor es Ärger gab. Um den Alki würde sich schon jemand kümmern. War nicht das erste Mal, dass da einer vorm Eingang lag.
Noch tagelang war ich wie geplättet von Hartmanns Aktion. Hatte er in der Zwischenzeit Karate gelernt, oder wie? Alles hatte wie programmiert gewirkt. Jede Bewegung einstudiert und tausendmal geübt, nichts dem Zufall überlassen. Wie eine Maschine. Nur am Schluss, da war ihm die Sicherung durchgebrannt.
Von Piet erfuhr ich, dass er eine ganze Weile komplett von der Bildfläche verschwunden war. Aber wo genau er abgeblieben war und was er in dieser Zeit getrieben hatte, wusste niemand. Hartmann selbst schwieg sich darüber aus. Sobald man ihn auf das Thema ansprach, wurde er wortkarg und abweisend. Es war offensichtlich, dass er nicht darüber quatschen wollte.
Die Story mit dem Alki verbreitete sich in der Nordstadt wie ein Lauffeuer. Mit einem Schlag war Hartmann anerkannt. Mehr noch: Er war jetzt eine Persönlichkeit, von der alle mit Ehrfurcht sprachen. „Hartmann“ – auf einmal passte dieser Name wie die Faust aufs Auge.
In einem Punkt hatte sich er allerdings überhaupt nicht verändert: Er war noch immer der totale Vorweggeher und Klarmacher. Wusste diverse günstige Quellen für Kippen, Bier und Dope. Kannte sämtliche wichtigen Leute – Dealer, Waffenhändler, Schläger, die Bosse der großen Cliquen. Und das, obwohl er so lange weg vom Fenster gewesen war. Ich hatte eigentlich gedacht, „drin“ zu sein, zu wissen, was bei uns geht. Hartmann belehrte mich eines Besseren. Wieder mal war er es, durch den ich unser Viertel erst richtig kennenlernte.
***
Das Essen war vorbei, ich hatte mich wieder nach oben verzogen. Träge saß ich in meinem Sessel, rauchte Kette und starrte aus dem Fenster.
Draußen goss es gerade mal wieder wie aus Eimern. Das ruhige, milde Wetter vom Wochenende hatte sich nicht gehalten. Ein Schauer nach dem anderen kam herab, und heftige Windböen zerrten am Hausdach, ließen es knarren und knacken. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es irgendwann weggeflogen wäre. Zwischendurch verwandelten sich die Tropfen schlagartig in weiße Flocken, ein regelrechtes Schneegestöber entstand.
Hatte ich es doch geahnt, dass der Winter noch nicht ausgestanden war! Er kam immer wieder, war einfach nicht totzukriegen. Mittlerweile konnte ich mich kaum daran erinnern, dass es noch etwas anderes gab außer Kälte, Sturm und Schnee.
Am Freitag würde ich mit Muttern nach Eckhorst fahren. Irgendwelche Formalitäten für meine Einschulung mussten noch geregelt werden. Wie würde es nach den Osterferien wohl werden? War die neue Schule komplett anders als das KBZ? Oder würde ich den Wechsel locker meistern?
Eigentlich war für Schönhagen eine ganz andere Schule zuständig, die sich in einem Ort namens Schmölln befand. Aber der Schulbus dorthin brauchte wohl ewig lange, weil er unterwegs sämtliche Dörfer abklapperte. Das wollte Muttern mir ersparen. Eckhorst lag auf ihrem Weg zur Arbeit, eine halbe Autostunde von hier weg. Sie würde mich morgens mitnehmen und unterwegs absetzen. Zurück sollte ich den Linienbus nehmen. Das war sicher alles gut durchdacht, trotzdem klang es kompliziert und nervig. In der Nordstadt war ich zu Fuß zur Schule gegangen, gerade mal zehn Minuten hatte das gedauert.
Einen dämlicheren Zeitpunkt zum Umziehen hätte Muttern sich gar nicht aussuchen können! Im letzten Halbjahr war ich schulmäßig derbe abgestürzt, hatte ein katastrophales Zeugnis eingefahren. Ein Riesengeschrei war losgebrochen, die Pauker hatten sogar damit gedroht, mich auf die Realschule zu entsorgen. Eigentlich ließ ich mir von denen gar nichts sagen, aber mit dieser Ankündigung hatten sie mich auf dem falschen Fuß erwischt. Bei uns mochte es beschissen gewesen sein, aber lange nicht so schlimm wie auf der Haupt- und Realschule. Plötzlich war mir mulmig geworden. Ich hatte mich zusammengerissen und versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Mit Erfolg: Inzwischen sah es längst nicht mehr so übel aus wie im Winter. Vielleicht hätte es mit der Versetzung nun doch noch geklappt.
Und ausgerechnet jetzt sollte ich auf eine neue Schule wechseln, wo ich niemanden kannte, völlig neue Lehrer bekam. Wie sollte das wohl funktionieren? Es war, als hätte mir jemand in vollem Lauf ein Bein gestellt.
Wie bisher jeden Tag würde ich bis zum Abendbrot hier sitzen bleiben. Und nach dem Essen wieder so lange fernsehen, bis ich vor der Glotze einschlief. Morgen ging dann alles von Neuem los.
Vielleicht würde ich nachher mal bei Hartmann anrufen. Über Ostern wollte ich ihn in der Nordstadt besuchen. Ostern – das waren noch zweieinhalb Wochen! Wie sollte ich die bloß rumbringen?
***
Hartmann und ich – die erste Begegnung vor der Haustür lag noch nicht lange zurück, da trafen wir uns wieder jeden Nachmittag. Manchmal kam auch Piet mit. Es war ein bisschen wie früher, zu Grundschulzeiten: Wir streiften durchs Viertel, besuchten die verschiedenen Cliquen, hingen mit den Leuten ab.
Am liebsten gingen wir runter zur „Bahnschiene“. So wurde allgemein die Strecke der Hafenbahn genannt, die hinter der Nordstadt verlief. Vormittags kam hier ein Zug nach dem anderen und brachte Kohlen zum Kraftwerk am Kanal. Nachmittags hörte das auf, dann war die Schiene unser Reich. Hier konnten wir machen, worauf wir Bock hatten: Rauchen, Saufen, Kiffen. Niemand war da, der deshalb Stress machte, die Bullen rief oder so. Kein Erwachsener verirrte sich jemals hierher.
Zuerst latschten wir immer ein Stückchen. Der Trippelschritt über die Holzschwellen war uns längst in Fleisch und Blut übergegangen. Schließlich setzten wir uns irgendwo hin, zogen eine Tüte durch, machten uns ein Bier auf. Es war total entspannt. Oft trafen wir Leute, die ebenfalls hier draußen herumstreunten.
Wenn wir Lust hatten, erkundeten wir das alte Militärgelände jenseits der Schiene. Es war nach dem Krieg aufgegeben worden, und längst hatte sich die Natur das Gebiet zurückerobert. Neben diversen gesprengten Bunkern gab es hier überall wilde Müllkippen. Die Leute schleppten ihr altes Zeugs anscheinend lieber hierher, als es ordnungsgemäß zu entsorgen. Uns sollte das nur recht sein: Wir schichteten regelrechte Gebirge aus Sperrmüll, Plastik, Kartons auf und zündeten sie an. Wenn die Flammen am höchsten loderten, warfen wir alte Spraydosen hinein und warteten in sicherem Abstand, dass sie explodierten.
Manchmal schlugen wir uns bis zum Kanalufer durch. An einem ehemaligen Hafen standen noch immer ein paar rostige Wracks herum, irgendwelche alten Tank- und Versorgungsschiffe. Wir kletterten in die stählernen Schiffsrümpfe und Steuerhäuser und suchten nach verwertbaren Gegenständen. Natürlich immer erfolglos, weil alles längst ausgeschlachtet war.
Das Gelände hinter der Bahnschiene war auch der ideale Platz für unsere Schießübungen. Wir hatten mittlerweile eine eigene Knarre, eine Walther TPH. Hartmann hatte sie besorgt, über irgendwelche Kanäle, die nur ihm bekannt waren. Für die Munition hatten wir zusammengelegt. Wir zielten auf Dosen und Flaschen, Hartmann und Piet manchmal auch auf Ratten und Kaninchen. Aber die verfehlten sie meistens. Überhaupt blieben wir alle ziemlich miserable Schützen.
Eines Tages fanden wir inmitten des Schienengeländes einen Platz, der uns gefiel. Wir schleppten zwei Sofas und einen Couchtisch von der nächsten Müllkippe heran, stellten die Sachen zusammen und hatten ein Wohnzimmer unter freiem Himmel. Sogar einen alten Kanonenofen trieben wir auf, für die Abende, die noch immer recht frisch waren. Aus Mangel an Kohlen heizten wir ihn mit Pappe und Müll. Leider war immer alles im Nu heruntergebrannt und die heimelige Wärme, die sich einen Moment lang ausgebreitet hatte, schnell wieder verflogen.
Aber bald brauchten wir keinen Ofen mehr. Der Sommer kam, und er wurde bombastisch. Wochenlang nur blauer Himmel und Affenhitze. Wer konnte, haute ab ins Gelände hinter der Bahnschiene. Unsere Sitzecke entwickelte sich nun zu einem zentralen Treffpunkt. Bald lief die halbe Nordstadt hier auf. Selbst Leute, die man sonst nur selten traf, die total ihr eigenes Ding machten, kamen plötzlich bei uns angetapert.
Zum Beispiel die Mitglieder der Bunker-Clique. Der Name spielte auf ihre Unterkunft an – sie hatten sich einen der alten Bunker hergerichtet, von denen es hinter der Bahnschiene so viele gab. Ihrer sollte angeblich besonders gut erhalten sein. Aber Genaueres ließ sich nur schwer in Erfahrung bringen, denn bisher war kaum jemand dort gewesen. Die Bunker-Leute achteten peinlich genau darauf, wer bei ihnen ein- und ausging.
Aus gutem Grund: In der Nordstadt gab es eigentlich gar keine festen Gruppen oder Versammlungsorte. Cliquen entstanden zufällig und liefen bald wieder auseinander. Man traf sich, wo es gerade passte. Alles Dauerhafte wurde früher oder später plattgemacht, von Chaoten und anderen Leuten, die Dampf ablassen wollten. Das Jugendheim der Arbeiterwohlfahrt hinterm Einkaufszentrum war das beste Beispiel. Immer wieder wurde dort alles kurz und klein geschlagen. Etwas Festes aufzubauen machte in der Nordstadt keinen Sinn.
Die Leute aus der Bunker-Clique waren die Einzigen, die diese Regel ignorierten. Sie hatten einen festen Treff, und man musste Mitglied bei ihnen werden. „Der Bunker“ – jeder im Viertel sprach diese Worte mit Ehrfurcht aus. Etwas Legendenumwobenes, geradezu Mystisches haftete ihnen an. Als sei damit ein geheimer Zirkel gemeint, dessen Angehörige nur ihren eigenen Gesetzen gehorchten. Und irgendwie stimmte es ja auch.
Wir waren natürlich stolz wie Oskar, dass sie sich jetzt ausgerechnet in unserer Sitzecke trafen. Klar, es lag es vor allem am Wetter. Aber sie hätten sich ja auch einen eigenen Treffpunkt im Freien einrichten können. Stattdessen kamen sie zu uns – es war einfach der Hammer!
Dass sie uns im Herbst, als das tolle Wetter vorbei war, Asyl in ihrem Bunker anbieten würden, hätten wir allerdings nicht erwartet. Es sollte eine Gegenleistung für unsere Gastfreundschaft im Sommer sein. Ein Jahr vorher hätte ich das Angebot möglicherweise ausgeschlagen, um unabhängig zu bleiben. Aber jetzt lockte mich die Aussicht auf Wärme und ein Dach über dem Kopf. Die Regentage häuften sich, abends wurde es wieder arschkalt. Außerdem war es eine Ehre, von der Bunker-Clique aufgenommen zu werden. Alle in der Nordstadt wollten das, aber kaum jemand schaffte es. Das musste man einfach ausnutzen. Hartmann und Piet sahen es ähnlich wie ich.
Es kam also der Tag, da wir zum ersten Mal den berühmten Bunker betraten. Der Eingang lag hinter einem Labyrinth aus Trümmern und war selbst aus unmittelbarer Nähe kaum auszumachen. Drinnen sah es ein bisschen wie in einer Höhle aus. Durch die Sprengung war eine Art Tunnel entstanden, ungefähr zwei Meter breit und acht Meter tief. Die Bunkerleute hatten den Boden mit Holzpaletten ausgelegt und diese wiederum mit alten Teppichen abgedeckt. Am Rand lagen überall Matratzen. Und in jeder Ecke stand ein Ofen. Der Rauch wurde durch ein abenteuerliches Geflecht aus Rohren abgeleitet. Fenster gab es natürlich keine. Petroleumfunzeln sorgten für Licht, die auch tagsüber angezündet werden mussten. Im Sommer konnte man sich Schöneres vorstellen, als hier drinnen zu hocken. Aber jetzt, im Herbst, wirkte alles heimelig und urgemütlich.
Eine gute Zeit begann. Kein Herumlaufen bei Regen und Kälte mehr. Stattdessen jeden Nachmittag hierherkommen, auf die Matratzen fläzen, mit den Leuten quatschen. Es war total lustig. Und immer mollig warm, denn die Kanonenöfen taten gute Arbeit. Einige in der Clique waren regelrechte Experten in Sachen Heizen. Das Kohlenschleppen ging eigentlich reihum, aber ich schaffte es immer, mich zu drücken.
So ließ es sich aushalten. Dass wir früher die Winter immer draußen verbracht hatten, konnten wir uns bald nur noch schwer vorstellen.
***
Muttern wollte zum Einkaufen fahren, in einen Nachbarort namens Hoheneck. Ich sollte ihr helfen, sämtliche Proteste waren zwecklos. Ich musste also raus, ins Feindesland. Sechs Tage Stubenhocken gingen zu Ende.
Zum Glück dauerte die Autofahrt nicht lange. Der weitläufige Parkplatz vorm Supermarkt war so gut wie leer. Ich wunderte mich, warum es in dieser gottverlassenen Gegend einen so großen Laden gab. „Das ist hier eine Ferienregion“, erklärte Muttern. „Bald kommen die Urlauber. Die Geschäfte sind dann sogar sonntags offen. Und nach der Saison fällt alles wieder in den Winterschlaf. Viele Läden haben dann zwischen eins und drei zu.“
Drinnen teilten wir uns auf. Muttern wieselte mit dem Einkaufswagen durch den Markt, ich stand am Fleischtresen an. Der Fleischer war ein uriger Typ mit roter Nase, Händen wie Klosettdeckeln und einem gutmütigen Grinsen. Er kannte alle Kundinnen vor mir mit Namen, redete Platt mit ihnen. Als ich drankam, schaltete er auf Hochdeutsch um, nannte mich „Junger Mann“. Seine plötzliche Förmlichkeit störte mich, warum auch immer.
Danach gingen wir noch zum Bäcker neben dem Markt. Eine Kundin vor uns hatte zu wenig Geld dabei. Sie wühlte in ihrem Portemonnaie, kramte in ihrer Handtasche, durchsuchte ihren Mantel – nichts. Blöde Schnarchtante!, dachte ich genervt. Dann sah ich, wie die Verkäuferin ein kleines Heft hervorkramte, ein Oktavheft, wie man es für Vokabeln brauchte. Sie blätterte, kritzelte irgendwas rein und ließ die Frau gehen.
Ich war völlig verdattert. Anscheinend konnte man hier anschreiben lassen, ohne zu bezahlen! Wie gutgläubig waren diese Dorftrottel eigentlich? Glaubten die ernsthaft, dass sie jemals ihr Geld sehen würden? Das war ja besser als Klauen!
Wir fuhren wieder nach Hause. Gerade luden wir die Sachen aus dem Auto, als zwei Häuser weiter die Tür aufging. Ein Mädchen kam raus, ungefähr in meinem Alter, ziemlich brav, aber hübsch. Sie latschte in unsere Richtung. Mit ihrem dunklen, halblangen Haar und den fast schwarzen Augen wirkte sie ein bisschen südländisch. Ihre großen Möpse waren ziemlich am Wippen. Die ganze Zeit schaute sie uns an. „Hallo“, sagte sie, als sie mit uns auf gleicher Höhe war, und strahlte übers ganze Gesicht.
„Guten Tag“, grüßte meine Mutter zurück, ebenfalls sehr freundlich.
Dann war das Mädel vorbeigezogen. Ich stierte ihr hinterher, war völlig durcheinander. Einfach „Hallo“ zu sagen, als wären wir bereits alte Bekannte! Dazu dieses Grinsen! Und Muttern hatte auch noch zurück gegrüßt.
„Kanntest du die?“, fragte ich.
„Nein, aber bei den Nachbarn kann man doch mal höflich sein.“
Ich glotzte wohl ziemlich begriffsstutzig drein.
„So ist das hier eben“, sagte sie und lud weiter die Sachen aus.
Als wir fertig waren, ging ich wieder nach oben. Die Abendsonne spiegelte sich in den Fenstern des Nachbarblocks. Die Reflexion schien in mein Zimmer, ließ an der gegenüberliegenden Wand einen goldgelben Flecken entstehen. Im Lichtstrahl sah man Staubteilchen tanzen.
Immer wieder musste ich an die Begegnung vorm Haus denken, mit der Nachbarstochter. Die Kleine wollte mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Wie sie Muttern und mich angeschaut hatte, so... offen. Ohne jede Scheu oder gar Angst. Und dann dieses Lächeln...
Ich merkte, dass ich richtig durcheinander war.
***
In Sachen Mädchen war ich ein echter Spätzünder. Alle anderen hatten sich nach und nach eine Freundin zugelegt, nur ich war bis zuletzt allein rumgelaufen. Immer wenn sich mir ein weibliches Wesen näherte, hatte ich mir vor Angst fast in die Hose gemacht.
Diese verfluchte Schüchternheit! Dazu kam, dass ich leider beschissen aussah: Spargel-Tarzan, käsiges Gesicht, Pickeln. Und zu allem Unglück musste ich seit der Siebten eine Brille tragen. Ich setzte sie zwar nur in der Schule auf, während des Unterrichts, aber das blöde Teil gab meinem Selbstvertrauen endgültig den Rest. Welches Mädel wollte schon eine Brillenschlange als Freund?
Der Wind drehte sich erst in der Bunker-Clique. Ich kapierte, dass es vor allem eine Frage der Lautstärke war. Wenn man die Klappe weit genug aufriss, voll auf Angriff ging, funktionierte es prompt. Das Aussehen spielte dann überhaupt keine Rolle. Allerdings waren die Mädchen im Bunker anders als zum Beispiel in der Schule, nicht so kompliziert und eingebildet. Sie parierten, wenn man ihnen sagte, wo's langging. Bloß Schwäche durfte man nicht zeigen, das nutzten sie sofort aus. Man musste unbedingt die Oberhand behalten, der Boss bleiben. Aber das war leicht.
Als ich erst mal Blut geleckt hatte, legte ich voll los. Baggerte, knutschte, fummelte, was das Zeug hielt. Ich wollte möglichst schnell alles nachholen, was ich vorher verpasst hatte. Am Ende hatte ich außer Pimpern so ziemlich alles ausprobiert. Und fast sämtliche Mädchen abgearbeitet, die der Bunker und das Viertel hergaben. Jedenfalls bildete ich mir das ein. Und posaunte es überall herum.
Das schöne, sorgenfreie Cliquenleben – so hätte es von mir aus immer bleiben können. Leider ging dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Eines Nachmittags betrat ich den Bunker und fand dort das mieseste Gesocks versammelt, das die Nordstadt zu bieten hatte: Da saßen die Solterbeck-Brüder, zwei von der übelsten Sorte, neben ihnen Salami und Wladdi, also Wladimir. Weiter hinten erkannte ich Krause, Ramos und noch ein paar andere. Verdammt! Bei diesen Typen musste man mit allem rechnen. Wer denen in die Finger geriet, konnte sein Testament machen. Selbst Hartmann, der sonst alle Welt kannte, hielt sich von ihnen fern.
Salami und Ramos hatten ja früher zur alten Clique um Holgi gehört, aber mittlerweile waren die beiden völlig runtergekommen. Es war mir ein totales Rätsel, warum wir sie als kleine Pökse so bewundert hatten.
Sie fühlten sich bei uns schon ganz wie zu Hause: Lümmelten auf den Matratzen rum, bedienten sich an unserem Alk-Vorrat, ohne lange zu fragen. Unsere eigenen Leute saßen wie ein Häuflein Elend dazwischen. Obwohl wir eigentlich in der Überzahl waren, wagte es niemand, einen Muckser zu tun. Wir machten gute Miene zum bösen Spiel.
Nach zwei Stunden zogen sie geschlossen wieder ab. Allgemeines Aufatmen. Aber insgeheim wussten wir, dass die Sache nicht ausgestanden war. Und tatsächlich kamen sie paar Tage später wieder. Diesmal hatten sie ihren eigenen Stoff mitgebracht. Sie ließen sich volllaufen und fingen bald untereinander Streit an. Als Ramos und Wladdi aufeinander losgingen, machten wir die Biege. Von draußen hörten wir die Fetzen fliegen. Am nächsten Tag sah es im Bunker aus wie nach einer Explosion. Überall leere Flaschen und Scherben. Der Boden voller Matsch und Schmodder. Neben dem Ofen lag eine Machete mit blutiger Klinge. Auch auf einigen Matratzen sah man rote Blutflecken. Anscheinend waren sie mit Messern aufeinander losgegangen. Typisch! Es dauerte ewig, bis wir einigermaßen klar Schiff gemacht hatten.
Von nun an kamen sie fast täglich. Von uns dagegen traute sich kaum noch jemand in den Bunker. Wer hatte schon Bock, dort zwischen lauter Psychos zu sitzen und um sein Leben zu fürchten? Stattdessen trafen wir uns bei Bodo vor der Haustür. Beratschlagten, was man tun könnte, palaverten endlos rum. Die Leute aus der Kiffer-Fraktion waren partout gegen Gewalt. Sie meinten, die Sache müsse sich irgendwie friedlich lösen lassen. Hartmann, Bodo und ich dagegen waren uns sicher, dass es nur ein Mittel gab, um Typen wie die Solterbecks wieder loszuwerden: Schläge. So übel und schmerzhaft, dass sie sie niemals mehr vergessen würden. Obwohl das bei denen eine echte Herausforderung war. Trotzdem – alles andere brachte nichts. Wenn wir jetzt nicht knallhart durchgriffen, konnten wir den Bunker abschreiben.
Schließlich gelang es Bodo, alle vom Mitmachen zu überzeugen, inklusive der Kiffer. Wir rotteten uns in voller Truppenstärke vor der Haustür zusammen und warteten, bis es dunkel war. Dann stürmten wir den Bunker. Die Solterbeck-Leute hielten gerade mal wieder ein Besäufnis ab und waren so breit, dass sie sich kaum wehrten. Ralf, dessen Alter bei einem privaten Sicherheitsdienst arbeitete, hatte Schlagstöcke verteilt. Auch ich hatte einen ergattert. Im Bunker schlug ich damit um mich wie ein Berserker, zermatschte einigen Solterbeck-Leuten ordentlich die Fresse. Die Schlacht war schnell gewonnen, sie rannten wie die Hasen.
Wir postierten jetzt Wachen in der Umgebung des Bunkers. Und viele von uns waren bewaffnet, mit Messern, Schlagringen, Gaspistolen und Tschakus, für den Fall der Fälle. Aber Solterbecks und Co. hatten ihre Lektion offenbar gelernt: Sie tauchten nicht mehr in der Nähe des Bunkers auf.
Die Ruhe lullte uns ein, sodass wir den Wachdienst bald schleifen ließen. Die Strafe folgte auf dem Fuße: Irgendwann war der Bunker plötzlich voller Solterbeck-Leute, das Licht ging aus, und dann knallten mir auch schon irgendwelche Fäuste ins Gesicht. Ich konnte nur noch meinen Schädel mit den Armen schützen und den Rückzug antreten. Allen anderen ging es genauso. Diesmal waren wir es, die Hals über Kopf flüchteten.
Nach dieser miesen Attacke war es endgültig eine Frage der Ehre. Selbst die Pazifisten aus unserer Kiffer-Fraktion fanden, dass wir die Schmach unmöglich auf uns sitzen lassen konnten. Erneut sammelten wir uns bei Bodo, mitsamt unserem kompletten Waffenarsenal. Wir stellten sie, als sie gerade vom Einkaufszentrum runter zur Bahnschiene zogen. Es wurde die heftigste Keilerei, die ich bis dahin erlebt hatte. Alle bekamen ziemlich was ab, auch ich. Aber am Ende behielten wir die Oberhand. Wir mischten sie auf, machten sie fertig. Endgültig, wie wir hofften.
Und tatsächlich hatten wir nach dieser Aktion Ruhe. Zwar blieben wir misstrauisch, postierten erneut Wachen, behielten immer schön im Auge, wer den Bunker betrat, aber es tat sich nichts mehr. Sollten wir sie tatsächlich von ihrem Drang geheilt haben, sich bei uns einzunisten? So recht mochte ich dem Frieden nicht trauen.
An einem Sonntag im November stand Hartmann bei mir zu Hause vor der Tür: „Der Bunker ist abgefackelt“, meinte er nur. Ich griff mir meine Jacke, und wir gingen los. Schon von weitem konnte man die Bescherung sehen: rußgeschwärzter Beton über dem Eingang, überall die verkohlten Reste des Mobiliars. Dann der Blick nach drinnen: Nur ein schwarzes, nach Qualm stinkendes Loch war übriggeblieben.
Kemal und Piet schleppten leere Benzinkanister an, die sie in der Nähe gefunden hatten. Man konnte sich leicht ausmalen, was passiert war. Bei Nacht und Nebel hatten sie sich angeschlichen, drinnen alles mit Benzin übergossen und angezündet. Die Sachen mussten wie Zunder gebrannt haben. Ich war bloß erstaunt, dass sie diese Aktion überhaupt hinbekommen hatten. Anscheinend hatte ihnen der Alk das Hirn noch nicht völlig weggefressen.
Alle standen ratlos da. Bodo und Jönck erzählten, die Feuerwehrleute wären mit ihren Fahrzeugen im Gelände stecken geblieben. Sie hatten letztendlich die Brandstelle nur einkreisen und sichern können. Becky knipste eifrig Fotos. Er wollte sich an die lokalen Medien wenden. Naiver Trottel!, dachte ich. Die interessierte das doch einen Dreck.
Ich versuchte die ganze Zeit, wütend und enttäuscht zu sein, wie die anderen. Aber ich bekam es nicht hin. Auf einmal hatte ich das Gefühl, als ginge mich das alles nichts mehr an. Eigentlich hatte ich nie daran geglaubt, dass es mit dem Bunker auf Dauer klappen würde. Und jetzt war halt das passiert, was am Ende sowieso immer passierte: Die Alkis kamen und machten alles kaputt. So war der Lauf der Dinge, daran konnte man nichts ändern. Schließlich hatte ich keine Lust mehr, mit den anderen vor den verkohlten Trümmern rumzustehen und zu jammern. Ich drehte mich um, sagte „Tschüss“ und ging nach Hause.
Jetzt waren wir bloß noch eine Clique wie alle anderen, ohne Dach über dem Kopf, ohne irgendetwas, das uns zusammenhielt. Wir hingen bei Bodo vor der Haustür rum, zofften, stritten, machten uns an. Die Stimmung war einfach total beschissen. Manchmal überlegten wir, was Neues aufzuziehen. Uns zum Beispiel hinter der Bahnschiene eine Bude aus Holz zu bauen. Aber den Reden folgten nie Taten, unser Glaube an ein solches Projekt war dahin. Die Polizei ermittelte wegen Brandstiftung, einige von uns wurden als Zeugen vernommen. Natürlich blieb alles ohne Ergebnis.
Eines Nachmittags kam Grundmann mit einem dunkelroten Veilchen an. Zwei aus der Solterbeck-Gang hätten ihn nach der Schule in die Mangel genommen, berichtete er. Kurz darauf präsentierte uns Köpke einen derben Bluterguss in der Rippengegend und erzählte eine ähnliche Story.
Sie hatten uns also noch immer auf dem Kieker. Das mit dem Bunker genügte ihnen nicht, sie wollten Rache bis zuletzt. Aber anstatt die Sache offen auszutragen, verlegten sie sich anscheinend auf Guerilla-Taktik. Sie schlugen aus dem Dunklen zu und verschwanden dann wieder. Wie sollten wir uns dagegen wehren? Nur noch in Gruppen unterwegs sein? Völlig unmöglich! Wir wohnten in unterschiedlichen Gegenden der Nordstadt, gingen im KBZ auf verschiedene Schulzweige, hatten andere Stundenpläne.
Immer mehr unserer Leute bekamen jetzt ihr Fett weg, es ging Schlag auf Schlag. Schließlich erwischte es auch Bodo. Sie richteten ihn übel zu: Rippenbruch, Gehirnerschütterung, diverse Platzwunden im Gesicht. Ausgerechnet Bodo, einen unserer stärksten Leute!
Erst jetzt wurde uns klar, mit wem wir uns eigentlich angelegt hatten. Auf einmal hatte jeder nur noch Schiss um den eigenen Arsch. Die Leute blieben weg, unsere Clique schrumpfte von Tag zu Tag. Das Wetter tat das seinige, um die Auflösung zu beschleunigen: Erst regnete es pausenlos, dann kam der Schnee. Bei Bodo vor der Haustür fror ich jetzt immer wie ein Schneider, meine Füße waren nur noch Eisblöcke.
Die Solterbeck-Leute veranstalteten bald regelrechte Treibjagden auf uns. Am Anfang mochte es ihnen tatsächlich um so was wie Ehre gegangen sein, immerhin wir ihnen ordentlich was auf die Zwölf gegeben. Aber inzwischen wollten sie sich nur noch an unserer Angst weiden, daran zogen sie sich hoch. Diese Psychos! Einen nach dem anderen griffen sie sich, nahmen ihn in die Mangel. Eigentlich war es bloß eine Frage der Zeit, bis ich an die Reihe kommen würde. Und schließlich passierte es.
An diesem Abend herrschte dichtes Schneetreiben, die Straßen waren wie ausgestorben. Ich hatte bei Piet einen Film geguckt und ging gerade nach Hause. Mir war übel, mein Schädel dröhnte. Ich hätte besser nicht so viel trinken sollen.
Zunächst registrierte ich es gar nicht richtig, als ein paar Gestalten von der Seite herankamen und sich vor mir aufbauten. Erst im letzten Moment erkannte ich sie: Wladdi stand da, Salami, Kongo und noch ein paar andere. Es war, als hätte mir jemand einen kalten Lappen ins Gesicht geklatscht.
Hektisch suchte ich nach einer Fluchtmöglichkeit. Aber jetzt kamen sie von überall: aus Hauseingängen, Büschen, vom Spielplatz am Ende des Blocks. Sogar die verschneite Wiese hinter dem Edeka-Markt war auf einmal voller schwarzer Schatten, die sich uns näherten. An Abhauen war nicht mehr zu denken.
Ich hatte nur noch Angst, nackte Angst. Gleich würden sie mich zum Krüppel schlagen. Wahrscheinlich waren dies die letzten Momente, die ich gesund erlebte. Ich hätte am liebsten um Gnade gefleht.
Einen Augenblick lang geschah nichts, offenbar genossen sie den Überraschungseffekt. Dann trat jemand aus ihrem Kreis vor. Es war Kongo. Ich roch seine Alkoholfahne, den Rauch in seinen Klamotten. Aber er zögerte. Spürte er meine Angst? Wurde sie über meinen Blick, meine Haltung sichtbar, ohne dass ich es wollte? Seine Schläge kamen merkwürdig langsam, fast schwerfällig. Als hätte er Mitleid und würde nur seine Pflicht tun. Ich überlegte, wegzuspringen und ihm selbst ein paar reinzusemmeln. Aber das hätte alles nur noch schlimmer gemacht, deshalb hielt ich still, ließ es über mich ergehen. Ich spürte, wie meine Lippe aufplatzte, die Nase zu bluten anfing. Und hoffte mit jedem Schlag, dass es jetzt gut sein würde.
Meine Rechnung ging nicht auf. Als ich schon ziemlich benommen war, packten mich welche von hinten. Ich wurde zum Anlieferhof des Einkaufszentrums geschleppt, wo um diese Zeit niemand mehr war. Sie stellten mich vor das geschlossene Eisentor, und es ging in die nächste Runde. Mit jedem Schlag, den ich in die Fresse bekam, knallte ich gegen die Gitterstäbe. Sterne schienen vor meinen Augen zu explodierten, ganze Feuerwerke den Nachthimmel zu erhellen. Wenn mein Schädel wieder nach vorn sprang und ich ihnen entgegentaumelte, kamen die nächsten Schläge. Irgendwann ließen sie mich in den Schnee kippen. Wahrscheinlich bearbeiteten sie mich noch weiter, als ich lag, aber das bekam ich nicht mehr richtig mit.
Als ich die Augen aufmachte, sah ich Schneeflocken auf mich herabrieseln. Ich versuchte, hochzukommen, und erneut begann sich alles zu drehen. Irgendwann stand ich endlich. Das Blut lief mir wieder aus Nase und Mund, der Schnee vor mir begann sich rötlich zu sprenkeln. Ich griff in die kalte, weiße Masse, nahm eine Handvoll und schmierte sie mir ins Gesicht. Das half.
Zu Hause betrachtete ich mich im Badezimmerspiegel: Ein blaues Auge prangte in meinem Gesicht, meine Ober- und Unterlippe waren aufgeplatzt. Ich sah völlig zermatscht aus. Immerhin fehlte kein Zahn. Dafür hatte ich am ganzen Körper Blutergüsse. Und alles tat mir weh.
Muttern erzählte ich am nächsten Tag, dass ich in eine ehrliche Prügelei Mann gegen Mann verwickelt worden war. Zwar hätte ich dem Typen eine Abreibung verpasst, aber wo gehobelt wird, würden eben auch Späne fallen. Damit gab sie sich zufrieden. Ich durfte an diesem Tag sogar zu Hause bleiben, musste nicht in die Schule.
Die Schmerzen ließen bald nach. Ich hatte anscheinend keine ernsthaften Schäden davongetragen, jedenfalls keine körperlichen. Aber etwas war doch anders seit jener Nacht: Ich bekam nun immer regelrechte Panikattacken, wenn ich draußen unterwegs war. Glaubte Schatten zu sehen, die mich verfolgten, Gestalten, die mir ans Leder wollten. Ständig war ich auf der Hut, hielt mich versteckt, um nicht wieder leichte Beute zu werden. Ich versuchte, unübersichtliche Stellen zu meiden, hatte eine starke Abneigung gegen weite Flächen. Sämtliche Wege gerieten zur Qual. Irgendwie war bei mir der Faden gerissen, ich fühlte mich erschöpft und müde.
Hartmann meinte, ich solle das alles nicht so schwer nehmen, sonst würde ich bald weiße Mäuse sehen, wie die Alkis. Er steckte die Situation ziemlich locker weg, obwohl er selbst Kloppe bekommen hatte und auf der Hauptschule deutlich näher am Geschehen war. Stimmte es, was er sagte? War ich womöglich ein Schlappschwanz, zu weich für die Nordstadt?
Auch in Sachen Mädchen merkte ich, dass bei mir die Luft raus war. Der permanente Bagger-Ton, immer auf Anmache, auf Angriff – ich brachte das nicht mehr. Meine Schwäche wurde natürlich sofort ausgenutzt. Die Mädchen zogen alles, was ich sagte, gnadenlos durch den Kakao. Jeder Satz von mir erntete schallendes, geradezu hysterisches Gelächter. Sie fanden immer einen Anlass, mich zu verarschen, mich hochzunehmen. Und irgendwie konnte ich sie sogar verstehen. Ich hatte sie früher ziemlich mies behandelt. Eine nach der anderen hatte ich mir gegriffen und wieder fallengelassen, wenn sie mir über geworden war. Jetzt kam die Antwort, jetzt wurden alte Rechnungen beglichen.
Manchmal hätte ich am liebsten gerufen: „Kapitulation! Ihr habt gewonnen!“ Aber wie hätte das vor den anderen ausgesehen? Wohl oder übel musste ich mich zusammenreißen und Contra geben. Oder lieber ganz die Klappe halten. Bald stand ich nur noch in der Gegend rum, sagte nichts mehr. Ich wollte nicht wieder ein gefundenes Fressen für die Weiber werden.
***
Unter der Zimmerdecke hing dichter, blauer Qualm. Das war ein verdammt guter Spliff gewesen! Hartmann hatte mir das Dope dagelassen, als er Sonntag in die Nordstadt abgehauen war. Ich konnte bloß hoffen, dass der Dunst nicht durchs ganze Haus zog. Klaus wusste mit Sicherheit, wie ein Joint roch.
Aber anscheinend schliefen alle längst. Es war zwei Uhr durch, und seit Stunden herrschte absolute Ruhe. Von draußen war nicht mehr das kleinste Fleckchen Licht auszumachen. Selbst das Heulen in den Heizungsrohren hatte inzwischen aufgehört. Alles wirkte wie tot.
Es war komisch, so dazusitzen und zurückzublicken, die Vergangenheit abzuspulen wie einen Film. Früher hätte ich so was nie und nimmer gemacht, da hatte nur gezählt, was von vorn kam. Aber auf einmal schien ich einem Geheimnis auf der Spur zu sein, meinem Geheimnis. Ich durfte den Faden nicht verlieren, musste unbedingt dran bleiben...
***
Der Bunker war also abgefackelt. In der Nordstadt jagten uns die Solterbeck-Leute durch die Straßen, und wen sie erwischten, schlugen sie halbtot. Als wäre das alles nicht genug gewesen, kam es jetzt auch in der Schule zum großen Knall.
Jahrelang hatte ich mich am KBZ immer so durchgemogelt. Wozu sich den Arsch aufreißen für die Penne, die mit mir und meinem Leben nichts zu tun hatte? Und Muttern waren meine Zensuren eh wurscht gewesen, von Vaddern ganz zu schweigen. Also hatte ich zugesehen, dass es für die Versetzung langte, und mir ansonsten ein ruhiges Leben gemacht.




























