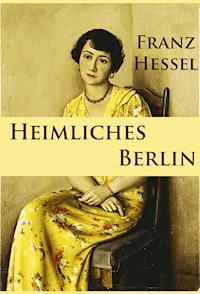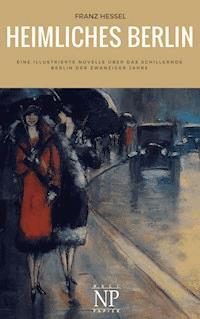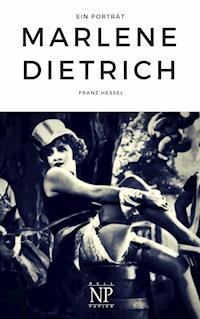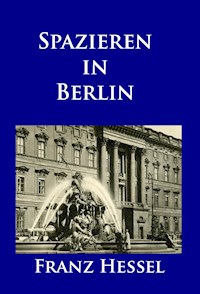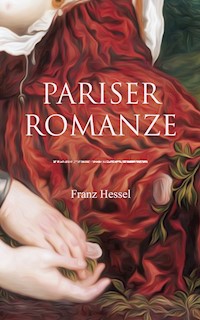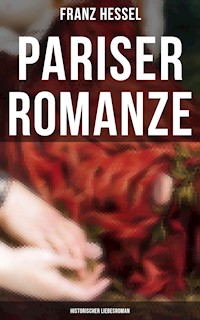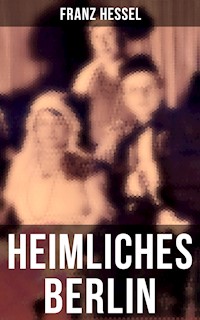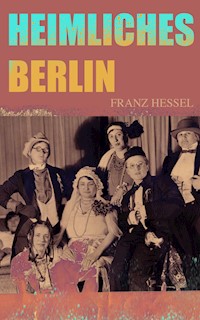Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lindhardt og Ringhof Forlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem Buch, einem Kreis von Erzählungen, die Boccaccio und E.T.A Hoffmann zusammenführt, ist Dappertuto der Geistreiche und Spötter – frei nach E.T.A Hoffmann –, der die Fäden in der Hand hält. Erzählungen und Geschichten, Anekdoten um und über die Liebe entlockt er seinen Freunden und zeigt Erinnerungen auf, die ein Gesicht haben müssen, damit sie haften bleiben. Schelmisch und morbide – entsprechend dem Festjahr 1919, Frivoles und Ernstes löst einander ab. Was sagt Susanne ihrem Liebhaber Gerhart, als sie über die Lauheit und Herzensenge ihres Mannes klagt und er anbietet, sie nach vollzogener Flucht zu heiraten: „Dich heiraten", rief Susanne, „bist du verrückt? Du bist mir viel zu schade!", und lachend und weinend küsste sie ihn. Zwei Städte werden mit Farbtupfer umschrieben – ja umgarnt – Berlin und Paris. Keine der Liebesgeschichten, die erzählt werden, finden einen glücklichen Schluss, sondern alle enden im zarten Elend oder im Katzenjammer. Autorenporträt Franz Hessel (1880–1941) war ein deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Lektor. Hessel zog nach dem Tod seines wohlhabenden Vaters, der Bankier gewesen war, mit Mutter und Bruder nach Berlin. Sein Bruder war der spätere Historiker Alfred Hessel. Hessel kam 1899 zum Jurastudium nach München. Er wechselte später zur Orientalistik, machte aber nie einen Universitätsabschluss. Das ererbte Vermögen ermöglichte es ihm, ohne Brotsorgen seinen literarischen Ambitionen nachzugehen. In München erhielt er Anschluss an den Kreis um Stefan George und lernte Fanny Gräfin zu Reventlow kennen. Mit ihr und ihrem Gefährten, Baron Bohdan von Suchocki, lebte er von 1903 bis 1906 in Schwabing. Diese Zeit ist Grundlage der Romane „Kramladen des Glücks" von Hessel und „Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem seltsamen Stadtteil" von Fanny zu Reventlow. Gemeinsam mit ihr verfasste Hessel mehrere Ausgaben des „Schwabinger Beobachters", der vor allem den Kreis um Stefan George parodierte. Von 1906 bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg lebte Hessel dann in Paris, wo er in den Künstlerkreisen von Montparnasse verkehrte, vor allem im berühmten Café du Dôme, in dem sich die ausländischen Künstler trafen. Aus dieser Zeit stammt seine Bekanntschaft mit dem französischen Kunsthändler und Schriftsteller Henri-Pierre Roché und der jungen Malerin Helen Grund, die er 1913 heiratete. Der Ehe entstammte der spätere Diplomat und Widerstandskämpfer Stéphane Hessel. Nach dem Krieg ließ sich die Familie in der Villa Heimat am Ortsrand von Schäftlarn südlich von München nieder. Im Jahr 1920, als seine Ehe bereits zerrüttet war, veröffentlichte Hessel den Roman „Pariser Romanze", in dem er seine Zeit in Paris und das Kennenlernen seiner Frau literarisch verarbeitete. In den zwanziger Jahren wohnte Hessel in Berlin und arbeitete als Lektor und Übersetzer im Rowohlt Verlag. Zusammen mit Lektor Paul Mayer und Verlagsinhaber Ernst Rowohlt präsidierte Hessel dessen Autorenabenden, an denen die bedeutendsten Schriftsteller der Zeit teilnahmen. Bekannt wurde er vor allem als Lyriker, Romancier und Prosaiker. Hessel blieb trotz Berufsverbot bis 1938 im nationalsozialistischen Deutschland weiterhin als Lektor im Rowohlt Verlag tätig. Wie Ernst von Salomon überliefert, blieb er in Deutschland, weil er sich dem Schicksal der deutschen Juden nicht entziehen wollte. Das Publizieren musste er in dieser Zeit zwar einstellen, jedoch übersetzte er die Werke Jules Romains’. Schließlich folgte er dem Rat seiner Frau und seiner Freunde und emigrierte widerstrebend kurz vor dem Novemberpogrom 1
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Hessel
Von den Irrtümern der Liebenden
Eine Nachtwache
Mit einem Nachwort von Peter Härtling
Saga
Von den Irrtümern der Liebenden
German
© 1922 Franz Hessel
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711506851
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Karbid
März des traurigen Jahres 1919.
Berlin.
Ein überfüllter Tanzsaal.
Um Mitternacht versagt plötzlich das elektrische Licht.
Geschrei und Taumeln.
Im Schein der Feuerzeuge ihrer Tänzer finden sich Lisa und Margot.
Lisa: »Jetzt noch Wasserstreik – ich habe vergessen, die Badewanne vollaufen zu lassen.«
Margot: »Und kein Gas – ich habe nur noch einen Kerzenstumpf.«
Einige Karbidlampen wurden angesteckt. Sie verbreiteten üblen Geruch und grell zuckendes Gespensterlicht, in dem die wilden Wandmalereien – Weiber nach Katzen greifend, Satyrn nach Nymphen tastend – sich grotesk ins Wüste verzerrten.
Man schob und drehte wieder.
Vor dem kreischenden Karussell entließ Lisa ihren Partner, einen Ungarn, der sie durchaus auf eine Autofahrt nach Budapest oder wenigstens zur Lotterie drüben an der Tombola mithaben wollte. Sie starrte in die kreisenden Farben des Drehwerks. Margots schwarzes Kostüm tauchte aus dem Bunten auf.
Mitten aus der Fahrt sprang Margot ab und in die Arme der Freundin.
Lisa: »Warum tanzt du nicht?«
Margot: »Mein bester Tänzer ist aufs Podium gestiegen, hat eine Violine genommen und spielt mit. Er findet es zu voll und zu gemischt.«
Ein schmächtiger Jüngling in hellem Sommeranzug näherte sich.
»Da kommt dein Page Anselmo, Lisa. Erhöre ihn endlich! – Guten Abend, junger Dichter. Was schlagen Sie vor, unsern Zustand zu bessern?«
»Wollen wir uns auf die kleine Treppe zum oberen Saal setzen?« meinte Anselm.
»Die zärtliche Treppe? Nein«, entschied Margot. »Da gibt es nur Gestreichel oder Philosophie. Mich hat heute schon eine Berühmtheit mit Weltanschauung geödet –«
Lisa: »Und mich ein grünlicher Abiturient mit seinen Erfahrungen in Kokain und Haschisch.« »Wir sind elend, man gebe uns zu trinken!« rief Margot und zog die beiden an einen der Trinkerstammtische. Dort wurde geschimpft über den teuren Sekt, der nach Süßstoff schmeckte. Sollte man nicht besser in den Spielklub gehen, wo es noch richtigen Champagner gab? Oder in das bewußte Lokal, in das der Eingeweihte über strohbedeckte Hintertreppen und durch die Küche Einlaß fand?
Anselm mußte mitansehen, wie ein gedunsener Kahlkopf sich an Lisas Schleier drängte und zittrige Finger nach ihren Prinzenhosen tasteten. Indes legte ihm eine Pausbäckige im Peplon behaglich ihren schwitzenden Arm auf die Schulter. Hilfesuchend sah er zu Margot hinüber. Zu der sagte gerade ein Gesicht mit Kneifer und Mittelscheitel leise sächselnd:
»Wir wollen redlich animalisch sein.«
Da sprang sie geekelt auf, und gleich waren Lisa und Anselm neben ihr.
»Nach Hause mit uns«, befahl Margot.
Da kam eilig auf sie zu der kleine Kunstprofessor, den man im Freundeskreis Dappertutto nannte, weil er überall und bisweilen an mehreren Orten gleichzeitig aufzutauchen schien. An dem reichgestickten Ärmel seines Gewandes hing ein zierlich flatterndes Wesen.
Es trug eine flimmernde Jacke mit breitausladenden Ecken auf Draht, dazu blaue Pluderhosen und rote Wadenstrümpfe.
»Ich bin glücklich, meine schönen Freundinnen«, sagte er mit seinem immer noch etwas wienerischen Akzent, »Ihnen meine jüngste Freundin vorzustellen, und bitte, ihr gütigst einen Namen zu geben.«
»Wie heißen Sie denn?« fragte Margot nüchtern.
»Diese Frage habe ich bereits vergebens an sie gestellt«, sagte Dappertutto. »Sie erwiderte: Mein Name ist nicht schön, so in dem Tonfall, mit dem die reizende Jessika aus dem Kaufmann von Venedig sagt: Nicht macht die liebliche Musik mich lustig. – Nun, so müssen wir sie wohl neu taufen.«
»Hier, unser Dichter hat vielleicht Beruf dazu«, sagte Margot.
Anselm näherte sich schüchtern und fragte die Fremde:
»Sie hüten vielleicht ein Geheimnis, gnädige Frau. Der Morgen soll wohl nicht wissen, wie schön Sie am Abend waren?«
Die Zierliche erwiderte mit blaßblauem Augenaufschlag:
»Am Morgen werde ich jedenfalls weniger schön sein, zumal diesen Morgen. Es ist ja Freitag, ein garstiger Tag für mich.«
»Nun, dann dürfen wir vielleicht Melusine zu Ihnen sagen. Diese Dame ließ sich am Freitag nicht sehen, weil sie dann einen Fischschwanz bekam und in ihr Element tauchen mußte.«
Der Name gefiel allen. Nur Margot fand ihn zu lang.
In diesem Augenblick ging die nächste Karbidlampe mit häßlichem Geheul aus. Zugleich erhob sich unter der Kapelle ein Zank. Ein Inder und ein Türke gingen mit entrüsteten Ehrenmännermienen aufeinander los. Auf der andern Seite flog eine Tür auf. Ein kalter Luftzug fuhr herein.
Da sagte Dappertutto:
»Ich glaube, wir haben alle genug von diesem mißglückten Mittfasten-Karneval. Ich habe zu Hause noch eine Flasche Likör und etwas Wein. Wir wollen uns einen kleinen melancholischen Punsch brauen und die schlechte Zeit vergessen.«
»Sie sind der Beste und Klügste«, rief Margot und umarmte den Kleinen. Lisa und die Melusine folgten ihrem Beispiel. Und er sorgte dafür, daß diese Liebkosungen keine Theaterküsse blieben.
Kerzen
In der Garderobe trafen die fünf Aufbrechenden den Freiherrn Ulrich, der sich mit trüber Miene eine Zigarette anzündete. Als er Margot kommen sah, blickte er fort, worüber sie wie geschmeichelt lächelte. Dappertutto aber eilte auf ihn zu:
»Sie müssen mitkommen. Baron. Wir fliehen auf meine Insel. Sie fehlten uns gerade, um komplett zu sein.«
»Ach, ich bin, fürchte ich, heute ein langweiliger Gesellschafter.«
»Das lassen Sie uns beurteilen«, meinte Lisa.
»Hat man sie geärgert auf dem Fest?«
»Ja, man machte mir Vorschläge zum Gelderwerb. Ich sollte als absolut zuverlässige Persönlichkeit mit Aufträgen nach Skandinavien reisen, in Briefmarken, in Medikamenten, in Platin. Aber mir scheint, es ist angemessener, zugrundezugehen, nachdem die Gelegenheiten zu einem anständigen Ende von 1914 bis 1918 versäumt sind.«
»Wollen Sie nicht Unterrichtsoffizier in Japan werden?« fragte ihn Margot mit etwas spitzer Stimme.
»Dazu könnte ich Ihnen durch einen Bekannten verhelfen. Man sucht dort deutsche Militärs mit Kriegserfahrungen.«
»Schicken Sie mich gerne so weit weg?« fragte Ulrich leise.
»Wer weiß, vielleicht käme ich am liebsten mit«, erwiderte sie mit plötzlicher Wärme.
»Laßt die Zukunft«, rief Dappertutto dazwischen. »Kommt mit mir ins Zeitlose.«
Er nahm Ulrichs Arm und ging voran.
Auf der Straße war es stockfinster. Nur die Lichter der Privatfuhrwerke, welche die streikenden Trambahnen ersetzten, flimmerten kümmerlich durch die Regennacht.
Beim Übergang zur Kanalbrücke geriet Lisas weißer Mantel in den Stacheldraht. Ein freundlicher Soldat leuchtete der Gruppe mit seiner Taschenlampe über die Brücke. Und von da war es nicht mehr weit bis zu Dappertuttos Tür.
Bei tropfendem Stearin stieg man langsam treppauf. Als man dann aber in das geräumige Atelier kam, wo Dappertutto gleich in allen Wandleuchtern Kerzen ansteckte, die ein altertümlich-festlich-mildes Licht ausstrahlten, und als alle sich auf Divanen, Sesseln und Kissen rings um den niederen Modelltisch lagerten und der kleine Meister auf einem anderen Tisch unter dem Teekessel die Spiritusflamme anzündete, überkam allmählich die drei Männer und drei Frauen ein Wohlbehagen.
Nur Ulrich blieb noch etwas unruhig, blickte umher auf japanische Holzschnitte und chinesische Stickereien, faßte nach Schalen und Statuetten. Da entdeckte er hinter einem Wandteppich ein Grammophon. Er drehte es an, kam zurück an den Modelltisch und half mit noch finsterer Höflichkeit Margot von ihrem Sitz auf.
Die beiden schwarzen Figuren bewegten sich langsam und mit einer ungewollten Feierlichkeit. Die Jetperlen an Margots Kleid klangen aneinander. Ulrichs hohe Gestalt neigte sich zu der im Tanze Aufstrebenden. In der Sorgsamkeit, mit der seine Hände sie hielten und führten, lag eine immer noch zurückgehaltene Zärtlichkeit. Aber Margot schmiegte sich näher an ihn, und seine Arme folgten gerne.
»Tanz versöhnt«, flüsterte Lisa und sah auf den dunklen Scheitel des jungen Anselm, der vor ihrem Divanlager auf einer Rolle saß.
»Wollen wir auch tanzen?« fragte er zu ihr hinauf. Aber sie schüttelte den Kopf und legte sich zurück. Die Ärmel sanken von ihren schmalen Armen. Die zarten Ellenbogen leuchteten wie Elfenbein.
Melusine, tief eingeschmiegt in einen Ledersessel, fingerte mit ihren Ringen und Ketten und summte zur Musik einen fremdländischen Text, ungarisch oder böhmisch.
Das Lied des Grammophons verging in leisem Surren. Die beiden tanzten noch eine Weile ohne Musik weiter. Dann kamen sie Arm in Arm zu den anderen. Es war einige Augenblicke ganz still im Raum. Eine weißgefleckte Katze kroch auf Melusines Schoß.
Als dann Dappertutto den dampfenden Punsch auf den Tisch gestellt, die Gläser gefüllt und seinen Gästen zugetrunken hatte, sagte Lisa:
»Wir fangen an, glücklich zu werden. Um es zu bleiben, ohne ganz zu versinken, und um uns nicht durch witzige Gespräche aufzuschrecken aus dieser traumhaften Nachtwache, wollen wir uns Geschichten erzählen, traurige Geschichten, die angenehm sind.«
»Ja«, meinte Dappertutto, »traurige Geschichten, die lustig machen.«
»Vom Wahn und Irrtum der Liebenden«, schlug Ulrich vor.
Anselm: »Nur nichts vom Glück!«
Lisa: »Nur nichts Idyllisches!«
»Warum nichts Idyllisches?« fragte Margot.
»Ich bin zwar nicht sonderlich sentimental. Aber ich liebe nichts so sehr wie die alten Schäfergeschichten. Da gibt es keine gesellschaftlichen und moralischen Konflikte. Untreue ist natürlich und Treue ein Glück. Arkadien ist mein Traum. Dabei bin ich ja wohl ein ziemlich modernes Geschöpf, und in meinem Leben geht es oft zu wie im Kino.«
»Kino ist nicht modern«, belehrte Ulrich. »Kino enthält die augenscheinlich gemachten Empfindungen aus früheren Zeiten, Karikaturen des früher Vornehmen, das jetzt das souveräne Volk sich nachzuempfinden erlaubt. Sie, Margot, sind viel wirklicher als Kino sein kann.«
»Erzählt doch Märchen wie die Königskinder«, sagte Melusine und schmiegte ihren Lockenkopf an Dappertutto, der auf der Armlehne ihres Sessels saß und ergötzt auf sie niedersah.
»Soll man Ihnen den Froschkönig erzählen?« fragte Margot mit einem Blick auf Dappertuttos krausbärtiges Gesicht und sein etwas breitmäuliges Lächeln.
»Erzählt, fabuliert, bekennt und lügt, wie es euch ankommt«, rief Dappertutto.
Und Lisa, von der der Vorschlag ausgegangen war, mußte selbst den Anfang machen. Sie blieb ruhig liegen und begann, ohne jemanden anzusehen, zur Decke hinauf:
Gefärbte Tulpe
»Wenn ihr über den Potsdamer Platz geht, vorbei an den feldgrauen Händlern mit Zigaretten, Malzbonbons und Pfannkuchen und an den Roulettes der fliegenden Spielbanken und kommt zu den Blumenständen, so könnt ihr neben den ersten Märzbechern, Kätzchen und Veilchen, den Treibhausrosen und -nelken, neben all diesen wilden und zahmen natürlichen Blüten Gefäße mit gefärbten Blumen sehen. Darin gibt es grüne, blaue und kupferrote Tulpen, die besonders im Laternenlicht bunter und märchenhafter aussehen als die naturfarbenen. Sie können, glaube ich, gar nicht welken, sind immer gleich schön und ungewöhnlich. Aber ich möchte mir keine davon mit nach Hause nehmen. Sie dauern mich. Wer weiß, was für ein heimlich vergiftetes Mumienleben sie führen.
Diese Tulpen erinnern mich immer in einer mir selbst nicht ganz deutlichen Ideenverbindung an eine schöne verstorbene Jugendfreundin.
Edith entstammte einer der wenigen altberliner vornehmen Bürgerfamilien. Ihre Onkel waren Geheimräte und Bankiers, ihre Vettern Offiziere und Professoren, die Kusinen entweder gut verheiratet oder sehr tätig, mit Studien und Ehrenämtern beschäftigt. Im geselligen Haus ihres Vaters, eines berühmten Chemikers, war sie von soviel Weisheit und Wissenschaft umgeben, daß von den zahllosen Forschungs- und Bildungsdingen, die sich reizvoll darboten, nichts Einzelnes sie reizte.
Unter den jüngeren Freunden und Freundinnen des Hauses gab es auch muntere Liebhaber aller Sporte, die zu Golf und Tennis, Ski und Bobsley einluden. Aber die hatten in ihrer gleichmäßigen Beweglichkeit etwas elastisch Undurchdringliches. Edith bewunderte sie ebenso wie die Gelehrten. Sie fühlte keinen Ehrgeiz, es ihnen gleichzutun.
Von Kindheit an hatte sie Sehnsucht nach dem Außerordentlichen, dem Unberechenbaren. Sie war zart und gebrechlich und träumte von Raub und Gewalt. Die Annäherung eines höflich grüßenden Herrn auf der Straße war ihr peinlich und widerlich.
›Wie mag das sein, wenn ein schlimmer Bursche aus dem Wedding oder Gesundbrunnen mich einfach am Arme packte!‹ dachte sie und schauerte in begehrlicher Angst.
Unter Ediths Freundinnen hatten einige Berührung mit Kreisen unregelmäßigeren und gewagteren Lebens. Und so erfuhr sie, obwohl sehr sittsam erzogen, manches von den Komödien und Tragödien der Leidenschaft und des Genusses. Aber in der ihr erreichbaren Sphäre war man äußerst verständig, und von der sogenannten Liebe wurde in einem spöttischen und wegwerfenden Ton gesprochen wie von etwas Lächerlichem und geradezu Subalternem. Natürlich konnte sie einigem Flirt nicht entgehen. Denn vor ihrer exotischen Schönheit brachten Reife und Unreife beredt oder stammelnd verliebte Reden vor. Das gewöhnte sie aber nur immer mehr ans Ironisieren und an die karge Lust, abzuweisen. Sie sah keine Möglichkeit, selbst in eine Leidenschaft zu geraten. Und hatte sie im Einschlafen auf den kühlen reinen Leinen aus dem Wäscheschrank ihrer guten Mutter bisweilen Sehnsüchte, für die es im Elternhaus keine Worte gab, so war es ihr doch, wenn sie morgens, meist noch müde, erwachte, beruhigend und tröstlich, sich in diesen Decken und Kissen wiederzufinden und nicht auf fremdem Lager in irgendeinem Atelier oder Boudoir.
Mehr als all die Wohlbekannten oder schnell Einzuordnenden, die sich auf Bällen, Tennisplätzen und Segelfahrten um sie bemühten, gefielen ihr Männer, die man zufällig, etwa auf Reisen trifft und von denen man nichts Sicheres weiß, am meisten solche, die man gar nicht kennenlernte. Man wechselt mit ihnen im Theater oder in der Hotelhalle einen Blick, zu dem man sich nicht zu bekennen braucht.
Als nun der große Krieg begann und rings um sie die sonst so Skeptischen, Vernünftigen und international Interessierten von einer jähen vaterländischen Begeisterung ergriffen schienen, hatte sie das traurige, ja erschütternde Erlebnis, nicht mitfühlen zu können. Sie empfand, wie sie mir selbst gestanden hat, mitten in der bewegten Menge, die durch die Linden dem Schloß zudrängte und jubelte, eine Fremdheit, als wäre sie im Ausland in einen Auflauf geraten, dessen Ausbrüche und Worte ihr unverständlich blieben; und als sie, um dieser Qual zu entgehen, sich umwandte und mühsam durch die Entgegenströmenden heimwärtsstrebte, kam sie sich wie ein Gespenst unter den Lebendigen vor.
Auch was sich in ihrer nächsten Umgebung abspielte und ihr alle Elemente zu einem lebhaften Anteil darbot, blieb ihr einzeln und fremd. Aus Pflichtgefühl tat sie und redete, was angemessen schien. Der Abschied vom eigenen jungen Bruder, der als Freiwilliger ins Heer eintrat, machte ihr nur Kummer und Angst. Der tägliche Verkehr mit würdigen Männern, die mit Leib und Geist der gemeinsamen Sache dienten, bereitete ihr nur Selbstvorwürfe über ihre Wesenlosigkeit. Die jungen todesmutigen Marine- und Fliegeroffiziere, die von ihren Freundinnen umschwärmt und verehrt wurden, ließen sie kalt, ja, die frische Lebensart dieser Herren, die nur witzig oder mit preußischnüchternen Kernworten von ihren Erwartungen und Erfahrungen sprachen, erregte Ediths Widerwillen.
Im Spätherbst des ersten Kriegsjahres bekam ihr Bruder, vor dem Transport seines Regiments an die Front, einen kurzen Urlaub. Er brachte einen Kameraden mit und bat seine Familie, diesen, der vielleicht nicht ganz »möglich«, aber sein nächster Vorgesetzter sei, in seinem Interesse gut zu behandeln. Es erschien ein etwa dreißigjähriger, gedrungener, breiter Unteroffizier mit weißblonden Haaren und Wimpern und rötlicher Haut. Er war Landwirt und aus Westfalen. Er faßte die Hand, die Edith schmal reichte, mit seiner mächtigen von Sommersprossen flimmernden Rechten fest an. Die Schultern bewegte er beim Gehen langsam nach vorn wie ein Zugstier. Seine Mischung von Schüchternheit und Stolz gefiel den Eltern. Als die Mutter Edith nach ihrem Eindruck von dem Gast fragte, sagte diese:
›Er wirkt wie ein Landaufenthalt.‹
Mit der Stadt Berlin wußte er nicht viel anzufangen. Nachdem man ihn am zweiten Urlaubstage in den Zoologischen Garten geführt hatte, wollte er auch die nächsten Tage dorthin. Er hielt sich nicht lange vor den Käfigen der merkwürdigen Raubtiere oder seltsamen Neuweltler und Australier auf, sondern beobachtete, seine Pfeife rauchend, die nächsten Verwandten unserer Haustiere und unseres Wildes, Büffel, Hirsche, wilde Ziegen.
Mit dem Herrn Professor, Ediths Vater, redete er von Kunstdünger.
Um sein Interesse zu erregen, befragte Edith ihn über landwirtschaftliche Dinge. Er antwortete mit gutmütiger Umständlichkeit. Sie redete aufs Geratewohl von Saat und Mahd und Grummet und sehnte sich, in den Armen dieses Ruhigen zerdrückt zu werden. Sie hatte bisweilen die Vision eines schmalen Pfades zwischen hohen Ähren, auf dem er ihr begegnete: Sie ging gegen die Sonne, von der seine Gestalt so durchflutet war, daß sie ihn nicht ansehen konnte. Ausweichen war unmöglich. Und er kam mit quälender Gelassenheit ganz langsam näher.
Am letzten Abend wollte Ediths Bruder den Kameraden in das großstädtische Nachtleben mitnehmen. Der erklärte:
›Ich gehe eigentlich nicht gern in fremde Wirtshäuser. Da sitzt man dumm da, oder es gibt Streit.‹
Aber schließlich ließ er sich bewegen.
Edith saß strickend neben der Mutter, die traurig darüber war, daß ihr Sohn sie am letzten Urlaubsabend verließ. Die Tochter mußte beruhigen und trösten.
›Mein Sohn ist gerade so ein Experimentierer wie ich‹, sagte der Vater, ›er muß durchaus diesen schwer zu lösenden Bauern ins Städtischste vermischen. Das macht ihm mehr Vergnügen, als bei den Seinen zu sitzen.‹
Edith versuchte, ihre wachsende Aufregung als Sorge für den unerfahrenen Gast zu deuten, den sie in lauter Gefahren glaubte.
Nachts lag sie lange schlaflos in spannender Erwartung. – Es muß etwas geschehen, sagte sie sich. Als sie endlich einschlummerte, hatte sie wildjagende Träume: Sie stand hinter der Bar und mischte und reichte den Herren Getränke. Ihr Bruder streichelte sie und gab ihr derbe Kosenamen. Der Fremde nahm das Glas aus ihrer zitternden Hand in seine buntflimmernde Faust. Dann lag sie neben ihm in einem Schützengraben. Granaten schlugen hinter ihnen ein. Splitter – es waren Sektglassplitter – klirrten und sprühten. Sie bedeckte den Fremden, den Geliebten, mit ihrem Mantel. Der Mantel war ihr weitfließendes Hemd. Der Geliebte lag wie ein dickes, leuchtendes Kind an ihre entblößte Brust geschmiegt. – Mit einmal war sie in einem Hurenhaus und mußte sich in einer Reihe fetter und magerer Weiber seinem prüfenden Blick darbieten. Seine kleinen undeutlichen Augen mit den hellen Wimpern glitten über sie hinweg zu den anderen.
Sie erwachte und hörte die Wohnungstür öffnen, und die beiden Heimkehrenden flüstern. Der Bruder ging nach hinten, der andere in das Fremdenzimmer vorn. Edith saß einige Minuten starr aufrecht, dann erhob sie sich, streifte den Schlafrock über, stand zitternd im Hausflur. – ›Noch kann ich zurück‹, dachte sie, stützte sich auf eine Stuhllehne und schloß müde die Augen. Aber im nächsten Augenblick hatte sie schon die Tür zum Fremdenzimmer geöffnet. Sie sah im Mondlicht das helle Haupt des Mannes. Die Augen waren geschlossen. Wieder fühlte sie die Pause, die Möglichkeit umzukehren. Dann stürzte sie sich mit Todesmut an seine Brust.
Erstaunlich bleibt die Besonnenheit dieses Landmannes, der sich aufrichtete, neben ihr sitzend ihre Hand in seine Fäuste nahm und auseinandersetzte: es wäre freundlich von ihr, daß sie ihn liebe. Aber eines Landwirts Frau zu sein, dazu wäre sie nicht geschaffen. ›Da gibt es soviel Arbeit, selbst wenn man Mägde und Knechte genug hat.‹ – Sie hörte Worte. Lieben und Sterben, hatte sie gedacht. Und er sprach von Arbeit und Mägden.
›Wenn ich im Krieg fallen sollte‹, fuhr er fort, ›möchte ich nicht gern ein Kind ohne Vater hinterlassen.‹