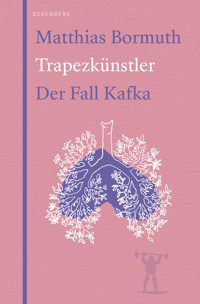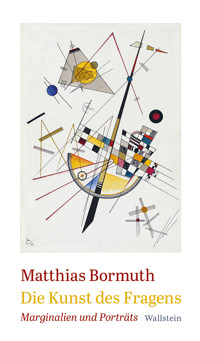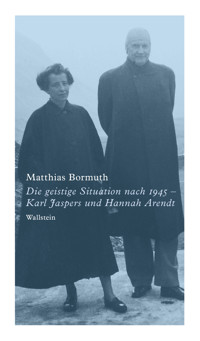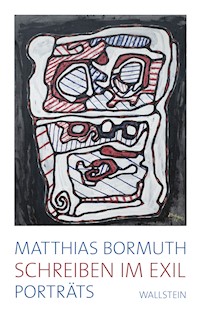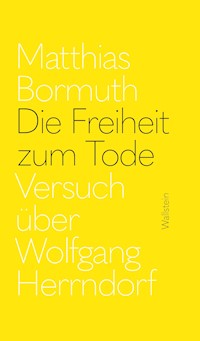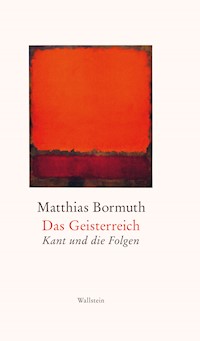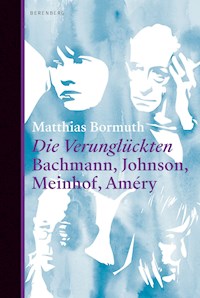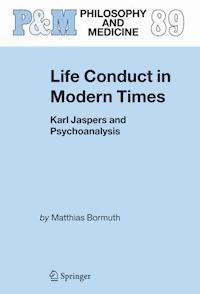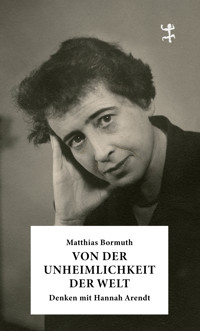
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In seinem ideengeschichtlichen Porträt entlang ihrer wichtigsten Werke bringt uns Matthias Bormuth das Denken Hannah Arendts im Spiegel unserer Gegenwart ganz nah. Er bietet eine Lektüreanleitung und zugleich eine Anleitung zum Selberdenken. Dabei folgt er Arendts Lebensspuren, von ihren Anfängen in der deutschen Existenzphilosophie über die politische Wende 1933, ihr zionistisches Engagement im Pariser Exil und ihre Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus an ihrem Alter Ego Rahel Varnhagen bis hin zu ihrer Zeit in New York. Ab 1941 lanciert sie als Public Intellectual ihre Sozialphilosophie, die seit Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft die internationale Debatte prägt, und löst als kritische Journalistin mit Eichmann in Jerusalem eine weltweite Kontroverse um gedankenloses Handeln und gesellschaftliche Verantwortung aus. Ihr leidenschaftliches Nachdenken schafft eine »Signatur der Pluralität«, die im einzelnen Menschen beginnt und sich im Dialog mit anderen weiter entfaltet. Ergriffen von der Unheimlichkeit der Welt, will Hannah Arendt deren totalitäre und technologische Versuchungen begreifen. So begegnet sie ihrer Zeit mit einem Denken der Freiheit, das auch fünfzig Jahre nach ihrem Tod aktueller ist denn je. Hannah Arendt, so zeigt Matthias Bormuth anhand ihrer Werke, ist die sokratische Denkerin der Moderne: Nur der Mensch, der für sich sein kann, ist auch fähig, der Welt zu begegnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Von der Unheimlichkeit der Welt
Matthias Bormuth
Von der Unheimlichkeit der Welt
Denken mit Hannah Arendt
Jerry und Jessica
Inhalt
Freiheit denkenProlog
Licht und DunkelLebensgeschichte einer deutschen Jüdin
Der Liebesbegriff bei AugustinMarburg und Heidelberg
Leben im ExilPariser Anfänge
Ursprünge totaler HerrschaftNew York Intellectual
Die WenigenBesuch in Deutschland
Was ist Existenzphilosophie?Ereignis und Grenzsituation
Menschlichkeit in finsteren ZeitenZwischen Vergangenheit und Zukunft
Eichmann in JerusalemWahrheit und Politik
Vom Geist der RevolutionZiviler Ungehorsam
Denken und HandelnVom Leben des Geistes
Dank
Literatur
Freiheit denkenProlog
Fang an mit: Denken, wie es von den Philosophen verstanden wird – von Jaspers ebenso wie von Heidegger –, als eine Art und Weise des Handelns.
Hannah Arendt, Denktagebuch
I.
Als politische Philosophin sorgte sich Hannah Arendt um den einzelnen Menschen, dessen mögliche Freiheit sie von innen wie außen bedroht sah. Schon im Gymnasium war die in Hannover 1906 geborene und in Königsberg aufgewachsene Arendt mit ihrer philosophischen Neigung aufgefallen. Die Psychologie der Weltanschauungen, das erste Buch der Existenzphilosophie von Karl Jaspers, öffnete der Schülerin die Augen für die Versuchung, sich als Mensch seiner Freiheit zu begeben und in einem gedanklichen Gehäuse einschließen zu lassen. In solcher Nachdenklichkeit schloss sie rebellisch das Abitur als Externe in Berlin ab. Als Arendt im Herbst 1924 mit kaum achtzehn Jahren ihr Philosophiestudium bei Martin Heidegger in Marburg aufnahm, hatte sie bereits bei Kierkegaard und Kant vom Einzelnen und seiner in der Gesellschaft gefährdeten Freiheit gelesen.
In den Anfängen der Weimarer Republik konnte Hannah Arendt kaum ahnen, dass sie ein Jahrzehnt später als Jüdin in Deutschland ihres Lebens nicht mehr sicher sein würde. Doch die Nationalsozialisten setzten den deutschen Antisemitismus ins Zentrum ihrer immer erfolgreicheren politischen Bewegung, die einen probaten Sündenbock für die politische Unzufriedenheit benötigte. So begann 1933 das Exil Hannah Arendts, das sich über zwei Kontinente erstrecken sollte und 1951 mit der amerikanischen Bürgerschaft des staatenlosen Flüchtlings offiziell endete. Heimisch wurde Arendt nirgendwo mehr ganz. Sie erfuhr am eigenen Leben die Schöpfungsgeschichte, die erzählt, wie der Mensch das paradiesische Dasein verliert und genötigt wird, ruhelos und mühevoll auf Erden zu existieren, ohne je in der Welt ganz zu Hause zu sein.
Aber man kann die biblische Mythe mit Kant und seiner Philosophie der Freiheit, die Arendt so schätzte, auch gegen den religiösen Strich lesen. Die Verbannung aus dem Paradies, die dem Biss in den Apfel vom Baum der Erkenntnis folgte, bringt erst die Freiheit, also das Wagnis offenen Denkens und Handelns. Arendt sprach selbst von der Bewegungsfreiheit als dem ersten Grundrecht des Menschen. Aufklärung ist in diesem Sinne ein beständiges Fortschreiten, das Momente der Freiheit verbürgt in einem Leben andauernder Verantwortung. Kant stellte jedoch keine Gewissheit in Aussicht, dass diese sich einmal zu einem utopischen Ganzen fügen möge. Einem Menschen wie Hannah Arendt, der mit solch aufgeklärtem Enthusiasmus lebt, bleibt nur eine geistige Sehnsucht nach Erfüllung, die über das Vorfindliche hinausgeht, aber mit herben Einschränkungen rechnet, ohne dass die inspirierende Idee der Freiheit aufzugeben wäre.
Freiheit denken heißt für die politische Philosophin, immer wieder an solche Augenblicke zu erinnern, in welchen Menschen diese offene Existenz in Gedanken fassen oder in Taten sichtbar machen konnten. Selbst der Zivilisationsbruch nimmt für Arendt im 20. Jahrhundert nicht die Möglichkeit, Licht und Schatten im Leben der Freiheit vor Augen zu führen. Leiden und Vernichtung, so wie es das europäische Judentum erleben musste, aber auch andere Völker heute erfahren, ist die unglückliche Signatur der Geschichte, deren Passion aber die glücklichen Zeiten möglicher Freiheit bleiben, die einzelne Menschen suchen und Gesellschaften möglichst schaffen sollen.
II.
Dieser biografische Abriss will Hannah Arendts Denken der Freiheit entlang ihres Lebens in zehn Skizzen entfalten, ohne dass ein umfassender Anspruch auf Erklärung ihrer Philosophie erhoben würde. Vielmehr soll die Entwicklung ihrer Gedanken und des zentralen Leitmotivs der Freiheit in den historischen Zusammenhängen anschaulich werden.
Sie setzte schon früh ein Zeichen solchen Schreibens. Bevor die Philosophin Deutschland verlassen musste, widmete sie ihr erstes Buch Rahel Varnhagen einer jüdischen Intellektuellen, die in der Romantik ihren Salon vergeblich unabhängig von sozialen Schranken im Geiste der Aufklärung geführt hatte. Die Assimilation, die Varnhagen wie viele andere im Namen der deutschen Kultur gesucht hatte, scheiterte nach den napoleonischen Jahren und den Befreiungskriegen gänzlich, als in der Zeit der Restauration im großen Flickenteppich der deutschen Staaten alle freiheitlichen Entwicklungen zurückgenommen wurden.
Arendt erfuhr ein ähnliches, weitaus dramatischeres Schicksal als Rahel Varnhagen. Ihr nutzte es nichts, bei Heidegger und Jaspers, zwei der bedeutendsten Philosophen ihrer Zeit, studiert zu haben. Mit der nationalsozialistischen Radikalisierung wurde seit 1933 in Deutschland alle Illusion zerstört, der jüdische Paria sei Vergangenheit, und die moderne Assimilation, die gerade auch die Universitäten erreicht hatte, könnte erfolgreich fortgesetzt werden. Mit ihrer Flucht aus Deutschland, die sie über Prag nach Paris führte, wurde sie ein jüdischer Paria, der später entsprechend auch Essays über Heinrich Heine, Franz Kafka und Charlie Chaplin schrieb.
Arendt war nach Beginn des Krieges, der 1940 zur überraschenden Okkupation weiter Teile Frankreichs geführt hatte, mit Glück einem Internierungslager im freien Süden des Landes entkommen, bevor die Deportation in die osteuropäischen Vernichtungslager begann. Rasch fasste sie, nachdem sie im Mai 1941 über Lissabon glücklich hatte Europa verlassen können, unter den New York Intellectuals Fuß. Freiheit zu denken hieß nun vor allem, ihre konsequente Aufhebung in totalitären Systemen vor Augen zu führen und dabei die Vorgeschichte in Imperialismus und Antisemitismus zu berücksichtigen. In ihren Essays für deutschsprachige und amerikanische Zeitschriften untersuchte sie die Verlassenheit des Massenmenschen, dem in der ideologischen Wirklichkeit kein Freiraum der Einsamkeit mehr bleibe, in dem er sein Handeln bedenken könne.
Als der Kalte Krieg 1946 einsetzte, entwickelte Arendt als liberale Intellektuelle den Mut, in Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft nach dem Nationalsozialismus auch den sowjetischen Totalitarismus als fanatische und terroristische Ideologie zu entlarven, ein Jahrzehnt, bevor die aufsehenerregende Geheimrede von Chruschtschow in Moskau plötzlich Stalins systematisches Morden anprangerte, ohne allerdings das totalitäre Regime grundsätzlich infrage zu stellen. Karl Jaspers wurde in Briefen zum wichtigsten deutschen Gesprächspartner Hannah Arendts, der mit ihr die kantische Idee der Freiheit neu in ihrer politischen Relevanz für West und Ost bedachte.
Ganz anders erfuhr Arendt nach dem Zweiten Weltkrieg nochmals mit Martin Heidegger die Freiheit im unkontrollierbaren Phänomen der Liebe. Nach fünfundzwanzig Jahren entflammten beide erneut füreinander, als Arendt 1949/50 erstmals wieder europäischen und deutschen Boden betrat. Sie hat später nicht zufällig ihre politischen Essays Zwischen Vergangenheit und Zukunft von dieser Begegnung her in den Horizont eines ekstatischen Denkens gestellt, das Arendt um 1950 literarisch an Franz Kafka festmachte. Erst in ihrem Vermächtnis Vom Leben des Geistes verknüpfte sie es offener mit Martin Heidegger, dem sie im Geist der Romantik die Erfahrung ursprünglichen Liebens und Denkens verdankte.
Politisch begrüßte Arendt ein Jahrzehnt nach Kriegsende die Ungarische Revolution, weil diese die Idee der Freiheit mit der Realität der Räte neu ins Gedächtnis der politischen Welt gehoben hatte. Diese standen für einen gemeinsamen Raum der freien Meinungsbildung im gesellschaftlichen Handeln und waren für Arendt der Ausdruck spontaner Freiheit, während Parteien dazu neigten, revolutionäre Ereignisse bald wieder in fest kontrollierbare Bahnen zu lenken. Der Gedanke, dass Menschen qua Geburt der Anfang eines freien Handelns werden können, beschloss schon ihre Totalitarismus-Studie. In der Folge würde Arendt in Über die Revolution zu zeigen versuchen, inwieweit die Französische und die Russische Revolution die Spontaneität der Räte für das parteiliche Denken verraten hätten, während Amerika deren Tradition in seinen politischen Institutionen partiell noch bewahrt habe.
Weltweit bekannt wurde Hannah Arendt in den 1960er-Jahren durch ihren Report Eichmann in Jerusalem. Sie schilderte den Prozess vor allem im Kontrast zur nationalen und religiösen Intention Israels, gute Opfer und böse Täter vor Gericht erscheinen zu lassen. Mit Blick auf Adolf Eichmann sprach sie von schierer Gedankenlosigkeit, die ihn als Prototyp des deutschen Kleinbürgers zum Organisator der Vernichtung der Juden in Europa habe werden lassen. Ihr Bericht akzentuierte die Handlungsfreiheit der europäischen Judenräte, denen möglich gewesen wäre, zumindest teilweise die Kooperation mit den Nationalsozialisten zu verweigern. Arendt schrieb den Report über die Banalität des Bösen aus dem Blickwinkel der Freiheit, sodass ihre Darstellung die historischen Figuren und Situationen im Guten wie im Schlimmen zugespitzt ins Gedächtnis rief.
Für Arendt wurde im Vorfeld des Buches Lessing als kritischer Geist eine Leitfigur. Er habe wie wenige die Zivilcourage besessen, die ein Intellektueller benötige, um gegen das konservative wie progressive Establishment seine Überzeugung zu behaupten. Arendt sah den deutschen Aufklärer in der antiken Tradition freien Denkens und Lebens, das sie lebenslang in der Figur des Sokrates philosophisch bewundern sollte. Dessen Apologie der Pluralität bildete in ihrer Auslegung einen Kontrast zum platonischen Anspruch, nicht nur vorläufige Meinungen, sondern auch endgültige Wahrheiten im Denken aufscheinen zu lassen. Arendt aktualisierte die sokratische Position für den amerikanischen Kontext, in dem seit der Bürgerrechtsbewegung und dem Vietnamkrieg im Zeichen des widerständigen Literaten Henry David Thoreau ziviler Ungehorsam als bürgerliche Tugend kultiviert wurde.
Ihre Vorsicht, keinen endgültigen gesellschaftlichen Fortschritt zu erwarten, und ihr Anspruch, im Notfall bereit zu sein, die einzelne Überzeugung im Widerstand gegen geläufige Handlungsmuster zu vertreten, leben gleichermaßen von den Anfängen ihres Nachdenkens, das bei Heidegger auch in Lektüren Augustins einsetzte. Sie sah, dass der Kirchenvater trotz des Ereignisses der ewigen Wahrheit, die in sein Leben einbrach, frei genug blieb, das endliche Geschehen auf der Erde in seinem Verlauf als unaufhellbares Dunkel anzuerkennen. Diese skeptische Ansicht wird ihr politisches Denken prägen und Arendt gegen die Versuchung schützen, eine geschichtlich geschlossene Wahrheit zu propagieren. Karl Marx blieb für sie allein ein genialer Analytiker der modernen Massenwelt und ihrer ökonomischen Verflechtungen, ohne dass sie irgendeine Spielart der marxistischen Geschichtsideologie geteilt hätte.
Ihr philosophisches Vermächtnis Vom Leben des Geistes, das zwei Bände dem Denken und Willen widmet, während der dritte Das Urteilen nur in Fragmenten überliefert ist, steht in antiker wie christlicher Tradition. So erläuterte Arendt gerade an den Figuren von Sokrates, Paulus und Augustinus, welche Herausforderungen der Mensch auch von innen zu gewärtigen hat, wenn er seiner Freiheit in Denken, Wollen und Urteilen gerecht werden will. Sensibilisiert für ein gesellschaftliches Pragma, wie es der römische Republikaner Cato vertrat, berief sich Arendt zugleich mit dessen Worten auf das, was über die vorläufigen Interessen im Handeln hinausgeht und doch auf geheimnisvolle Weise den politischen Horizont im Denken beeinflusst: Nie ist der Mensch tätiger, als wenn er nichts tut, und nie ist er weniger allein, als wenn er für sich allein ist.
III.
Wie Arendt fern von akademischen Bindungen und intellektuellen Parteibildungen ihre Meinungen vertrat und nach 1945 auf seltene Weise das Wagnis der Öffentlichkeit einging, fand die Bewunderung von Karl Jaspers, besonders in seinen letzten Lebensjahren, als die internationale Debatte um Eichmann in Jerusalem tobte. Er begann mit Vom unabhängigen Denken ein Fragment gebliebenes Porträt seiner Meisterschülerin zu schreiben, in dem er sie in einen größeren Horizont vorbildlicher Denker einzeichnete: Der Chor der unabhängigen Menschen der Jahrtausende nimmt uns auf in seinen wundersamen Kreis. Wir können ihn die Republik der Vernünftigen nennen, die sie selbst sind. Diese Menschen ermutigen, sie zeigen uns die Möglichkeit der eigenen Unabhängigkeit und fordern sie. Von ihnen berührt finden wir unsere Wege immer wieder ursprünglich in jedem neu Geborenen und in einer immer auch anders gewordenen Welt.
Diesen Blick für das freiheitliche Bewusstsein Einzelner hatte Jaspers in den Jahren der politischen Bedrängnis geweitet, als seine jüdische Frau Gertrud und er bedroht in Heidelberg lebten und er über den westlichen Kanon hinaus jüdische Propheten und asiatische Denker studierte. Arendt faszinierte das von diesen Lektüren inspirierte Konzept der Achsenzeit, das in den großen Religionen und Philosophien fast parallel markante Momente ausmachte, in welchen Einzelne plötzlich das Bewusstsein der Freiheit gegen gesellschaftliche Zwänge entwickelt hätten, begründet in ihrem individuellen, oft dissidentischen Bewusstsein. Sie hob von diesem Topos her das Zeitfenster hervor, das sich von 800 bis 200 vor Christus weltweit mit solch freiheitlichen Stimmen aufgetan habe: Zum ersten Mal wird der Mensch (nach Augustins Worten) sich selbst zur Frage, entdeckt das Bewußtsein, fängt an, über das Denken zu denken. Überall treten große Persönlichkeiten auf, die sich nicht länger auffassen, und nicht aufgefaßt werden wollen, als bloße Mitglieder bestimmter sozialer Gebilde, sondern die sich selber als Individuen begreifen und neue individuelle Lebensweisen entwerfen – das Leben des Weisen, das Leben des Propheten, das Leben des Einsiedlers, der sich von aller Gemeinsamkeit zurückzieht in eine ganz neue Innerlichkeit und Geistigkeit. Zuletzt sah Jaspers Hannah Arendt selbst im Horizont der achsenzeitlichen Denker. Tatsächlich begründete sie mit ihrem Leben und Werk ein Gedächtnis der Freiheit, das gerade bei dem Blick für soziale Strukturen von dem Anliegen geleitet ist, im Kontrast zu kollektiven Mustern individuelle Spontaneität im Denken zu zeigen und im Handeln zu bewähren.
Diese Erinnerung an Hannah Arendt versucht entlang ihres Lebens- und Denkweges ihr Anliegen so aufzugreifen, wie die Philosophin es selbst in ihrer Porträtsammlung Menschen in finsteren Zeiten vorschlug. Als in den 1960er-Jahren politische Ideologien und dogmatische Parteiungen den Anspruch freier Subjekte gesellschaftlich infrage stellten, stellte sie ihrem Buch, das bezeichnenderweise erst 1989 ins Deutsche übersetzt wurde, die Prämisse voran: Die Überzeugung, daß wir selbst dann, wenn die Zeiten am dunkelsten sind, das Recht haben, auf etwas Erhellung zu hoffen, und daß solche Erhellung weniger von Theorien und Begriffen als von jenem unsicheren, flackernden und oft schwachen Licht ausgehen könnte, welches einige Männer und Frauen unter beinahe allen Umständen in ihren Leben und ihren Werken anzünden und über der ihnen auf der Erde gegebenen Lebenszeit leuchten lassen.
Licht und DunkelLebensgeschichte einer deutschen Jüdin
Die Vergangenheit ist die Dimension der Grösse. Grösse kann erst erscheinen nach dem Tode; nur Sterbliche können irdisch unsterblich werden, d. h. bleiben, solange das Menschengeschlecht bleibt. Dass wir erst nach dem Tode »gross« oder auch nur »wir selbst« werden können, ist die Entschädigung dafür, dass wir sterben müssen.
Hannah Arendt, Denktagebuch
I.
Als Bertolt Brecht im August 1956 starb, ließ Hannah Arendt einige Wochen später ihre Nichte in Tel Aviv wissen: Dass Brecht tot ist, ist mir recht traurig. Der war mal ein wirklicher Dichter und von der Sorte gibt es immer nur sehr wenige Menschen auf der Welt. Die zwölfjährige Edna Brocke, die ihr zeitlebens als Fröschlein vertraut bleiben wird, erfuhr weiter: Von seinen Gedichten habe ich einen kleinen Vierzeiler immer besonders gern gehabt. Es heisst: Denn die Einen stehn im Dunklen / Und die Andern stehn im Licht / Und man sieht nur die im Lichte / Die im Dunklen sieht man nicht.
Die Worte Mackie Messers gingen mit der Dreigroschenoper um die Welt, aufgeladen mit dem politischen Pathos der Russischen Revolution. Allerdings nutzte Bertolt Brecht die Sowjetunion später nur als Transitland, um sich aus dem dänischen Exil an den amerikanischen Pazifik zu retten. Im Kalten Krieg kehrte er über die Schweiz bewusst in den Osten Deutschlands zurück und erhielt am Berliner Ensemble die Chance, sein Episches Theater zu etablieren. Die Autorin von Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft sah besonders die Gedichte kritisch, die Brecht in jener Zeit verfasst hatte. So schrieb Hannah Arendt in kurzen Worten nach Tel Aviv, was ihr Brecht-Essay Mitte der 1960er-Jahre in polemischen Details entfalten wird: Du weisst ja wohl, dass Brecht Kommunist war und zum Schluss, wie alle Kommunisten, nicht mehr gewagt hat selbst zu denken und die Wahrheit zu sagen, und leider auch viele schlechte Gedichte geschrieben hat. Dabei schätzte die Verehrerin Rosa Luxemburgs durchaus die enthusiastischen Anfänge der politischen Bewegung, für die sich auch Brecht im Willen für Gerechtigkeit und Freiheit begeistert hatte: Aber ursprünglich wollte er doch, dass die kommunistische Revolution so viel Licht in die Welt bringt, dass keiner mehr im Dunklen stehen kann und man alle sieht. Und das ist ein schöner und großer und ganz einfacher Gedanke.
Bald sollte sich diese Skepsis vor Ort bestätigen. Denn als Arendt einige Wochen später nach Europa flog, wo ich mich gewaltig herumzutreiben gedenke, und nebenher auch ein bisschen arbeiten muss in Bibliotheken, überraschte die Ungarische Revolution nach den Moskauer Enthüllungen über den Terror Stalins die Welt. Sie fiel wesentlich umfassender aus als der ostdeutsche Arbeiteraufstand, der im Juni 1953, wenige Monate nach Stalins Tod, niedergeschlagen worden war. Damals hatte Brecht mit dichterischem Sarkasmus davor gewarnt, der Staat solle aufpassen, dass ihm nicht das Volk davonlaufe. In Budapest wollte sich das Volk im plötzlichen Anfang des politischen Tauwetters gänzlich von den totalitären Strukturen befreien, sodass die Rote Armee hier besonders gewaltsam einschritt.
Arendt verfolgte die umwälzenden Ereignisse teilweise in Basel bei Karl Jaspers. Nachdem sie im November 1956 nach New York zurückgekehrt war, schrieb dieser ihr ernüchtert aus Basel: Hilfe für Ungarn ist nur militärisch möglich, aber brächte fast gewiß den Weltkrieg. Darum bleibt sie aus. Aber dieser ungarische Kampf ist etwas, von dem Kant sagen [würde]: »das vergißt sich nicht«. Auch Arendt sah in den Budapester Ereignissen eine seltene Proklamation der Freiheit, die der Königsberger Aufklärer an der Französischen Revolution – bei aller Kritik an ihren Auswüchsen – bewundert hatte. Zudem erinnerte sie Karl Jaspers an die sozialistischen Räte, eine utopische Bewegung, die in Ungarn neu aufgeblüht sei: Mir scheint, es ist immer noch nicht zu Ende, und ganz gleich, wie es ausgeht, ist dies ein eindeutiger Sieg der Freiheit. Dazu wieder, wie bei allen spontanen Revolutionen der letzten hundert Jahre, das spontane Auftauchen einer neuen Staatsform in nuce, des Räte-Systems, das die Russen so geschändet haben, daß kaum noch ein Mensch versteht, was es eigentlich ist.
Entsprechend beschwor sie im späteren Essay Die Ungarische Revolution und der totalitäre Imperialismus die widerständige Freiheitsliebe der Ungarn: Was die Revolution vorwärtstrieb, war nichts als die elementare Kraft, entsprungen aus dem Zusammenhandeln des ganzen Volkes. […] Hier ging es […] einzig darum, eine Freiheit, die bereits eine vollendete Tatsache war, zu stabilisieren und die für sie geeigneten politischen Institutionen zu finden. Die Erinnerung Arendts war lebendig: Fast zwei Jahre sind vergangen, seit die Flammen der Ungarischen Revolution in zwölf langen Tagen den enormen Raum erhellten, den eine der totalitären Diktaturen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beherrscht. Nachdem die Sowjetunion die Menschen wieder in die Dunkelheit ihrer Häuser getrieben hatte, konnte der Wille zur Freiheit sich zumindest kurz nochmals zeigen: Und doch hatte das besiegte und terrorisierte Volk ein Jahr nach der Niederlage noch Kraft genug, um […] sich aus der Dunkelheit herauszuwagen […]. [E]s schickte seine Kinder mit kleinen Kerzen in die Schule, die sie in die Tintenfässer der Klassenpulte steckten.
II.
Die antike Polis war für Arendt das historisch beeindruckendste Vorbild für die freie Zusammenkunft der Menschen. Die Athener Demokratie hatte gezeigt, wie Bürger sich über gesellschaftliche Fragen im streitbaren Gespräch abstimmen können. So pries die Philosophin, als sie 1959 den Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg entgegennahm, die politisch bewegte Freundschaft als deren ideales Medium. Ihre Rede Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten entlehnte erneut bei Brecht die Lichtmetaphorik: In der Geschichte sind die Zeiten, in denen der Raum des Öffentlichen sich verdunkelt und der Bestand der Welt so fragwürdig wird, daß die Menschen von der Politik nicht mehr verlangen, als daß sie auf ihre Lebensinteressen und Privatfreiheit die gehörige Rücksicht nehme, nicht selten. Man kann sie mit einigem Recht »finstere Zeiten« (Brecht) nennen.
Das Licht der Aufklärung, das gerade auch das Denken einzelnen Menschen im Selbstgespräch oder im Austausch mit anderen spendet, erhellt nur schwer das gedankenlose Dunkel der Gesellschaft. Dass der Polemiker Lessing deshalb kaum Freunde fand, als er die religiösen Verhältnisse seiner Zeit kritisierte, bewegte Arendt: Diese Freundschaft in der Welt mit den Menschen im Streit und im Gespräch […] hat ihm unter den damals herrschenden Umständen in deutschsprachigen Gebieten schwerlich gelingen können.
Die Zeit von Klassik und Romantik, als aufstrebende Geister im deutschen wie jüdischen Bürgertum von der neuen Humanität schwärmten, hatte Arendt schon früh beforscht. Neben Essays entstand um 1930 ein Buch. Doch Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik erschien erst 1958, nachdem das Manuskript manche Irrfahrten hinter sich gebracht hatte. Die beiden Schlusskapitel, die im französischen Exil geschrieben worden waren, verloren das lichte Pathos von Freundschaft und Aufklärung. Arendt sprach erschüttert über jene Gesellschaftsgruppe, der sie selbst zugehörte: Das deutschsprachige Judentum und seine Geschichte ist ein durchaus einzigartiges Phänomen. Melancholisch schloss sie angesichts der politischen Verfolgung, dass die Geschichte der deutschen Juden zu Ende ist. Die Lebensgeschichte Rahel Varnhagens veranschaulichte für sie die Problematik der Assimilation, die nun unter der nationalsozialistischen Repression endgültig gescheitert war, nachdem sie zu Anfang des 20. Jahrhunderts nochmals aufgeblüht war. Der literarische Salon, der von 1790 bis zur französischen Besetzung Berlins 1806 in der Jägerstraße alle Hürden zwischen den Freunden genommen hatte, löste sich nach den Befreiungskriegen auf. Alle politische Emanzipation wurde in der gesellschaftlichen Restauration rückgängig gemacht, sodass allein Taufe und Vermählung mit Varnhagen noch gesellschaftliche Akzeptanz ermöglichten.
Nüchtern konstatierte Arendt, wie Rahels Ehe mit einem wesentlich jüngeren Diplomaten zum pragmatischen Asyl geworden war, aber vollkommene Anpassung verlangt hatte. In der Zeit nach den Befreiungskriegen nahm die vom Adel dominierte Gesellschaft das aufklärerische Versprechen zurück: Nicht nur die Juden, auch die Bürger […] geben sich die größte Mühe, dahin zu kommen, wo die Wenigen von Geburt her schon sind, alle sind sie adel- und titelsüchtig. Rahel registrierte in Briefen an die Freundin Pauline Wiesel, so skizzierte es Arendt einfühlsam, die Unmöglichkeit, die Position des gesellschaftlichen Parias zu verlassen: Wir sind neben der menschlichen Gesellschaft. Für uns ist kein Platz, kein Amt, kein eitler Titel da! Alle Lügen haben einen: die ewige Wahrheit, das richtige Leben und Fühlen … hat keinen!
Pauline, die zeitweise Geliebte des preußischen Prinzen, führte eine riskant schwebende Existenz, während Rahel sich nicht einbilden durfte, dass ihre intellektuelle Attraktivität sie vor der Stigmatisierung als Jüdin länger schützen würde. So zog Arendt die Bilanz der Freundschaft zwischen zwei weiblichen Außenseitern, die lange, so ihr Urteil, als Parvenues auf den gesellschaftlichen Höhen gelebt hatten: Pauline stellte sich in voller Freiheit außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, weil ihr großes Temperament und eine unbändige Natur sich keinen Konventionen fügen mochte. […] Rahel stand immer als Jüdin außerhalb der Gesellschaft, war eine Paria und entdeckte schließlich, höchst unfreiwillig und höchst unglücklich, daß man nur um den Preis der Lüge in die Gesellschaft hineinkam.
Varnhagen von Ense verhüllte im Buch des Andenkens, der posthumen Briefsammlung der 1833 verstorbenen Rahel, angesichts des restaurativen Klimas öfter die jüdische Herkunft der Adressatinnen. So führten die Auslassungen und irreführenden Verschlüsselungen von Namen in nahezu allen Fällen dazu […], Rahels Umgang und Freundeskreis weniger jüdisch und mehr aristokratisch zu machen. Hannah Arendt registrierte dies nicht nur ärgerlich, sie reagierte selbst noch 1970 empfindlich, als Uwe Johnson sie in den Jahrestagen als Gräfin Seydlitz verewigen wollte. Sie verbat sich die fiktive Adelung, obwohl sie den in Mecklenburg aufgewachsenen Autor, der 1959 von Ostnach West-Berlin umgezogen war und mit ihr später leidenschaftlich über Brecht stritt, persönlich hoch schätzte: Aber, bitteschön, zur Gräfin machen Sie mich nicht! […] Von allem anderen abgesehen, scheint es Ihnen nicht aufgefallen zu sein, dass ich jüdisch bin.
III.
Die Biografie Rahel Varnhagen beruhte vor allem auf ungedrucktem Brief- und Tagebuchmaterial. Arendt entnahm es nicht nur Rahels Papieren, sondern auch anderen Nachlässen aus dem Romantiker-Kreis. Vielleicht hatte sie sich in diesem Interesse auch an Walter Benjamin orientiert, der um 1931/32 Deutsche Menschen als Eine Folge von Briefen in der Frankfurter Zeitung vorstellte. Wie die Anthologie des Freundes, dem sie im Pariser Exil nahestand, sollte ihr Buch emphatisch an bürgerliche Figuren um 1800 erinnern, die in ihrem aufklärerischen Sinn und ihrer menschlichen Redlichkeit immer unzeitgemäßer wurden. Das Gefüge ihres Textes, in dem sie in den Variationen von Zitaten […] mit größtmöglicher Genauigkeit den Reflexionen der Rahel Genüge tun wollte, setzte ein Zeichen. Dabei endete Rahel Varnhagen mit der tiefen Ernüchterung, welche die aufgeklärte Salonnière im Laufe ihres Lebens erfuhr: Rahel ist Jüdin und Paria geblieben. Nur weil sie an beidem festgehalten hat, hat sie einen Platz gefunden in der Geschichte der europäischen Menschheit. […] Sie hat den jungen Heine mit Enthusiasmus und großer Freundschaft begrüßt – »nur die Galeerensklaven kennen sich«.
Es war nicht Arendts Anliegen, die traumatische Erfahrung durch zeitgemäße Beobachtungen psychologischer Art anzutasten. Vielmehr distanzierte sie sich ostentativ vom pseudowissenschaftlichen Apparat von Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, Graphologie